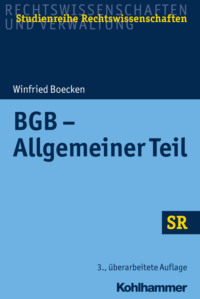Kitabı oku: «BGB – Allgemeiner Teil», sayfa 9
4.Untergang subjektiver Rechte
126 Subjektive Rechte können aufgrund Rechtsgeschäfts393 oder kraft Gesetzes untergehen. Ein rechtsgeschäftlicher Untergang erfolgt durch Verzicht, der z. T. durch einseitiges Rechtsgeschäft394, z. T. nur durch zweiseitiges Rechtsgeschäft (Vertrag)395 möglich ist.
Bsp. (1): Das Eigentum an einem Grundstück kann nach § 928 Abs. 1 dadurch aufgegeben werden, dass der Eigentümer den Verzicht dem Grundbuchamt gegenüber erklärt und der Verzicht in das Grundbuch eingetragen wird.
Bsp. (2): Der Verzicht auf eine Forderung ist gemäß § 397 nur durch einen Erlassvertrag zwischen Gläubiger und Schuldner möglich. Der Gläubiger kann also nicht einseitig entscheiden, die Schuld zu erlassen. Damit soll der Schuldner geschützt werden, dem es vielleicht gar nicht angenehm ist, als jemand dazustehen, dem eine Schuld erlassen wird.
Nicht verzichtbar sind wegen ihrer Höchstpersönlichkeit die Persönlichkeitsrechte, diese gehen, auch wenn das nicht ausdrücklich angeordnet ist, kraft Gesetzes mit dem Tode des Rechtsträgers unter396. Dasselbe gilt, wenn der Gegenstand eines Herrschaftsrechts vernichtet wird. So geht das Eigentum unter, wenn die Sache zerstört wird. Forderungen erlöschen durch Erfüllung, wie sich aus § 362 Abs. 1 ergibt. Immaterialgüterrechte gehen nach Ablauf der Zeit unter, für die sie dem Rechtsinhaber (bzw. seinen Erben) ausschließlich zugewiesen sind. So erlischt nach § 64 UrhG das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.
§ 6Rechtsobjekte
Literatur:
Finger/P. Müller, „Körperwelten“ im Spannungsfeld von Wissenschaftsfreiheit und Menschenwürde, NJW 2004, 1073; Hufen, Die Menschenwürde, Art. 1 I GG, JuS 2010, 1; Spranger, Die Rechte des Patienten bei der Entnahme und Nutzung von Körpersubstanzen, NJW 2005, 1084; Steding, § 90a BGB – nur juristische Begriffskosmetik? Reflexionen zur Stellung des Tieres im Recht, JuS 1996, 962.
Rechtsprechung:
BGH NJW 2000, 2898 (Sachgesamtheit, sachenrechtliches Bestimmtheitserfordernis bei Raumsicherungsübereignung; §§ 929, 930); BGHZ 124, 52 (Schmerzensgeldanspruch bei Vernichtung einer Kryokonserve mit Sperma, Körperverletzung durch Beschädigung oder Vernichtung vorübergehend ausgegliederter Körperbestandteile, Abgrenzung zum Begriff der Sache; § 823 Abs. 1, § 847 Abs. 1 a. F. = § 253 Abs. 2 n. F.); BGH NJW-RR 1990, 586 (Einbauküche als Zubehör eines Wohnhauses; §§ 94 Abs. 2, 97); BGHZ 102, 135 (Kaufrechtliche Sachmängelgewährleistung für fehlerhafte Standardsoftware, rechtliche Einordnung von Verträgen über Softwareleistungen, einheitliche Sache; § 93, §§ 459 ff. a. F. = §§ 434 ff. n. F.); BGHZ 61, 80 (Kfz als einheitliche zusammengesetzte Sache, serienmäßig hergestellter Austausch-Motor nicht wesentlicher Bestandteil des Kfz; §§ 93, 947 Abs. 2); BGHZ 20, 159 (Herstellereigenschaft des Lieferanten von Rohstoffen unter Eigentumsvorbehalt, Hauptsache, Nebensache; §§ 947, 950); RGZ 69, 117 (Maschinen als wesentliche Bestandteile einer Fabrik, Begriff der Sache, natürliche Einheit, zusammengesetzte Sache, wesentliche und unwesentliche Bestandteile, Zubehör; §§ 90, 93, 94, 97, 98); RGSt 64, 313 (Kein Erwerb von Eigentum an einem menschlichen Leichnam durch die Erben, Sachbeschädigung; §§ 90, 1922 BGB, § 303 StGB).
I.Begriff und Abgrenzungen
127 Der Begriff des Rechtsobjekts ist im BGB nicht definiert und wird als solcher auch nicht verwendet. Stattdessen findet sich der Begriff des Gegenstands bzw. der Gegenstände397. Rechtsobjekte werden deshalb auch als Rechtsgegenstände bezeichnet398. Der Begriff des Rechtsobjekts bzw. Gegenstands ist in Gegenüberstellung zu dem Begriff des Rechtssubjekts399 zu verstehen. Mit dem Begriff des Rechtsobjekts werden Gegenstände bezeichnet, die der rechtlichen Beherrschung durch eine Person unterliegen, d. h. von ihr auf der Grundlage und im Rahmen der objektiven Rechtsordnung genutzt und verwertet werden können400.
128 Zu den Rechtsobjekten gehören Sachen401, Tiere402 und Rechte403. Kein Gegenstand des Rechts bzw. Rechtsobjekt ist der Mensch. Die in Art. 1 Abs. 1 GG niedergelegte Menschenwürde verbietet es, den Menschen als einen der rechtlichen Beherrschung durch einen anderen unterliegenden Gegenstand anzusehen. Das gilt auch für die mit dem Menschen unmittelbar verbundenen Persönlichkeitsrechte404. Hingegen stellen vom menschlichen Körper abgetrennte Teile wie z. B. zum Zwecke der Transplantation entnommene Organe vor ihrer Einpflanzung, gespendetes Blut oder auch gezogene Zähne grds. Rechtsobjekte dar405. Allerdings ist nach § 17 TPG der Handel mit menschlichen Organen verboten. Sofern Körperbestandteile ausgegliedert worden sind und nach dem Willen des Rechtsträgers keine körperliche Funktion mehr haben sollen, werden sie mit der Trennung vom Körper als bewegliche Sachen406 in entsprechender Anwendung des § 953 Eigentum desjenigen, von dem sie ausgegliedert worden sind407. Soll dem ausgegliederten Körperbestandteil auch nach der Trennung noch eine körperliche Funktion zukommen, so handelt es sich nach wie vor um einen Bestandteil des Körpers, nicht hingegen um ein Rechtsobjekt.
Bsp.: Lässt ein zeugungsfähiger Mann vor einer Operation, die möglicherweise zur Zeugungsunfähigkeit führt, Sperma einfrieren, um sich für den Fall der Zeugungsunfähigkeit die Möglichkeit zu erhalten, eigene Nachkommen zu haben, so kommt dem eingefrorenen Sperma nach wie vor eine körperliche Funktion zu, es bleibt im rechtlichen Sinne Bestandteil des Körpers. Das führt bei Vernichtung des Spermas dazu, dass eine Körperverletzung i. S. d. § 823 Abs. 1 gegeben ist408.
Nicht als Rechtsobjekt einzuordnen ist auch der menschliche Leichnam409. Der Leichnam ist dem allgemeinen Rechtsverkehr entzogen, selbst Angehörigen steht an dem Leichnam kein Eigentum zu410. Die Nichteinordnung des Leichnams als Rechtsobjekt liegt in dem postmortal fortwirkenden Persönlichkeitsrecht411 begründet. Im Hinblick darauf sind etwa Skelette und Mumien z. B. aus der Steinzeit als Rechtsobjekte anzusehen, denn bei diesen Leichen bzw. Leichenteilen wirkt kein Persönlichkeitsrecht mehr fort.
Das Vermögen, das im BGB an verschiedenen Stellen genannt wird412 und worunter die Summe aller geldwerten Rechte und Güter einer Person verstanden wird413, ist kein Rechtsobjekt. Zwar kann über das Vermögen ein schuldrechtlicher Vertrag wirksam geschlossen werden, wie § 311b Abs. 3 deutlich macht. Jedoch kann das Vermögen nicht als solches auf den Erwerber übertragen werden, vielmehr müssen die einzelnen Gegenstände des Vermögens (Sachen und Rechte) im Wege der Einzelrechtsnachfolge414 nach den für die Übertragung der jeweiligen Rechte maßgebenden Vorschriften übertragen werden. Ebenso wenig wie das Vermögen ist das Unternehmen ein Rechtsobjekt. Der Begriff des Unternehmens wird im BGB häufig verwandt415. Hierunter ist die organisatorische Einheit personeller und sachlicher Mittel zur Erreichung eines wirtschaftlichen Zwecks zu verstehen. Das Unternehmen besteht aus einer Vielzahl bestimmter vermögenswerter Rechte und Güter, z. B. Rechten an Grundstücken, Maschinen, Warenbeständen, Patentrechten wie auch sonstigen Rechten, z. B. Forderungen. Es handelt sich um einen Inbegriff von bestimmten Vermögensgegenständen416. Zwar kann auch über ein Unternehmen ein schuldrechtlicher Vertrag geschlossen werden, z. B. ein Kaufvertrag. Jedoch müssen die das Unternehmen ausmachenden Gegenstände jeweils für sich nach den einschlägigen Vorschriften übertragen werden.
II.Sachen
1.Begriff und Abgrenzungen
129 Nach der Legaldefinition des § 90 sind Sachen im Sinne des Gesetzes nur körperliche Gegenstände. Um einen körperlichen Gegenstand i. S. d. Vorschrift handelt es sich dann, wenn er sinnlich wahrnehmbar, räumlich abgegrenzt, tatsächlich beherrschbar und nach sachenrechtlichen Grundsätzen übertragbar ist417. Der Aggregatzustand des Gegenstandes spielt grds. keine Rolle418. Für die Einordnung eines Gegenstandes als Sache kommt es nicht darauf an, dass er tatsächlich oder rechtlich beherrscht ist, ausreichend ist vielmehr die Beherrschbarkeit. Aus diesem Grunde fallen auch herrenlose Sachen419 unter den Begriff der Sache.
130 Keine Sachen im Sinne des BGB sind nach der ausdrücklichen Vorschrift des § 90a Tiere420. Gleichfalls keine Sachen stellen Energien jeder Art dar, z. B. Strom, Licht, Wärme, Schallwellen oder auch Strahlen421. Diesen Gegenständen fehlt u. a. die für den Sachbegriff erforderliche Körperlichkeit422. Elektronische, auf einem Datenträger gespeicherte Computer-Daten sind ebenso wie Software bzw. Computerprogramme keine Sachen. Allerdings stellt ihre Verkörperung in Gestalt des Datenträgers (z. B. CD-ROM, USB-Stick) eine Sache dar423. Schließlich sind auch natürliche Allgemeingüter wie z. B. Luft und Wasser (offenes Meer, Grundwasser) keine Sachen im Sinne des BGB. Mangels Beherrschbarkeit sind sie dem Rechtsverkehr entzogen,424 darüber hinaus fehlt es an der Abgrenzbarkeit425. Anderes gilt dann, wenn diese Güter in Behältnissen verkörpert werden, etwa Wasser in einem Gefäß. Dann handelt es sich um eine Sache.
2.Unterscheidungen von Sachen
a) Bewegliche und unbewegliche Sachen
131 Eine wichtige Unterscheidung von Sachen ist die zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen. Unbewegliche Sachen sind Grundstücke. Ein Grundstück im Rechtssinne ist der infolge Vermessung räumlich abgegrenzte Teil der Erdoberfläche, der in der Abteilung Bestandsverzeichnis (Register) eines Grundbuchblatts ohne Rücksicht auf die Art seiner Nutzung unter einer besonderen Nummer eingetragen ist426. Grundstücken gleichgestellt sind insb. das Erbbaurecht (§ 11 Abs. 1 Satz 1 ErbbauRG), ferner das Bergwerkseigentum (§ 9 Abs. 1 S. 1 Halbsatz 2 BBergG) und wohl auch das Wohnungseigentum (§§ 3 ff. WEG)427. Insoweit wird von grundstücksgleichen Rechten gesprochen428. Sind Schiffe in das Schiffsregister eingetragen, so werden sie regelmäßig wie Grundstücke behandelt429. Bewegliche Sachen sind die Sachen, bei denen es sich nicht um Grundstücke handelt.
Die Unterscheidung zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen ist in verschiedener Hinsicht von Bedeutung. So erfolgt z. B. die Übertragung des Eigentums an beweglichen und unbeweglichen Sachen nach unterschiedlichen Vorschriften (§§ 929 ff. für bewegliche Sachen, §§ 873, 925 für Grundstücke). Nur für Grundstücke haben im Ausgangspunkt die Vorschriften des privaten Nachbarrechts der §§ 905 ff. Bedeutung. Die schuldrechtliche Verpflichtung zur Übertragung oder zum Erwerb des Eigentums an einem Grundstück bedarf nach § 311b Abs. 1 zu ihrer Wirksamkeit der notariellen Beurkundung430. Demgegenüber ist die Verpflichtung zur Eigentumsübertragung an einer beweglichen Sache formlos wirksam.
b) Vertretbare und nicht vertretbare Sachen
132 Gemäß § 91 sind vertretbare Sachen solche beweglichen Sachen, die im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen. Das sind Sachen, die nach der Verkehrsanschauung ohne weiteres austauschbar sind, d. h., sich von anderen Sachen nicht durch ausgeprägte Individualisierungsmerkmale abheben431. Hierunter fallen z. B. serienmäßig angefertigte Produkte wie Autos und Maschinen, Zeitschriften, Serienmöbel432, Heizöl, Kohlen, Wein433 oder auch Bargeld. Nicht vertretbare (unvertretbare) Sachen sind solche, die durch individuelle Merkmale gekennzeichnet sind434, z. B. eine den Wünschen des Bestellers angepasste Einbauküche435, einmalige Kunstgegenstände, maßgeschneiderte Anzüge oder auch individuell angefertigte Möbel436. Zu den unvertretbaren Sachen gehören auch Grundstücke sowie Eigentumswohnungen437. Die Unterscheidung zwischen vertretbaren und nicht vertretbaren Sachen erlangt u. a. Bedeutung im Schadensersatzrecht.
Bsp.: S ist wegen vollständiger Zerstörung eines dem G gehörenden Original-Gemäldes zum Schadensersatz verpflichtet, dessen Inhalt und Umfang sich nach §§ 249 ff. richtet. Grds. hat S nach § 249 Abs. 1 gemäß dem Grundsatz der Naturalrestitution den Zustand herzustellen, der ohne Eintritt des schädigenden Ereignisses bestünde. Allerdings kommt eine Reparatur als Möglichkeit der Herstellung angesichts der vollständigen Zerstörung des Bilds nicht in Betracht. Zwar kann als Naturalrestitution i. S. v. § 249 Abs. 1 grds. auch eine Ersatzbeschaffung in Frage kommen. Diese Möglichkeit ist jedoch auf vertretbare Sachen i. S. v. § 91 beschränkt438. Sie scheidet im vorliegenden Fall aus, weil es sich bei dem Original-Gemälde um eine nicht vertretbare Sache handelt. S ist daher wegen Unmöglichkeit der Herstellung nach § 251 Abs. 1 verpflichtet, den G in Geld zu entschädigen.
c) Verbrauchbare und nicht verbrauchbare Sachen
133 Nach § 92 Abs. 1 sind verbrauchbare Sachen solche beweglichen Sachen, deren bestimmungsmäßiger Gebrauch in dem Verbrauch oder in der Veräußerung besteht. Hierzu gehören z. B. Lebensmittel und Brennmaterial. Hierbei handelt es sich um tatsächlich verbrauchbare Sachen. Davon zu unterscheiden sind die im Rechtssinne verbrauchbaren Sachen, die zur Veräußerung bestimmt sind, wie z. B. Geld oder Wertpapiere439. Die Regelung des § 92 Abs. 2 fingiert alle beweglichen Sachen als verbrauchbar, die zu einem Warenlager oder zu einem sonstigen Sachinbegriff gehören, dessen bestimmungsmäßiger Gebrauch in der Veräußerung der einzelnen Sachen besteht. Ob ein entsprechender bestimmungsmäßiger Gebrauch gegeben ist, hängt von dem Willen des Berechtigten ab440. Die Unterscheidung zwischen verbrauchbaren und nicht verbrauchbaren Sachen ist z. B. bedeutsam bei Gebrauchsüberlassungsverträgen.
Bsp.: A „leiht“ sich von B ein Fahrrad und eine Packung Salz. Nach Ablauf der vereinbarten Zeit verlangt B beides zurück. A hat das Salz verbraucht. – Bzgl. der Packung Salz besteht keine leihvertragliche Pflicht zur Rückgabe in natura (§ 604 Abs. 1). Salz ist eine verbrauchbare Sache. Nach der „Leihvereinbarung“ zwischen A und B war A zum Verbrauch berechtigt. Verbrauchbare Sachen sind i. d. R. vertretbare Sachen. Deshalb haben A und B einen Sachdarlehensvertrag geschlossen (§ 607 Abs. 1 Satz 1), weshalb der A lediglich „Sachen gleicher Art, Güte und Menge“, mithin eine vergleichbare Packung Salz zurückzugeben hat (§ 607 Abs. 1 Satz 2). Hingegen ist das Fahrrad keine verbrauchbare Sache, die Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrrades stellt keine Form des bestimmungsgemäßen Gebrauchs durch „Verbrauch“ i. S. v. § 92 Abs. 1 dar441. A hat deshalb das geliehene Fahrrad (§ 598) gemäß § 604 Abs. 1 an B herauszugeben.
d) Teilbare und unteilbare Sachen
134 Eine Sache ist teilbar, wenn sie ohne Wertminderung in wirtschaftlich gleichartige Teile zerlegt werden kann, z. B. Bargeld, Zucker oder auch Kartoffeln. Anderenfalls handelt es sich um eine unteilbare Sache, z. B. ein Klavier oder auch ein Fahrrad. Die Unterscheidung erlangt Bedeutung insb. bei der Aufhebung von Rechtsgemeinschaften442. Sofern die Teilung einer Sache in Natur ausgeschlossen ist, kann die Aufhebung der Gemeinschaft nach Maßgabe des § 753 Abs. 1 nur durch Verkauf oder Versteigerung erfolgen.
e) Sache und Sachgesamtheit
135 Sache i. S. v. § 90 ist die Einzelsache bzw. einheitliche Sache oder Sacheinheit. Die Sacheinheit kann zum einen eine natürliche Einheit443 sein, z. B. ein Stein oder die Karte eines Kartenspiels. Zum anderen liegt eine einheitliche Sache auch dann vor, wenn eine Mehrzahl von Sachen nach der Verkehrsanschauung unter Berücksichtigung ihrer Eignung und ihres Verwendungszwecks im Rechtsverkehr als ein einheitlicher Gegenstand angesehen wird444, z. B. ein Kohlehaufen oder ein Legespiel. Eine Einzelsache ist darüber hinaus auch die zusammengesetzte Sache (sog. Körpereinheit)445, in der mehrere zunächst selbständige Sachen derart aufgegangen sind, dass sie als (wesentliche) Bestandteile (§§ 93 ff.)446 ihre Selbständigkeit verloren haben447. Beispiel hierfür ist etwa ein Kraftfahrzeug, das u. a. aus Fahrgestell, Karosserie, Motor, Reifen, Lenkrad usw. besteht448.
136 Bei der sog. Sachgesamtheit handelt es sich nicht um eine Sache i. S. d. § 90, die Sachgesamtheit besteht aus mehreren selbständigen Einzelsachen449, die im Verkehr unter einer einheitlichen Bezeichnung „als zusammengehörend“ zusammengefasst sind und deren Wert und Funktionsfähigkeit durch ihre Vollständigkeit und funktionale Verbindung mitbestimmt wird450. Das Gesetz verwendet den Begriff Sachinbegriff451 und nennt als Beispiel das Warenlager (§ 92 Abs. 2). Weitere Beispiele für Sachgesamtheiten sind etwa Münz-, Briefmarken- und sonstige Sammlungen452, eine „Handbibliothek Kunst“453, der Bestand eines Archivs454 oder auch ein Kaffeeservice oder eine Möbel-Sitzgruppe455. Zwar kann schuldrechtlich eine Verpflichtung zur Übertragung einer Sachgesamtheit eingegangen werden, z. B. zum Verkauf eines Warenlagers. Allerdings kann diese Verpflichtung nur durch Übereignung jeder Einzelsache nach den hierfür maßgebenden Vorschriften erfüllt werden. Darüber hinaus können die Einzelsachen einer Sachgesamtheit unterschiedlichen Eigentümern rechtlich zugeordnet sein.
f) Hauptsachen und Nebensachen
137 Das Gesetz verwendet in manchen Vorschriften den Begriff der Hauptsache, so etwa in § 947 Abs. 2, wonach im Falle der Verbindung beweglicher Sachen gemäß § 947 Abs. 1 der Eigentümer der Hauptsache das Alleineigentum erwirbt, mithin der Eigentümer der Sache, die nicht als Hauptsache anzusehen ist, der Nebensache, das Eigentum verliert. Für die Beurteilung, welche Sachen bei mehreren Sachen als Hauptsache oder Nebensache anzusehen sind, kommt es weder auf das Wertverhältnis noch auf das Verhältnis des räumlichen Umfangs der Einzelsachen entscheidend an. Von einer Hauptsache kann nach der Verkehrsauffassung nur gesprochen werden, wenn die anderen Sachen fehlen können, ohne dass das Wesen der Sache dadurch beeinträchtigt würde456.
Bsp.: Das Gehäuse, in welches ein technisches Gerät eingefügt ist, kann dann nicht als Nebensache i. S. d. § 947 Abs. 2 angesehen werden, wenn zwar das Gerät ohne das Gehäuse in Tätigkeit gesetzt werden kann, jedoch praktisch nicht benutzbar ist457.
3.Wesentliche Bestandteile
138 Gemäß § 93 können Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird (wesentliche Bestandteile), nicht Gegenstand besonderer Rechte sein. Sinn und Zweck von § 93 gehen dahin, die Vernichtung wirtschaftlicher Werte zu verhindern458. Rechtlich soll das dadurch sichergestellt werden, dass wesentliche Bestandteile nicht Gegenstand besonderer Rechte sein können, d. h., das Eigentum an der Sache zugleich auch das Eigentum an deren wesentlichen Bestandteilen umfasst. An einer Sache und ihren wesentlichen Bestandteilen kann also nicht jeweiliges Eigentum verschiedener Personen bestehen459. Rechtliche Bedeutung hat die sog. Sonderrechtsunfähigkeit wesentlicher Bestandteile insb. in den Fällen des gesetzlichen Eigentumsverlusts nach §§ 946 ff. So erstreckt sich nach § 946 das Eigentum an einem Grundstück auch auf bewegliche Sachen, die nach Verbindung mit dem Grundstück dessen wesentlicher Bestandteil geworden sind460.
Unter Bestandteilen einer Sache werden die Teile einer natürlichen Sacheinheit wie auch die Teile einer zusammengesetzten Sache verstanden, die infolge der Zusammenfügung ihre Selbständigkeit verloren haben461. Für die Frage, ob ein Bestandteil einer Sache wesentlich ist und deshalb i. S. v. § 93 nicht Gegenstand besonderer Rechte sein kann, ist entscheidend, ob im Falle einer Trennung der eine oder andere Bestandteil der zusammengefügten Sache zerstört oder in seinem Wesen verändert wird. Insoweit ist maßgebend darauf abzustellen, ob der eine oder andere Bestandteil nach der Trennung unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung noch wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden kann, mag dies auch erst durch erneute Zusammenfügung mit einer anderen Sache möglich sein462.
Bsp. (1): Der Motor eines Kfz ist nicht dessen wesentlicher Bestandteil. Er kann jederzeit für andere Fahrzeuge als Antriebsmaschine verwendet werden. Auch das Kfz kann nach Ausbau des Motors weiter verwendet werden durch Einbau eines anderen Motors463.
Bsp. (2): Die fest verbundenen Glasscheiben einer Thermopan-Verglasung sind wesentliche Bestandteile des Fensters464.
139 § 94 bestimmt eigenständig, welche Sachen wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder eines Gebäudes sind. Die Vorschrift dient über den auch schon für § 93 maßgebenden Zweck, wirtschaftlich zusammengehörende Werte zu erhalten, hinaus der Schaffung klarer und sicherer Rechtsverhältnisse im Grundstücksverkehr465. Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören nach § 94 Abs. 1 Satz 1 die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insb. Gebäude. Gebäude i. S. d. Vorschrift sind nicht nur (Fertig-)Häuser, sondern auch andere Bauwerke wie etwa eine Tiefgarage466. Die Frage, ob eine Sache mit dem Grundstück fest verbunden ist, ist nach der Verkehrsanschauung zu beurteilen. Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks sind nach § 94 Abs. 1 Satz 1 auch dessen Erzeugnisse (§ 99 Abs. 1)467, das sind die natürlichen Bodenprodukte, solange sie mit dem Boden zusammenhängen. Hierzu gehören etwa noch nicht geerntetes Obst oder noch nicht geschlagenes „Holz auf dem Stamm“468. Nach der Regelung des § 94 Abs. 1 Satz 2 werden Samen mit dem Aussäen, Pflanzen mit dem Einpflanzen wesentliche Grundstücksbestandteile.
Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören gemäß § 94 Abs. 2 die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen. Die Frage, ob eine Sache zur Herstellung eines Gebäudes eingefügt ist, ist danach zu entscheiden, ob die Einfügung dieser Sache dem Gebäude ein bestimmtes Gepräge gegeben hat. Dies ist nach der Verkehrsanschauung bei natürlicher Auffassung über das Wesen, den Zweck und die Beschaffenheit des Gebäudes zu beurteilen469. Zur Herstellung eingefügt ist eine Sache, ohne die das Gebäude nach der Verkehrsanschauung noch nicht fertiggestellt ist470.
Bsp. (1): Eine Ölheizungsanlage ist wesentlicher Bestandteil eines Wohngebäudes471.
Bsp. (2): Nach der Verkehrsanschauung ist ein Schulgebäude unter den klimatischen Verhältnissen Mitteleuropas ohne Heizungsanlage nicht fertig. Die Teile der Anlage werden dem Gebäude zu seiner Herstellung eingefügt472.
140 Nach § 95 Abs. 1 Satz 1 gehören zu den Bestandteilen eines Grundstücks solche Sachen nicht, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden sind. Gemäß Satz 2 von § 95 Abs. 1 gilt das Gleiche von einem Gebäude oder einem anderen Werk, das in Ausübung eines Rechts an einem fremden Grundstück von dem Berechtigten mit dem Grundstück verbunden worden ist. In Parallele zu § 94 Abs. 2 bestimmt § 95 Abs. 2, dass die nur zu einem vorübergehenden Zweck in ein Gebäude eingefügten Sachen nicht zu den Bestandteilen des Gebäudes gehören. Die Regelung des § 95 stellt eine Einschränkung zu §§ 93, 94 dar, wonach die Bestandteile einer Sache i. S. d. § 95 – sog. Scheinbestandteile – Gegenstand besonderer Rechte sein können473. Die Frage, ob Sachen nur zu einem vorübergehenden Zweck verbunden oder eingefügt sind, ist nach dem inneren, mit dem äußeren Sachverhalt vereinbaren Willen des Verbindenden im Zeitpunkt der Vornahme der Verbindung zu beurteilen474.
Bsp.: Auch bei einer festen Verbindung mit dem Boden sind etwa eine Kinderschaukel und ein Sandkasten keine wesentlichen Bestandteile des Grundstücks, weil derartige Anlagen nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden werden, nämlich für die Dauer des Bedarfs für spielende Kinder475.
141 Verbindet ein Mieter, Pächter oder ein in ähnlicher Weise schuldrechtlich Berechtigter Sachen mit dem Grund und Boden, so spricht regelmäßig eine Vermutung dafür, dass dies mangels besonderer Vereinbarungen nur in seinem Interesse für die Dauer des Vertragsverhältnisses und damit zu einem vorübergehenden Zweck geschieht476. Diese Vermutung wird nicht schon durch eine massive Bauart des Bauwerks oder aufgrund der langen Dauer des Vertrags entkräftet. Vielmehr ist erforderlich, dass der Erbauer bei der Errichtung des Bauwerks den Willen hat, dieses bei Beendigung des Vertragsverhältnisses in das Eigentum seines Vertragspartners übergehen zu lassen477. Nach der Regelung des § 95 Abs. 1 Satz 2 sind Scheinbestandteile auch solche Gebäude oder andere Bauwerke, die in Ausübung eines Rechts an einem fremden Grundstück von dem Berechtigten mit dem Grundstück verbunden worden sind. Ein solches Recht an einem fremden Grundstück, aufgrund dessen die Verbindung vorgenommen worden ist, kann z. B. das Erbbaurecht sein.
Bsp.: Die von dem Pächter G auf dem Grundstück des L errichtete Windkraftanlage, die nach Ablauf von 30 Jahren wieder vollständig abgebaut werden soll, wird nur Scheinbestandteil des Grundstücks von L. Die lange Laufzeit ändert an dem vorübergehenden Zweck i. S. d. § 95 Abs. 1 S. 1 nichts, sofern nach dem Willen des G im Zeitpunkt der Verbindung feststeht, dass die Anlage nach einer bestimmten Zeit wieder entfernt werden soll478.
142 Gemäß § 96 gelten Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind, als Bestandteil des Grundstücks. Sinn und Zweck dieser Fiktion gehen vor allem dahin, die hypothekarische Haftung nach §§ 1120 ff. auf die mit dem Grundstück verbundenen Rechte auszudehnen479. Zu den Rechten i. S. d. Vorschrift gehören wesentlich die sog. subjektiv-dinglichen Rechte, z. B. Grunddienstbarkeiten (§§ 1018 ff.) und Reallasten (§§ 1105 ff.)480.