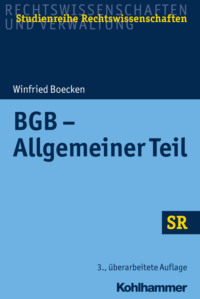Kitabı oku: «BGB – Allgemeiner Teil», sayfa 8
b) Herrschaftsrechte
116 Herrschaftsrechte zeichnen sich dadurch aus, dass dem Inhaber des Rechts Herrschaftsmacht über einen bestimmten Gegenstand349, insb. über Sachen, Rechte und geistige Schöpfungen zukommt. Die Herrschaftsmacht äußert sich vor allem in der Möglichkeit des Berechtigten, über den ihm rechtlich zugewiesenen Gegenstand verfügen350 und diesen nutzen zu können. Zugleich sind die Herrschaftsrechte als absolute Rechte351 von jedermann zu beachten und insoweit umfassend gegen unbefugte Eingriffe Dritter geschützt352.
Herrschaftsrechte gibt es zunächst an Sachen (§ 90), und zwar an beweglichen und unbeweglichen (Grundstücke) Sachen. Insoweit werden diese Herrschaftsrechte auch als Sachenrechte oder dingliche Rechte bezeichnet, diese sind wesentlich im Dritten Buch des BGB, dem Sachenrecht, geregelt. Die einschlägigen Vorschriften gelten über § 90a Satz 3 grds. gleichermaßen für Tiere, die nach § 90a Satz 1 keine Sachen sind.
Umfassendstes Herrschaftsrecht an einer Sache ist das in §§ 903 ff. geregelte Eigentum. Nach § 903 Satz 1 kann der Eigentümer einer Sache mit dieser nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen353. Neben dem Eigentum gibt es weitere Herrschaftsrechte an Sachen, die dem Berechtigten allerdings im Vergleich zum Eigentum nur eine begrenzte Herrschaftsmacht einräumen, weshalb insoweit von beschränkt dinglichen Rechten gesprochen wird354. Hierzu gehört etwa bezogen auf Grundstücke die in §§ 1113 ff. geregelte Hypothek, welche die Belastung eines Grundstücks derart darstellt, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme zur Befriedigung wegen einer ihm zustehenden Forderung aus dem Grundstück zu zahlen ist (§ 1113 Abs. 1). Die Hypothek ist danach Mittel zur Sicherung einer Forderung, etwa eines Bankdarlehens zum Erwerb eines Grundstücks. Erfüllt der Schuldner die Forderung nicht rechtzeitig, ist der Hypothekeninhaber nach § 1147 berechtigt, aus dem Grundstück im Wege der Zwangsvollstreckung Befriedigung zu suchen. Die Hypothek räumt dem Inhaber also anders als das Eigentum nur ein an bestimmte Voraussetzungen geknüpftes Verwertungsrecht hinsichtlich des Grundstücks ein. An beweglichen Sachen kann als Sicherungsmittel ein Pfandrecht nach §§ 1204 ff. bestellt werden. Zu den beschränkt dinglichen Rechten gehören auch Nutzungsrechte an Sachen, z. B. der Nießbrauch nach §§ 1030 ff. Kein Herrschaftsrecht an einer Sache ist der Besitz i. S. d. §§ 854 ff., hierbei handelt es sich lediglich um die tatsächliche Herrschaft (tatsächliche Gewalt, § 854 Abs. 1) über eine Sache. Allerdings ist der berechtigte Besitz vergleichbar dem Eigentum (§§ 985, 1004), gegen Entziehung und Störung geschützt (§§ 861, 862), darüber hinaus ist er als sonstiges Recht i. S. d. § 823 Abs. 1 anerkannt355.
Herrschaftsrechte können auch an Rechten bestehen. So kann nach § 1273 Abs. 1 Gegenstand eines Pfandrechts auch ein Recht sein. Dasselbe gilt für den Nießbrauch nach §§ 1068 ff.
Bsp.: Unternehmer U nimmt bei der Bank B ein Darlehen (§ 488) auf. Zur Sicherung des Kredits räumt U der B nach § 1274 ein Pfandrecht an seiner Werklohnforderung356 aus § 631 Abs. 1 gegen D ein. Wenn U bei Fälligkeit das Darlehen nicht zurückzahlt, ist B zur Einziehung der Werklohnforderung gegen D nach §§ 1282 Abs. 1, 1228 Abs. 2 berechtigt.
Schließlich können Herrschaftsrechte an geistigen Schöpfungen bestehen, insoweit wird von Immaterialgüterrechten gesprochen. Hierzu gehören das Urheberrecht an Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst nach Maßgabe des Urheberrechtsgesetzes (UrhG), des Weiteren Patentrechte (§§ 1 ff. PatG), Markenrechte (§§ 1 ff. MarkenG), Gebrauchsmusterrechte (§§ 1 ff. GebrMG) und Designs (§§ 1 ff. DesignG)357. Dem Inhaber des Immaterialgüterrechts kommt grds. die alleinige und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsmöglichkeit zu. So schützt etwa das Urheberrecht den Urheber nach der allgemeinen Regelung des § 11 UrhG in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk sowie in der Nutzung des Werkes. Neben dem Veröffentlichungsrecht (§ 12 UrhG), dem Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhG) und dem Recht des Verbots der Entstellung des Werks (§ 14 UrhG) steht dem Urheber ausschließlich das Recht zu, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten (§§ 15 ff. UrhG). Immaterialgüterrechte unterliegen einer zeitlich begrenzten Schutzdauer. So erlischt z. B. nach § 64 UrhG das Urheberrecht siebzig Jahre nach dem Tode des Urhebers. Ebenso wie bei den anderen Herrschaftsrechten genießen die Inhaber von Immaterialgüterrechten gegenüber unbefugten Eingriffen Dritter Schutz, wobei die entsprechenden rechtlichen Grundlagen in den jeweiligen Spezialgesetzen zu finden sind.
Bsp.: Nach § 98 Abs. 1 UrhG kann der Urheber eines Werks verlangen, dass alle rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Vervielfältigungsstücke, die im Besitz oder Eigentum des Verletzers des Urheberrechts stehen, vernichtet werden.
c) Familienrechte
117 Als weitere Kategorie der subjektiven Rechte werden die sog. persönlichen Familienrechte eingeordnet358. Hierzu zählt z. B. das Recht auf eheliche Lebensgemeinschaft (§ 1353), das elterliche Sorgerecht (§§ 1626 ff.) oder auch das Vormundschaftsrecht (§§ 1773 ff.). Von den Persönlichkeitsrechten unterscheiden sich die persönlichen Familienrechte darin, dass sie im Verhältnis zu einer anderen Person bestehen359. Zugleich handelt es sich auch nicht um Herrschaftsrechte, denn durch die persönlichen Familienrechte wird keine Herrschaftsmacht360 über andere Personen, z. B. Ehegatten, begründet361.
d) Anteilsrechte und Mitgliedschafts- bzw. Gesellschafterrechte
118 Zu den subjektiven Rechten gehören des Weiteren die sog. Anteilsrechte und Mitgliedschafts- bzw. Gesellschafterrechte. Unter dem Begriff des Anteilsrechts wird die vermögensmäßige Beteiligung einer Person etwa an einer Personengesellschaft (z. B. GbR)362 oder einer juristischen Person (z. B. GmbHG) verstanden363. Mit den Mitgliedschafts- bzw. Gesellschafterrechten werden die Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte an der Willensbildung und Geschäftsführung innerhalb einer Personenvereinigung (Verein, Gesellschaft) bezeichnet364.
e) Gestaltungsrechte
119 Unter einem Gestaltungsrecht wird ein subjektives Recht verstanden, das einer Person die Rechtsmacht einräumt, ohne Mitwirkung eines anderen einseitig auf eine bestehende Rechtslage einzuwirken und diese ändern zu können365. Bedeutsame Gestaltungsrechte sind etwa das Recht zur Kündigung, z. B. eines Mietvertrags (§§ 568 ff.) oder eines Arbeitsvertrags (§§ 622, 626), das Recht zur Anfechtung eines Rechtsgeschäfts (§§ 119 ff.)366 oder auch das Recht zum Rücktritt vom Vertrag (§§ 346 ff.).
Die Ausübung eines Gestaltungsrechts hat i. d. R. durch empfangsbedürftige Willenserklärung (Gestaltungserklärung) zu erfolgen, die mit Zugang beim Erklärungsgegner ihre rechtliche Wirkung entfaltet. So bestimmt § 143 Abs. 1, dass die Anfechtung durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner erfolgt367. Dasselbe gilt für den Rücktritt vom Vertrag, der nach § 349 durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil zu erfolgen hat. Das durch Gestaltungserklärung vorgenommene Rechtsgeschäft (Gestaltungsakt bzw. Gestaltungsgeschäft368) ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, weil der rechtliche Erfolg, etwa die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses oder die Nichtigkeit eines Kaufvertrags, allein durch eine Person herbeigeführt werden kann369. Als einseitige Rechtsgeschäfte sind Gestaltungsakte grds. bedingungsfeindlich, weil sie die Rechtslage eindeutig klären müssen, damit der betroffene Erklärungsempfänger über den durch den Gestaltungsakt neu zu schaffenden Rechtszustand nicht im Unklaren ist370. Anderes gilt nur dann, wenn der Eintritt der Bedingung vom Willen des Erklärungsempfängers abhängig ist (sog. Potestativbedingung)371. Wird ein Gestaltungsrecht durch eine Person ausgeübt, die für die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts der Zustimmung eines Dritten bedarf, so ist bei fehlender vorheriger Zustimmung (Einwilligung) des Dritten das Rechtsgeschäft unwirksam, wie z. B. § 111 S. 1 für das Minderjährigenrecht deutlich macht372. Eine nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) durch den Dritten373 ist grds. nicht möglich, weil auch hier eine Ungewissheit über die Rechtslage für den Erklärungsempfänger vermieden werden soll374.
Die Ausübung des Gestaltungsrechts führt zu dessen Erlöschen, es wird gewissermaßen „verbraucht“375. Das Gestaltungsrecht erlischt auch durch Verstreichenlassen einer Frist, innerhalb derer es hätte ausgeübt werden müssen (s. z. B. §§ 121, 124 für das Anfechtungsrecht)376.
f) Ansprüche
120 Zu den subjektiven Rechten gehören schließlich Ansprüche. Nach der in § 194 Abs. 1 enthaltenen Legaldefinition ist ein Anspruch das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen, der andere ist als Kehrseite des Anspruchs dementsprechend verpflichtet.
Bsp. (1): Ansprüche in Gestalt eines auf ein Tun gerichteten Rechts sind z. B. der Anspruch des Verkäufers auf Kaufpreiszahlung nach § 433 Abs. 2, der Anspruch des Mieters auf Gewährung des Gebrauchs der Mietsache während der Mietzeit gemäß § 535 Abs. 1 Satz 1 oder auch der Anspruch des Eigentümers auf Herausgabe der Sache nach § 985.
Bsp. (2): Ein Anspruch in Form eines Rechts auf ein Unterlassen gegen einen anderen ergibt sich z. B. für den Arbeitgeber aus der Vereinbarung eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots mit dem Arbeitnehmer, wonach dieser für die Zeit nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitgeber in bestimmtem Umfang keinen Wettbewerb machen darf. Insoweit hat der Arbeitgeber einen Anspruch auf Unterlassung von Wettbewerb. Die Zulässigkeit eines solchen, verbreitet vereinbarten nachvertraglichen Wettbewerbsverbots richtet sich nach § 110 Satz 2 GewO i. V. m. §§ 74 ff. HGB377.
Ein Anspruch kann entweder durch Rechtsgeschäft378 begründet werden oder aber auf gesetzlicher Grundlage beruhen. Der rechtsgeschäftliche oder gesetzliche Entstehungsgrund des Anspruchs wird Anspruchsgrundlage genannt.
Bsp. (1): V und K schließen einen Kaufvertrag über eine Sache (§ 433). Aufgrund des Kaufvertrags ist V nach § 433 Abs. 1 Satz 1 verpflichtet, dem K die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Diese Verpflichtung des V ist aus der Sicht des K ein Anspruch auf ein Tun (Übergabe und Eigentumsverschaffung), der rechtsgeschäftlich durch den Kaufvertrag begründet worden ist379. § 433 sagt nur, welche vertragstypischen Pflichten bzw. Ansprüche bei Abschluss des Kaufvertrags entstehen. Dadurch ändert sich nichts an der rechtsgeschäftlichen Grundlage des Anspruchs von K in Gestalt des Kaufvertrags.
Bsp. (2): Beschädigt der S mangels gehöriger Aufmerksamkeit im Verkehr das Fahrzeug des D, so hat dieser nach § 823 Abs. 1 einen Anspruch auf Schadensersatz. Hierbei handelt es sich um einen gesetzlich begründeten Anspruch des D, dessen Entstehung allein davon abhängt, dass die in der gesetzlichen Grundlage des § 823 Abs. 1 bestimmten Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind.
Ansprüche gibt es in allen Bereichen des BGB, also im Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht und Erbrecht. Im Schuldrecht wird der Anspruch als Forderung bezeichnet, wie sich aus § 241 Abs. 1 ergibt. Danach ist der Gläubiger kraft des Schuldverhältnisses380 berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern (§ 241 Abs. 1 Satz 1), die auch in einem Unterlassen bestehen kann (§ 241 Abs. 1 Satz 2). Der Begriff der Forderung bezeichnet mithin einen Anspruch aus einem Schuldverhältnis, das entweder rechtsgeschäftlich entsteht, und zwar nach § 311 Abs. 1 i. d. R. durch Vertrag, ausnahmsweise auch durch einseitiges Rechtsgeschäft (z. B. § 657)381, oder gesetzlich begründet wird, vor allem aus Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff.), Bereicherungsrecht (§§ 812 ff.) oder unerlaubten Handlungen (§§ 823 ff.). Der Begriff des Anspruchs i. S. v. § 194 ist nur teilidentisch mit dem Begriff der Forderung insofern, als jener eben auch Rechte auf ein Tun oder Unterlassen gegen eine andere Person außerhalb des Schuldrechts umfasst.
Bsp. (1): Gemäß § 985 hat der Eigentümer gegen den Besitzer einen Anspruch auf Herausgabe seiner Sache. Hierbei handelt es sich um einen Anspruch aus dem Eigentum382, mithin einen sachenrechtlichen Anspruch.
Bsp. (2): Die Mutter eines nichtehelichen Kindes hat gegen den Vater einen familienrechtlichen Anspruch auf Zahlung von Unterhalt nach § 1615l Abs. 2 Satz 2, wenn wegen der Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann. Der Unterhaltsanspruch endet grds. drei Jahre nach der Geburt (§ 1615l Abs. 2 Satz 3).
2.Unterscheidung nach der Person des Verpflichteten
121 Nach der Person des Verpflichteten werden die subjektiven Rechte in absolute und relative Rechte unterschieden. Von Bedeutung ist die Unterscheidung insb. für die Frage der Verletzbarkeit und des Schutzes der jeweiligen Rechte.
Absolute Rechte sind solche subjektiven Rechte, die gegenüber jedermann wirken und deshalb absolut, d. h., von jeder Person zu beachten sind. Diese subjektiven Rechte können von jedem verletzt werden, weshalb jeder verpflichtet ist, das entsprechende Recht oder Rechtsgut nicht zu beeinträchtigen. Zu den absoluten Rechten gehören insb. die in § 823 Abs. 1 genannten Persönlichkeitsrechte Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, das allgemeine Persönlichkeitsrecht ebenso wie das Namensrecht und das Recht am eigenen Bild als dessen besondere Erscheinungsformen383, das Eigentum und die beschränkt dinglichen Rechte384 wie auch die Immaterialgüterrechte385. Wird in ein absolutes Recht durch einen Dritten unbefugt eingegriffen, so kommen für den Inhaber des verletzten Rechts ggf. Schadensersatzansprüche aus § 823 Abs. 1, Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche aus § 1004 Abs. 1 (analog)386 wie auch Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung nach § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 (Eingriffskondiktion) in Betracht.
Bsp. (1): Beschädigt jemand rechtswidrig und schuldhaft das Kfz eines anderen, so steht dem Eigentümer aus § 823 Abs. 1 ein Schadensersatzanspruch zu.
Bsp. (2): Stürzt von einem Nachbargrundstück ein Baum auf ein Grundstück, so hat der Eigentümer des betroffenen Grundstücks einen Anspruch auf Beseitigung der Beeinträchtigung nach § 1004 Abs. 1 Satz 1. Ist dabei das Haus des Eigentümers beschädigt worden, so besteht bei Verschulden des Grundstücksnachbarn zusätzlich ein Anspruch auf Schadensersatz aus § 823 Abs. 1.
Bsp. (3): Wird ohne Einwilligung des Abgebildeten ein Foto zu Werbezwecken veröffentlich, so hat der Abgebildete einen bereicherungsrechtlichen Anspruch aus §§ 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2, 818 Abs. 2 auf Zahlung einer angemessenen Vergütung387.
122Relative Rechte sind solche subjektiven Rechte, die sich nur gegen bestimmte Personen richten, nur diese sind gegenüber dem Rechtsinhaber verpflichtet und können das Recht verletzen. Zu den relativen Rechten gehören die Ansprüche, insb. auch Forderungen aus einem Schuldverhältnis.
Bsp. (1): Verkäufer V hat einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung (§ 433 Abs. 2) gegen die Käuferin K-GmbH, die bei Fälligkeit nicht zahlt. Die Pflicht zur Zahlung des Kaufpreises kann nur von der K verletzt werden, denn nur diese ist gegenüber V verpflichtet.
Bsp. (2): Wird eine Kaufsache durch einen Dritten zerstört, so kann der Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf Übergabe und Eigentumsverschaffung (§ 433 Abs. 1 Satz 1) zwar wegen Vorliegens tatsächlicher Unmöglichkeit untergehen (§ 275 Abs. 1). Dieser Untergang des Anspruchs des K beruht jedoch auf der gesetzlichen Regelung des § 275 Abs. 1, hiervon ist die tatsächliche Handlung des Dritten, die Zerstörung der Sache, zu unterscheiden.
3.Entstehung bzw. Erwerb subjektiver Rechte
123 Der Erwerb subjektiver Rechte kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Zum einen kann das Recht in der Person des Erwerbers neu entstehen, insoweit wird von einem originären (ursprünglichen) Rechtserwerb gesprochen. Ein solcher liegt z. B. bei der Begründung eines Schuldverhältnisses vor, der Gläubiger erwirbt dadurch originär ein subjektives Recht in Gestalt einer Forderung.
Bsp.: Schließen V und K einen Kaufvertrag, so erwirbt V originär den Anspruch auf Kaufpreiszahlung (§ 433 Abs. 2); der K erlangt ebenfalls originär den Anspruch auf Übergabe und Eigentumsverschaffung an der Kaufsache (§ 433 Abs. 1 Satz 1). Denn diese Ansprüche haben vorher nicht bestanden, sondern sind erst durch den Abschluss des Kaufvertrags begründet worden.
Ein ursprünglicher Erwerb z. B. des Eigentums liegt vor, wenn sich jemand eine herrenlose bewegliche Sache aneignet (§ 958), des Weiteren in den Fällen der Ersitzung (§ 937) wie auch des Erwerbs durch Verbindung, Vermischung, Vermengung und Verarbeitung (§§ 946 ff.).
124 Subjektive Rechte können zum anderen aufgrund eines sog. derivativen (abgeleiteten) Erwerbs erlangt werden. In diesem Fall wird ein bereits bestehendes Recht von dem bisherigen Rechtsinhaber auf eine andere Person übertragen, wobei die Übertragung rechtsgeschäftlich388 oder kraft Gesetzes erfolgen kann. In jedem Fall handelt es sich um eine sog. Rechtsnachfolge. Ein derivativer Erwerb aufgrund Rechtsgeschäfts liegt z. B. vor bei der Übertragung des Eigentums nach § 929 Satz 1 oder auch bei der Abtretung einer Forderung gemäß § 398.
Bsp.: V hat aufgrund des Abschlusses eines Kaufvertrags mit K gegen diesen einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung (§ 433 Abs. 2). Diese Forderung hat V mit dem Abschluss des Kaufvertrags originär erworben. Tritt V seine Forderung gegen K an G nach § 398 ab, so erwirbt der G die Forderung im Wege des derivativen Erwerbs als Rechtsnachfolger des V.
Im Zusammenhang mit dem derivativen Erwerb von Rechten ist zwischen der sog. Singularsukzession (Einzelrechtsnachfolge) und der sog. Universalsukzession (Gesamtrechtsnachfolge) zu unterscheiden. Die grds. allein mögliche Einzelrechtsnachfolge hat zum Inhalt, dass subjektive Rechte jeweils für sich nur einzeln nach den für die Übertragung des Rechts maßgebenden Vorschriften auf einen Rechtsnachfolger übertragen werden können. Hintergrund ist das sachenrechtliche Spezialitätsprinzip, wonach dingliche Rechte nur bezogen auf einzelne Rechtsobjekte bestehen und dementsprechend auch nur einzeln übertragen werden können389. Die Übertragung im Wege der Einzelrechtsnachfolge findet auch dann statt, wenn etwa aufgrund eines Kaufvertrags gleichzeitig eine Vielzahl von Gegenständen bzw. subjektiven Rechten übertragen werden soll.
Bsp.: Arbeitgeber A veräußert aufgrund eines Kaufvertrags seinen Betrieb an B390. Die Übertragung der mit dem Betrieb verbundenen Gegenstände bzw. der daran bestehenden subjektiven Rechte hat grds.391 für jeden Gegenstand einzeln zu erfolgen. So muss A das Eigentum an den Maschinen und Fahrzeugen jeweils nach §§ 929 ff. auf B übertragen. Die Übereignung des Betriebsgrundstücks hat nach §§ 873, 925 zu erfolgen. Forderungen, die A z. B. aus Lieferverträgen gegen Dritte hat, müssen je einzeln an B nach § 398 abgetreten werden.
125 Ausnahmsweise kann eine Rechtsnachfolge auch auf dem Weg einer sog. Gesamtrechtsnachfolge stattfinden. Das bedeutet, dass nicht jedes Recht einzeln nach den hierfür maßgebenden Vorschriften übertragen werden muss, sondern der Rechtsnachfolger in einem Akt in die gesamte Rechtstellung des Rechtsvorgängers eintritt. Wesentlicher Fall der Gesamtrechtsnachfolge ist die in § 1922 Abs. 1 geregelte erbrechtliche Gesamtrechtsnachfolge, wonach mit dem Tode einer Person (Erbfall) deren gesamtes Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen (Erben) übergeht. Hierbei handelt es sich um eine gesetzlich angeordnete Gesamtrechtsnachfolge. Daneben gibt es den Vorgang der Gesamtrechtsnachfolge bei Verschmelzungen, Spaltungen und Vermögensübertragungen von Rechtsträgern nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG), der insoweit gegenüber der erbrechtlichen Gesamtrechtsnachfolge eine Besonderheit aufweist, als hier die (partielle) Gesamtrechtsnachfolge als solche zwar auch gesetzlich angeordnet wird, jedoch auf rechtsgeschäftlicher Grundlage (Verschmelzungs-, Spaltungs-, Vermögensübertragungs-Vertrag) beruht392.