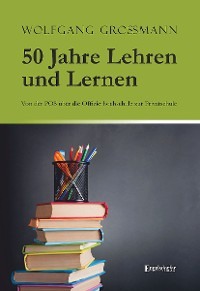Kitabı oku: «50 Jahre Lehren und Lernen», sayfa 2
2. Lehre und Studium (1957-1962)
Auch hier leistete ich mir eine Besonderheit: die Ausbildungsdienststelle musste für mich zunächst ohne Leistung von mir Lehrlingsentgeld zahlen, weil ich mit einer Blinddarmoperation ins Krankennhaus eingeliefert wurde.
In der Berufsschule des Reichsbahnamtes wurden wir ehemaligen EOS-Schüler in einer Klasse zusammengefasst und unsere Ausbildung auf zwei Jahre reduziert. Wir müssen gegenüber den anderen Lehrlingen wohl ganz schön hochnäsig aufgetreten sein. Das hat mir meine Frau öfter aufgetischt – den das war das wichtigste Ergebnis meiner Lehrlingszeit: Ich habe dort meine Frau kennengelernt.
Noch etwas blieb im Gedächtnis haften: Ein Schulkamerad aus der Grundschul- und EOS-Zeit hatte mich nach Berlin eingeladen. Dazu brauchte ich eine Genehmigung der Ausbildungsdienststelle. Die bekam ich nur bei meiner Verpflichtung, West-Berlin nicht zu besuchen. Mein Klassenkamerad als inzwischen eingefleischter Berliner – der k-Laut anstelle von „ch“ gehörte fest zu seinem Repertoire – zerstreute meine Bedenken und mich lockte der „Westen“. Am S-Bahnhof Friedrichstraße glaubte ich jemand aus meiner Ausbildungsgruppe zu erkennen – war mir aber nicht sicher.
Viel später – in der Funktion des Schulparteisekretärs – gab es die einzigartige Möglichkeit, Einblick in die eigene Kaderakte zu nehmen. Siehe da – ich hatte mich nicht geirrt. Die Kaderakten enthielten eine Notiz, dass ich trotz meiner Zusicherung die Grenze zu West-Berlin überschritten hätte.
Am Ende der Ausbildungszeit setzte wieder das Ringen ein, wer erhält die Erlaubnis an der Verkehrshochschule in Dresden zu studieren. Außer einigen „Auserwählten“ sollten wir anderen auf verschiedene Bahnhöfe im Reichsbahnamtsbezirk Leipzig verteilt werden. Das hätte bedeutet, dass allein der Dienststellenvorsteher entschieden hätte, ob und wann wir zum Studium zugelassen werden. Dieser Weg war mir eindeutig zu unsicher. Ich besann mich auf meine Vorliebe für Deutsch und Geschichte und bewarb mich für ein Lehrerstudium.
Ende Juni 1959 hielt ich meine Zulassung für ein Studium als Deutsch- und Geschichtslehrer für die 10-klassige polytechnische Oberschule in den Händen. Die Deutsch-Ausbildung sollte am Pädagogischen Institut Leipzig, die Geschichts-Ausbildung an den historischen Instituten der Universität Leipzig erfolgen.
Das Studium begann mit einem 14-tägigen Vorbereitungslehrgang im GST-Lager Bärenstein. Die militärischen Grundübungen waren zu ertragen; wichtiger war das gegenseitige Kennenlernen. Hier wurde ich wieder zum FDJ-Sekretär gewählt.
Im Laufe des ersten Studienjahres spürten wir allmählich den Unterschied im Studienbetrieb am PI und an der Universität. An den historischen Instituten der Universität bekamen wir (in den meisten Fällen) Spezialisten des Faches als Dozenten; manche so von ihrem Fach begeistert, dass sie uns mitrissen – manche ziemlich trocken – und dann noch im Anatomie-Hörsaal an einem Wochentag 17.00 Uhr! Es blieb jedem selbst überlassen, wie er sich angesprochen fühlte und was er für sein eigenes Wissen tat. Bei der nächsten Prüfung zeigte es sich dann, was jeder Einzelne wirklich „drauf“ hatte.
Ganz anders am PI. Es war mehr oder weniger eine Fortsetzung des Schulbetriebes, bis hin zur Anwesenheitskontrolle. Wir gewöhnten uns schnell an diese Atmosphäre und waren eifrig dabei, uns mit einer Studentin unserer Gruppe auseinanderzusetzen, die mit den Inhalten und der Atmosphäre nicht zurechtkam. Nach mehreren Aussprachen blieb sie weg. Also fuhren der FDJ-Sekretär und eine etwas ältere Studentin zu ihr und ihren Eltern nach Zwickau, um erneut mit ihr zu reden. Sie bekamen wir leider gar nicht zu Gesicht und mit den Eltern fanden wir auch keinen gemeinsamen Nenner. Das Ereignis – ideologisch verpackt – fand Eingang in den Beitrag unserer Seminargruppe zum Kulturwettstreit:
(1) (Melodie: „Ich bin die Christel von der Post …“)
Ich bin aus bürgerlichem Haus,
die höhere Tochter kehr ich raus,
aber das macht nichts,
wenn man nur stolz ist,
wenn man was darstellt,
aus besserm Holz ist.
Recht wenig Arbeit und viel Geld,
ja das ist meine Welt.
(2) (Melodie: „Dunkelrote Rosen …“)
Wie mein Vater sagt, soll ich nun studieren.
Na, man kann es ja auf jeden Fall probieren.
So macht’s die Familie seit Generationen schon,
denn es gehört ja wohl bei uns zum guten Ton.
(3) (Melodie: „Mit 14 Jahren fing er als Schiffsjunge an …“)
Mit 18 fing ich dann am PI an.
Ich war fast die Jüngste, doch ich hielt mich schon ran,
und jeder Junge war hinter mir her,
o, Studium so gefällst du mir sehr.
(4) (Melodie: „Ein Männlein steht im Walde …“)
Doch dann nach einem Jahre, ach wie gemein,
da musste ich zur Prüfung und ich fiel rein.
Und sie sagten:
(5) (Melodie: „Ich komme wieder …“)
Ach komm doch wieder in einem Jahr
Setz dich mal nieder, und mach dir klar,
so geht es auf keinen Fall
sonst kommt eines Tages der große Knall.
(6) (Melodie: „Erst 17 Jahr …“)
Im Seminar Tamtam war groß,
was ich mir dächte, was mit mir los.
In der DDR wär’s wohl famos.
Nur keine Arbeit, her mit dem Moos.
(7) (Melodie: „Von den blauen Bergen …“)
Oh, mir reißt jetzt endlich die Geduld
Und dran sind die selber schuld.
Wenn sie so behandeln ihre Besten,
geh‘ ich eben nach dem Westen,
hier treibt man ja Proletenkult.
Jawohl ich bleibe dabei: In der DDR ist kein Bürgerlicher frei.
Es ist unschwer zu erkennen, wie „revolutionär“ wir uns fühlten, beeinflusst von der klassenkämpferischen Welle im Vorfeld des 13. August 1961.
Ich selbst hatte über einige Umwege meine Bestimmung gefunden: Ich konnte von den Anfängen der Geschichte an in Ereignisse, Ursachen und Zusammenhänge eindringen und diesen historischen Hintergrund mit der Entstehungsgeschichte von literarischen Werken verbinden. Dass es im Fach „Deutsch“ auch noch den Teilaspekt „Sprache“ gab, betrachtete ich als notwendiges Übel.
Starken Einfluss hinterließ bei mir das Fach Marxismus-Leninismus. Fast ohne Ausnahme hatten meine Kommilitonen Berufs- oder NVA-Erfahrungen hinter sich und dementsprechend auch Lebenserfahrungen. Deshalb gab es in den ML-Seminaren immer rege Diskussionen, Vergleiche mit den eigenen Standpunkten und keine Schwarz-Weiß-Malerei. Mir eröffneten sich Einsichten in historische Zusammenhänge und Zugänge zu den Gedanken von Marx, Engels und Lenin. Ich wollte mich in die gesellschaftliche Entwicklung stärker einbringen und bat um Aufnahme in die SED. Diese Aufnahme wurde abgelehnt mit der interessanten Begründung, „ich hätte kein gutes Verhältnis zu den Genossen der Parteigruppe innerhalb der Seminargruppe“. Mit der Berufs- und Lebenserfahrung späterer Jahre hätte ich bei dieser „Begründung“ mehr „hinter die Kulissen“ schauen müssen. Was waren die wirklichen Gründe? Richtig war, dass in der Parteigruppe einige wenige Genossen den Ton angaben, die „Revolution“ mit 3 „R“ schrieben. Sie gerieten immer wieder in Konflikte mit dem diskussionsoffenen, viele Meinungen verarbeitendem Ton der übrigen Seminargruppe. Als Seminarsekretär war es mir wichtiger, diesen offenen Ton zu erhalten, als mancher von der Parteigruppe gewünschten „Verengung“ nachzugehen.
Da hatte ich also dafür (oder für manche mir damals unbekannte Notiz in meiner Kaderakte?) die Quittung bekommen! In mir löste die Ablehnung eher eine Trotzreaktion aus: Ich wollte meiner Familie, den Kommilitonen, den Dozenten und den „Ansprechbaren“ in der Parteigruppe beweisen, dass ich „besser“ war als ihre damalige Meinung.
Großen Einfluss auf mich übte ein Literatur-Dozent aus, Herr Dr. J. Von ihm inspiriert, wandte sich mein Literatur-Interesse immer mehr der Deutschen Klassik zu und speziell Johann Gottfried Herder, dem „Vorbereiter“ und „Anreger“ der Deutschen Klassik. Besonders stolz war ich darauf, bei Dr. J. am PI sozusagen „Hilfs-Assistenten-Dienste“ zu verrichten. Einige Male lud er mich am Wochenende zu sich nach Hause ein. Dort wartete ein Berg Staatsexamensarbeiten auf uns. Ich durfte dann – gleich ihm – mein Urteil abgeben zur Staatsexamensarbeit eines mir unbekannten Kommilitonen, die dann mit der Unterschrift von Herrn Dr. J. versehen wurde. Meine Frau kritisierte das als „Ausbeutung“, ich aber fühlte mich geehrt.
Mit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 war in unserer Seminargruppe noch ein „Problem“ zu behandeln. Wir erhielten alle die Mitteilung, dass das Praktikum verlängert wurde – über die Volkswahl hinaus. Ein Kommilitone bemühte sich darum, in seinem Heimatort als Briefwähler zu wählen. Das scheiterte. Er hatte davon die Nase so voll, dass er nicht zur Wahl nach Leipzig fuhr. Großes Problem: ein Nichtwähler; Folge: lange Diskussionen, bis er sein „Fehlverhalten“ einsah – Verbandsstrafe (Verweis).
Neben unseren beiden Studienrichtungen hatten wir ganz im Sinne der „Polytechnischen Oberschule“ 14-tägig einen „Unterrichtstag in der Produktion“ zu absolvieren: für uns die Arbeit in einer Gießerei. Das wurde ergänzt durch ein 14-tägiges Praktikum in einer LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft). Anschließend brüsteten besonders wir Stadtkinder uns mit dem „Staatsexamen Landwirtschaft“.
Unser Prüfungspraktikum für den Unterricht absolvierte unsere Seminargruppe in Zwickauer Schulen. Zu meinem größte Bedauern durften wir kein Literatur-Thema als Prüfungsstunde wählen – sondern nur aus dem Bereich „Deutsche Sprache“. Nach anfänglichem „Abtasten“ verstand ich mich mit der Klasse und dem Mentor sehr gut und sie fieberten mit mir dem Ergebnis entgegen. Ich hatte den deduktiven Weg gewählt und wollte meine Erkenntnis krönend im Schlussteil erarbeiten. Leider war eine Schülerin so eifrig, dass sie diese Erkenntnis schon in der Mitte der Stunde erfasste. Das brachte mein ganzes logisches Gebäude zu Fall und der 2.Teil der Stunde war dann nicht so gut wie der erste.
Damit war das Ende unserer Studienzeit eingeläutet. Unser auf 4 Jahre angelegtes Studium wurde auf 3 Jahre verkürzt + 1 Jahr Fernstudium. Ausnahmslos alle Kommilitonen waren froh, bedeutete das doch: ein Jahr früher Geld verdienen.
Zuvor galt es aber die Hürde „Prüfungszeit“ zu nehmen und das hies: in 14 Tagen 12 Prüfungen. Das ging nur über ein äußerst gewissenhafte Ausarbeitung der Prüfungsschwerpunkte – Konzentration darauf am Tag vorher bzw. am gleichen Tag – Prüfung – 1 bis 2 Stunden „Luft schöpfen“ – Konzentration auf die nächst Prüfung. Im Gedächtnis haften geblieben ist mir eine Geschichtsprüfung. Als ich am Vormittag im Institut ankam, schlug mir gleich die Hiobsbotschaft entgegen: Hauptprüfer war nicht der wissenschaftliche Mitarbeiter B. zur Geschichte der Sowjetunion (das hatte er uns zuvor zugesichert!), sondern Prof. G. (jener mit der Vorlesung zur Geschichte der Volksdemokratien, wochentags 17.00 Uhr im Anatomiehörsaal). Ergebnis bisher: 2x4, einer durchgefallen! Mein Vorgänger kam bleich, aber glücklich mit einer „3“ aus dem Prüfungszimmer. Und dann ging auch noch der Institutsdirektor, Prof. M., in den Prüfungsraum! Wahrscheinlich war das aber mein Glück, denn er war jetzt der Hauptprüfer. Meinen Prüfungsschwerpunkt „Russische Revolution von 1905“ hatten wir schnell abgehandelt und dann ging es „quer durch den Garten“ bis zum Leben der Zarenfamilie im Winterpalast in (damals noch) Leningrad. Mit einer „1“ kam ich überglücklich aus dem Prüfungszimmer.
Diese „1“ sollte nicht die einzige bleiben. Bei diesem „Hauptstoß“ der Prüfungen erreichte ich ein „sehr gut“. Damit hatte sich die harte Arbeit ganz besonders in den letzten Monaten und das Zurückstellen meiner Familie gelohnt Ich hatte endlich meinen Weg gefunden und bewiesen was ich kann. Das galt auch im Hinblick auf die Genossen in der Parteigruppe, die mich abgelehnt hatten. Ob ihrer eigenen Leistungen waren sie inzwischen etwas ruhiger geworden.
Die nächste Hürde war: In welchem Teil der DDR erfolgte meine Zuweisung? Grundsätzlich galt: der Hauptteil der Absolventen geht auf das Land! Für mich als „Stadtpflanze“ ein Horror! Ich sage es offen: Frau und Kind, der Herzinfarkt meiner Mutter und vielleicht auch mein Wunsch, möglichst bald an das PI als wissenschaftlicher Mitarbeiter zurückzukehren brachte mir den Hauptgewinn: Zuweisung nach Leipzig-Stadt!
3. 20 Jahre Schuldienst (1962-1982)
Der richtungweisende Abschnitt in meinem beruflichen Leben begann am 1.August 1962 mit der Zuweisung als Lehrer an der 16 Polytechnischen Oberschule in Leipzig. Die 10 Jahre, die ich an dieser Schule als Lehrer und später als Schulparteisekretär zugebracht habe, waren geprägt durch einen „Mehrfrontenkampf“. Ich musste meinen Platz finden im Lehrerkollegium; nicht ganz einfach, wenn aus ehemaligen Lehrern plötzlich Kollegen werden. Mein Ehrgeiz war es, meine Kenntnisse und Erkenntnisse aus dem Studium in einen guten Unterricht umzusetzen. Es galt, die Aufgaben als Klassenleiter zu meistern. Um mein Ziel zu erreichen, an das PI zurückzukehren, brauchte ich nach Beendigung des Fernstudiums am PI noch ein weiteres Fernstudium an der Pädagogischen Hochschule Potsdam zur Erlangung der Lehrbefähigung für Deutsch bis zur Klasse 12. Letztlich bescherte eine bürokratische Auslegung meiner Familie auch noch Wohnungsprobleme.
Beginnen wir mit dem Fernstudium: Die Aufgaben im ersten Jahr als Lehrer und Klassenleiter forderten meine ganze Aufmerksamkeit. Dadurch rückte das Fernstudium am PI etwas in den Hintergrund. Mit einer Ausnahme: meiner Staatsexamensarbeit am PI zum „Mittelalterbild des jungen Herder“6 – einen weiteren Schritt, mir die Bedeutung Herders bewusst zu machen, betreut von Dr. J. Mit dem sehr guten Ergebnis der Staatsexamensarbeit war der Abschluss mit „sehr gut“ am PI gesichert. Dieser Abschluss leistete mir bei der Aufnahme zum Fernstudium an der PH Potsdam gute Dienste. Er ersparte mir die Aufnahmeprüfung. Durch die wäre ich durchgefallen – in Sprachgeschichte.
Als unsere Seminargruppe zum 1.Mal zusammenkam, staunte ich nicht schlecht, in welch „illustren“ Gesellschaft ich mich befand. Die Gruppe bestand zu großen Teilen aus Dozenten vom PI, die ich selbst im Studium erlebt oder am PI kennengelernt hatte. Sie hatten dort unterrichtet, ohne die dafür notwendige Qualifikation zu besitzen. Sicher hätte ich deshalb meine Meinung zu den Studienjahren am PI nicht immer so ungeschminkt sagen sollen; denn einer meiner Studienkollegen wurde nach dem Studium Kaderbearbeiter am PI.
Das Fernstudium an der PH Potsdam lief nicht so „verschult“ ab wie am PI. Und zumindest die Sprachausbildung war tiefgründiger und überzeugender. Mein historisches Interesse konnte ich in Sprachgeschichte und Ausdrucksschulung um einiges erweitern. Das führte dazu, dass ich bei der Behandlung beispielsweise von Satzbauplanplänen, von Satzrahmen und Ausdruckshervorhebungen im deutschen Satz im Unterricht bei meinen Schülern so viel Material und Wissen besaß, so dass ich sagen kann, spätestens nach der 2.Behandlung im Unterricht gehörte das zu meinem festen Wissensrepertoire.
Der Literaturbereich an der PH Potsdam war stark bestimmt von „Klein-Becher“ und „Klein-Brecht“ – zwei Dozenten, deren Spitznamen nicht nur etwas über ihren Hauptgegenstand aussagen; nein, deren Habitus auch mit ihren Helden übereinstimmte. „Klein-Becher“ verhalf uns zu einer wissenschaftlichen, aber auch dem Schüler zu vermittelnden Gedichtanalyse. „Klein-Brecht“ ließ seine Beziehungen spielen, damit wir Studenten den Film zu Erik Neutschs „Spur der Steine“ zumindest in einer geschlossenen Veranstaltung sehen konnten. Der Film war aber so tief in der „Giftkiste“ vergraben, dass es nicht einmal ihm gelang. Ich gehörte zu den wenigen, die den eindrucksvollen Film in Leipzig bei einer Nachmittagsvorstellung sehen konnten, bevor in der nächsten Vorstellung bestellte Anti-Claqueure zum Abbruch der Vorstellung zwangen. Wer den Film einmal gesehen hat, vergisst die „Badeszene“ nie oder das Organisationstalent von Balla (Manfred Krug!), wenn er Material für seine Baustelle beschafft, eingedenk seines Ausspruches „Der Plan ist, wenn er sich querstellt, ein Arschwisch!“.
Zu den Lehrgängen in Potsdam waren wir untergebracht in einem Studentenwohnheim neben dem Schloss Cäcilienhof, dem Verhandlungsort des Potsdamer Abkommens. Das Wohnheim lag unmittelbar an der Grenze zu Westberlin. Wenn wir die Beine ins Wasser hängten, richteten sich schon die Ferngläser der Grenzpolizei auf uns. Der Weg zur PH war lang: am Schloss Cäcilienhof vorbei bis zur Straßenbahn, damit bis ans andere Ende der Stadt, quer durch den Park von Sanssouci bis zum Neuen Palais. Studium, Studienvorbereitung und Weg ließen uns so wenig Zeit, dass wir nur 2x in den Direktstudienwochen zur „schöpferischen Pause“ eine Gartenkneipe aufsuchten.
Es nahten die Prüfungen – ohne Prüfungsschwerpunkte. Einem Dozenten entlockten wir die Aussage, dass der Prüfungsstoff aus dem 19.Jahrhundert, einem anderen, dass es Lyrik war. Dann spielten die meisten von uns Vabanque: 19.Jahrhundert / Lyrik, das kann nur Heinrich Heine „Deutschland – ein Wintermärchen“ sein. Und die Aufgabe lautete: Analyse des Caput I.
Ein bisschen Glück hier und viel Arbeit im Studium und an meiner 2.Staatsexamensarbeit – zu Herders „Reisjournal“ und zu seinen Schulreden7 – verhalfen mir auch hier zu einem „sehr gut“ und zu einem Angebot einer Stelle im Literaturbereich der PH. Vielleicht hätte ich mir meine Entscheidung zur Ablehnung gründlicher durchdenken sollen, aber primär war ich zu diesem Zeitpunkt 1968 stark als Klassenleiter involviert, hatte meine Hoffnungen für das PI Leipzig noch nicht aufgegeben und wollte nach dem 2.Kind und Kämpfen um die Wohnung in Leipzig nicht ein jahrelanges Pendeln zwischen Potsdam und Leipzig auf mich nehmen. Der intensive Wohnungsbau in Potsdam begann leider erst einige Jahre später.
Doch zurück zum „Hauptschauplatz“ 16. POS. Als ich sie als 14jähriger verließ, hatte ich mir nicht träumen lassen, dass ich sie als 22jähriger wieder als Lehrer betreten sollte. Dabei war ich zunächst gar nicht für die 16. vorgesehen, sondern für die 62. POS in Portitz. Das hätte für mich einen langen Schulweg bis an den Stadtrand bedeutet. Aber die Schule gefiel mir bei meinem Antrittsbesuch schon: klein, überschaubar, in einem kleinen Park gelegen. Ich habe deren Vorteile, aber auch Nachteile noch gründlicher kennengelernt, denn 1977 übernahm ich die Schule als Direktor.
Kurz vor Beginn des Vorbereitungsmonats August kam plötzlich eine Nachricht: Einsatz an der 16. POS. Damit kehrte sich vieles um. Der Schulweg war plötzlich super kurz, denn von der Hofseite unserer Wohnung hatte ich die 16. immer im Auge. Die Schule war aber wesentlich größer: Mit ca. 50 Kollegen und 3-4 Klassen pro Klassenstufe.
Gemeinsam mit mir kamen vier Unterstufenlehrer an die Schule. Sie kannten sich bereits vom Studium am IfL (Institut für Lehrerbildung). Mit uns kam ein bisschen frischer Wind an die Schule. Wir haben manchmal gefrotzelt: der Bezirk Leipzig war traditionell das Schlusslicht in der Volksbildung der DDR. Im Bezirk war das meist die Stadt Leipzig und in der Stadt oft der Stadtbezirk Nordost. Die „rote Laterne“ im Stadtbezirk bekam entweder die 18. POS oder die 16. POS, d.h.: in der DDR kam hinter uns gar nichts mehr.
Als Klassenleiter wurde ich gleich ins „eiskalte Wasser“ geworfen. Ich bekam eine 9. Klasse, weil der vorhergehende Klassenleiter Fachberater für Deutsch wurde. Erfreulicherweise war er noch für Ratschläge erreichbar. 1962 war das Jahr, wo die 10-klassige Oberschule in der DDR Pflicht wurde. Das sahen aber durchaus nicht alle Schüler und deren Eltern so. In meiner Klasse waren 4 Schüler, die die Schule einfach nicht mehr besuchten. Das brachte viel Unruhe in die Klasse und unter die Eltern. Es war schon problematisch, wenn einer von diesen Schülern nach den ersten Wochen „Schwänzen“ in der Pause in der Schule erschien und damit prahlte, wie viel Geld er als Angelernter bei der Müllabfuhr verdient. Dass das ein „Knochenjob“ war und jemand ohne Berufsausbildung nicht mal in der DDR eine Perspektive hatte, sahen weder der Betreffende, noch die meisten seiner ehemaligen Mitschüler. Nachdem klar wurde, dass es aussichtslos war, die Schüler wieder in die Schule zu holen, kämpfte ich den „Behördenkampf“, um endlich wieder Ruhe in die Klasse zu bringen. Kurz vor dem Weihnachtsfest 1962 hatte ich es erreicht: die 4 Schüler wurden offiziell mit der 8. Klasse entlassen. Damit hatte ich mir bei den verbleibenden Eltern erste Pluspunkte verdient.
Stichwort: Eltern. Der Klassenleiter meiner Parallelklasse war ein älterer, ehemaliger Lehrer von mir, Herr H. Er gehörte zu dem Kollegenkreis, die ich dann als stellvertretender Direktor und als Direktor so richtig verstehen lernte: Kollegen, die viele Dienstjahre „auf dem Buckel“ hatten, ausgerüstet mit viel methodischer und Lebenserfahrung, aber nicht mehr mit dem Elan ihrer Anfängerjahre. Dass Herr H. ein solcher Lehrer war, wussten vor allem die Eltern seiner Schüler. Sie hielten ihre Kinder immer wieder an, ja nicht bei Herrn H. „über die Stränge“ zu schlagen.
Ein Instrument hatte mir mein Vorgänger noch hinterlassen, um die Klasse zusammenzuschweißen: das Klassenkabarett „Die Volkmarsdorfer Räbchen“. Ein Mitarbeiter des Patenbetriebes, der Mitglied des LVB-(Leipziger Verkehrsbetriebe) Betriebskabaretts war, versorgte uns mit „abgelegten“ Texten; wir modelten sie auf Jugendliche und Vollkmarsdorfer Probleme um und traten damit bei Volksfesten und politischen Anlässen auf.
Das forderte die „Räbchen“ und stärkte durch gemeinsames Üben und Erfolgserlebnisse das Selbstvertrauen und den Zusammenhalt.
In diese Richtung hatte mir auch ein erfahrener Kollege geraten: Lerne die Schüler nicht nur aus dem Unterricht kennen, sondern erlebe sie auf Wanderfahrt! In der Tat, nach der ersten Wanderfahrt im Frühjahr 1963 schätzte ich große Teile der Klasse anders ein. Einige der „Nichtso-Guten“ im Unterricht waren wenig auf sich bedacht. Sie sorgten dafür, dass die „Truppe“ zusammenhielt. Einige „Gute“ aus dem Unterricht sahen dagegen zunächst einmal sich selbst.
Noch ein prägendes Erlebnis aus meinem 2. Lehrerjahr habe ich nie vergessen: Ich hatte bald mitbekommen, dass von zwei befreundeten Schülerinnen meist die eine der „Hauptmacher“ und die andere immer wieder einige Dinge „übernahm“. In einer Stunde ließ ich mich dazu hinreißen ohne vorherige Prüfung das vor der Klasse zu postulieren. Ich merkte nur, wie bei der 2.Schülerin „die Jalousie fiel“ und die Klasse anders reagierte als sonst. Gott sei Dank kam in der Pause ein Schüler zu mir und sagte: „Diesmal liegen sie vollkommen daneben. Es war genau umgekehrt. Die Schlechtere hatte sich viel Mühe gegeben und die Bessere hat es übernommen!“. Ich weiß noch, dass ich sehr tief Luft geholt habe. Nach der Pause bin ich vor die Klasse getreten und habe mich bei der zu Unrecht verdächtigten Schülerin entschuldigt. Ich bin sicher, dass das meiner Autorität nicht geschadet, sondern eher genützt hat. Leicht ist es mir dennoch nicht gefallen.
Ein ganz anderes Feld: Kabinettunterricht. Traditionell gibt es an jeder Schule ein Physikkabinett und ein Chemiekabinett, weil der Unterricht in diesen Fächern im Klassenzimmer gar nicht möglich ist. Ein erfinderischer Kollege hatte in der 16. POS bereits ein Geographiekabinett geschaffen. Das spornte einen Kollegen und mich dazu an, an der Schule ein Geschichtskabinett zu entwickeln. Die 16. POS war einstmals eine Volksschule, die Klassenräume dementsprechend auf größere Klassenfrequenzen eingestellt. Das ermöglichte es uns, von einem Klassenzimmer einen kleinen Teil mit Spanplatten abzuteilen, wo die Bilder und Karten für den Geschichtsunterricht immer griffbereit waren. Außerdem blieb da noch Raum für das Episkop (zur Projektion aus Büchern) und eine selbst hergestellte Mattglastafel zur Tageslichtprojektion. Die Rückwand dekorierten wir mit Filmplakaten zu historischen Stoffen. An der Längswand brachten wir ziemlich weit oben einen Jahreszahlenstrahl an, der mit Applikationen Zeitverständnis und Merkzahlen vermittelte. Letzterem diente auch eine Stecktafel mit Blechmarken. 10 Stück der Blechmarken mit eingestanzten Jahreszahlen wurden „so nebenbei“ am Anfang der Stunde einem Schüler in die Hand gedrückt. Er bekam einige Minuten, um sie an der Tafel richtig zuzuordnen. Das für historische Verständnisse notwendige Zeitgefühl entwickelte sich enorm. (Die Kehrseite der Medaille erlebte ich bei den Azubi Erzieher, Alten- und Krankenpflegern, Kosmetikerin und ESO-Sekretärin in den letzten Jahren: Nur ja nicht fragen, wann was war!) Unter dem Zahlenstrahl installierten wir zwei Schaukästen, in denen selbst hergestellte Plakate zu historischen Ereignissen und Zusammenhängen ihren Platz fanden: zunächst von uns Kollegen entworfen, von den Schülern hergestellt; später alles in eigener Regie der Schüler.
Die Tische für die Schüler wurden in einem leichten Halbrund am Fußboden festgeschraubt, damit das ewige Hin- und Hergerücke der Tische aufhörte. Als „Lehrertisch“ organisierten wir eine ausrangierte Glastheke aus dem Kaufhaus, deren Sichtfläche oben und vorn uns weiteren Platz zu historischen Auslagen bot. Verdunklungsvorhänge vor den Fenstern vervollständigten das Interieur.
Dieses „Schmuckstück“ Geschichtskabinett trug dazu bei, dass ab 1964 an der 16. POS weitere Kabinette für Deutsch Mathematik, Russisch und Biologie entstanden. Das „Für“ dieser Maßnahme (Fachatmosphäre mit emotionaler Wirkung, Konzentration der Lehr- und Lernmittel) sollte über das „Wider“ (erhöhte Unruhe im Schulhaus durch das „Wandern“ der Klassen, Ordnungsprobleme in den Kabinetten, organisatorische Problem beim Stundenplanbau) siegen8. Die folgenden Schuljahre bewiesen jedoch, dass dieser Plan nur funktionierte, wenn sich ein oder zwei Kollegen wirklich für das Kabinett als „ihr“ Kabinett verantwortlich fühlten.
Einarbeiten ins Lehrerteam, Beziehungen als Klassenleiter finden zu Schülern und Eltern, mithelfen an der organisatorischen Ausgestaltung der Schule, das alles hatte endgültig nur Wirkung, wenn dahinter ein fachlich sicherer und methodisch abwechslungsreicher Unterricht steht. Der Unterricht ist und bleibt das Hauptfeld, wie sich ein Lehrer Autorität an einer Schule erwirbt.
Meine Vorliebe für die Deutsche Klassik konnte ich im Literaturunterricht der 10. Klasse an Goethes „Egmont“ beweisen: „Es ist eine Binsenweisheit, dass zur Vermittlung eines anschaulichen Bildes über ein literarisches Werk das Dichterwort an erster Stelle stehen muss. Wie viele Kollegen verzichten aber noch bei einem dramatischen Werk auf einen Theaterbesuch (dort, wo er möglich ist) und beschränken die Vorkenntnisse der Schüler auf eine meist oberflächliche Hauslektüre. Zusätzlich zur Wirkung des szenischen Geschehens sollte das Dichterwort im Unterricht…zur Erarbeitung der Funktion bestimmter Szenen, zur Beweisführung von Behauptungen oder der Grundlage selbständiger Schülerarbeiten dienen9. Theaterbesuch, Schülerreferat und Schülerdiskussionen, differenzierte Betrachtung der Volksgestalten, Aufdeckung der (inneren) Widersprüche in Egmont, Gegenüberstellung von Egmont und Alba in ihren Ansichten zum Volk, Staat und Recht (äußerer Konflikt)10 hinterließen bei den Schülern die Wirkung, die wir von der Behandlung literarischer Werke erwarten.
Dazu muss man sich – wie oben – als Lehrer intensiv mit dem Werk auseinandersetzen und mit dem eigenen „Brennen“ die Schüler „anzünden“ oder man muss sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen, damit das Werk in Erinnerung bleibt. Als Klassenleiter einer 8. Klasse ab Schuljahr 1964 weckte ich das Interesse, indem die Schüler zu Ludwig Renns Kinderbuch „Trini“ eigene Buchumschläge entwarfen. Eine Steigerung dazu waren die selbstentworfenen Programmhefte zu Brechts „Die Gewehre der Frau Carrar“. Einige eindrucksvolle Exemplare beider Entwürfe besitze ich noch heute.
Es war nicht immer leicht, als „Anfänger“ einen eigenen Weg zu gehen. Ich erinnere mich an 2 Situationen: Mit dem „buchstabengenauen“ Fachberater für Geschichte B. war ich öfter nicht einer Meinung. Konträr standen wir vor allem zu den damals für viele Fächer erscheinenden „Handreichungen“ mit Unterrichtsbeispielen. Für ihn führten die „Handreichungen“ nur zum „Abkupfern“. Ich sah das anders: Natürlich konnten sie einen formal arbeitenden und/oder sehr unerfahrenen Lehrer zum „Abkupfern“ verführen. In der Hand eines schöpferisch arbeitenden Lehrers waren sie aber Gedankenanregungen, Impulse. So waren sie schließlich auch gedacht.
Nur gut, dass jener Fachberater nicht im Unterricht dabei war, als beim Thema „Vertreibung am Ende des II. Weltkrieges“ plötzlich eine Schülerin sehr emotional reagierte, in Tränen ausbrach. Auf mein Befragen erklärte sie schließlich, dass sie erst kürzlich von ihrer Oma erfahren habe, welche Leiden die Flüchtlinge „auf dem Treck“ durchmachen mussten und wie sehr sie unter den Übergriffen der sowjetischen Soldaten gelitten haben. Das war nun seit Jahren in der DDR ein Tabu-Thema! Hätte ich pflichtgemäß darüber hinweggehen sollen? Ich wusste, dass das Thema zum ersten Mal 1962 in Werner Steinbergs Roman „Als die Uhren stehen blieben“ sehr metaphorisch angegangen wurde11 – also habe ich die Balance versucht zwischen dem Aufgewühltsein der Schülerin, den historischen Fakten und dem nicht allzu breiten Eingehen auf das Immer-Noch-Tabu-Thema. Die Schülerin war später eine der eifrigsten in der Geschichts-AG.
Bereits im 3.Jahr meiner Lehrertätigkeit wurde ich zum Mentor für Studenten Deutsch/Geschichte bzw. Staatsbürgerkunde von der Universität Leipzig auserkoren. Fast alle dieser Studenten sind mir positiv in Erinnerung geblieben. Sie waren meist methodisch unerfahren, manchmal ungeschickt, aber sehr eifrig. Weil ich mit meinen 27 Jahren altersmäßig gut zu ihnen passte, stimmte der „Draht“. Sie waren mit dem Ergebnis der mehrmonatigen Praktika zufrieden und sie hatten mir bei der Klassenleitertätigkeit, beim Kabinett-Ausbau und in der außerunterrichtlichen Arbeit mit den Schülern geholfen. Einer der ehemaligen Praktikanten wurde mein Nachfolger an der 16. POS.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.