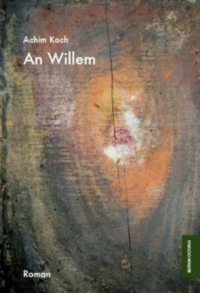Kitabı oku: «An Willem», sayfa 6
„Ihr lasst das Netz ganz langsam auf den Grund gleiten und wartet einige Minuten“, führte Boye aus. „Genauso langsam zieht Ihr es wieder herauf. Am besten ist es natürlich, wenn das Tau, an dem das Netzkreuz hängt, über eine Winde läuft. So könnt Ihr es gleichmäßig hochziehen.“
„Die Zukunft gehört dem Dampf“, brüllte Pedersen zu Lorenz und Sieke hinüber und fügte unter bedrohlichem Kopfschütteln seiner Tochter hinzu: „Das habe ich schon damals gesagt. Hier, in diesem Garten, habe ich das gesagt. Und es hat gestimmt.“
Nun wandte er sich direkt an den abwesenden Boye, ohne den strengen Blick seiner Tochter Sieke zu bemerken: „Du hättest nicht aufgeben dürfen, mein Junge. Ich habe gehört, es wird bei uns bald ein Dampfschiff geben. Und vielleicht gäbe es diese Eisenbahn auch schon in unserer Stadt, wenn du durchgehalten hättest.“
Pedersen wartete einen Augenblick still auf eine Antwort von Boye, bis er einsehen musste, dass er das, was ohne sein Wissen ein Gespräch seines Schwiegersohns war, nicht unterbrochen hatte.
Mit seinen schwarzen Augen schilderte Boye den Jungen, wie viele Aale sich in manchen Nächten beim Licht einer kleinen Lampe in der Reuse verfangen würden.
„Friedrich List“, fügte Anders dann in aller Ruhe hinzu, „möchte ein Eisenbahnnetz im gesamten Deutschen Bund errichten lassen. Und da jetzt die Zollgrenzen fallen, scheint er mir diesem Ziel deutlich näher gekommen zu sein.“
„Aber sicher ist er das“, antwortete Pedersen. „Er ist ein Mann mit Visionen. Ein Mann mit Visionen. Es wird sein wie in England. Es wird auf der ganzen Welt so sein. Auch bei uns. Es wird ein dichtes Netz dieser Eisenwege geben, und der Dampf wird alles bewegen.“
Bei dem Wort „Visionen“ hatte Boye seine Ausführungen gerade beendet. Er stand auf, verließ still den Garten und nahm auch nicht an den Gesängen teil, die Marin anstimmte. Bootsmann begleitete Boye.
Lorenz trennte sich am nächsten Morgen wieder von seiner Familie. Er fuhr nach Leipzig.
Anders blieb den gesamten Sommer. Er hielt sich fast ausschließlich in der Bibliothek seines Großvaters auf. Dort hatte er das neu erschienene Buch Friedrich Lists Das nationale System der politischen Ökonomie entdeckt und in wenigen Tagen durchgelesen. Dieser Sommer veränderte Anders mehr als das gesamte bisherige Studium. Der Großvater nahm keinen Einfluss auf ihn, empfahl ihm keine Literatur, sprach ihn nicht auf das Gelesene an, sondern bemerkte nur unauffällig, welches Buch sich der Enkel gerade genommen hatte, um sich vor ein offenes Fenster zu setzen und beim Geruch des gemähten Heus und dem leisen Rauschen des Windes in den dichten Erlen in ein neues Denken einzutauchen. Er las Bücher wie Ueber nordische Dichtkunst , Über Volkstümlichkeit und Staatsrecht des Herzogthums Schleswig nebst Blicken auf den ganzen dänischen Staa t sowie Altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen aber auch Lornsens Flugschrift Über das Verfassungswerk in Schleswigholstein und weitere Schriften.
An den Abenden erzählte er nur Sieke und seiner erst 13-jährigen Schwester Marin von seinen Gedanken. Das Mädchen schien alles, was ihr ältester Bruder sagte, in sich aufzusaugen, während Sieke dem ein wenig skeptisch gegenüberstand. Die Gedanken des Studenten sponnen sich in diesen Wochen langsam zu einem System zusammen, und in der Küche, wenn Boye, Gesche und Willem schon lange schliefen, erklärte er Marin, warum diese Stadt, in der sie lebten, so wichtig für die Zukunft aller Dänen und Deutschen sei, weil sie zwischen Schleswig und Holstein an einem Scheidepunkt läge.
„Und eines“, führte er dann in einem langen Monolog aus, „will wohl immer noch niemand verstehen: Dänen und Deutsche - wir brauchen uns, denn wir sind aus einer Wurzel. Es gibt nicht diesen Unterschied. Es gibt ihn nur ein wenig in der Sprache. Das ist der einzige Unterschied in unserer Kultur. Ansonsten sind wir aus Einem und gehören zusammen. Mit den Niederlanden gehören wir in einen großen germanischen Bund und werden zu einer großen germanischen Nation werden.“
Am Ende dieses Sommers verabschiedete sich Anders von seinem Großvater in dessen Bibliothek und dankte ihm dafür, dass er die Möglichkeit bekommen hatte, so viele und interessante Bücher lesen zu können.
„Mir schien es, als wärst Du besonders begeistert von Friedrich List gewesen“, eröffnete der alte Mann das Gespräch über das Gelesene.
„Ein Freund hat mir einen Artikel von ihm geschickt, in dem List nachweist, dass die Deutschen Dänemark wegen seiner großen Flotte zur Verteidigung des deutschen Handels brauchen und dass die Dänen wiederum in einen deutschen Zollverein eintreten sollten.“
„Vielleicht“, antwortete Anders, „sind es die ökonomischen Zwänge, die uns zusammenführen werden. Es wird endgültig zusammenkommen, was zusammengehört.“
Dem hatte Pedersen nichts mehr hinzuzufügen. Dennoch bemerkte Anders, dass sein Großvater noch etwas auf dem Herzen hatte, und fragte geradeheraus, was es denn sei.
„Wann wirst Du wiederkommen?“, fragte der alte Mann.
Anders erkannte mit einem Mal, dass neben allen Themen, die er mit seinem Großvater besprochen hatte, niemals ein persönliches Gespräch geführt worden war. Sie waren gute Bekannte, vielleicht Freunde geworden, die die gleichen Interessen hatten und auf einer gleichen Ebenen miteinander sprechen konnten.
Doch dieser alte Mann, dachte Anders mit einem Mal, ist auch mein Großvater, ein Mann, der jetzt 80 Jahre alt ist und vielleicht nicht mehr lange zu leben hat. Ein Abschied jetzt konnte ein Abschied für immer sein.
Anders schossen die Tränen in die Augen, und er blickte aus dem Fenster, um es seinen Großvater nicht merken zu lassen.
„Wahrscheinlich kann ich erst nach dem Examen aus Göttingen zurück sein“, antwortete er leise. „Im nächsten Winter.“
Doch Pedersen freute sich laut über diese Nachricht und wies überraschend darauf hin, dass ein Brief von Bendix angekommen sei, in dem er eine erneute Rückkehr auch für den nächsten Winter angekündigt hatte.
„Dann sind seine fünf Jahre rum, und wir werden alle wieder zusammen sein und auch Lorenz eine Nachricht zukommen lassen. Denn dann geht Ihr wieder raus zur CAROLINE. Es wird höchste Zeit, dass wir sie aus dem verdammten Mahlsand rausholen. Willem nehmt Ihr auch mit. Und meinetwegen auch seinen Freund, den Smid. Die sind ohnehin unzertrennlich.“
Beim Frederiks-Treffen in der Hölle waren in der Zwischenzeit einige wesentliche Entscheidungen gefallen. Ein junger Handwerker aus Svendborg, Gustav Simonsson, war in den Kreis aufgenommen worden, weil er dadurch aufgefallen war, dass er ausschließlich Dänisch sprach - ob er nun verstanden wurde oder nicht. Diese konsequente Haltung hatte großen Respekt bei Jaspersen, aber auch beim alten Postmeister geweckt.
Simonsson, der erst seit Kurzem in einer kleinen Schmiede unweit der Stadt arbeitete, war eigentlich in Island aufgewachsen. Jaspersen hatte noch niemals jemanden kennengelernt, der von dieser fernen Insel kam.
„Island“, sagte er verträumt, „die Welt der nordischen Sagen und Helden. Dort“, wandte er sich an Simonsson, „lebt die nordische Geschichte in jedem Stein.“
Simonsson sah das etwas nüchterner. Er war in Eyyarbakki, einem kleinen, etwas trostlosen Handelsort an der Südküste, geboren worden. Sein Vater, Simon Thoms, eigentlich aus Jütland, war an diesem Handelsposten beschäftigt gewesen, hatte eine Isländerin geheiratet und über die Jahre viele Sitten angenommen. So wurde sein Sohn Gustav nach ihm selbst benannt. Und alle nachfolgenden Töchter hießen nach seiner Frau Gislar, Gislardottir.
Simonsson war Jaspersen auch aufgefallen, weil er sich von ihm alles Schriftliche auslieh, was aktuell gedruckt und dem Apotheker zugeschickt wurde.
„Wir brauchen junge Leute wie Sie in unserer Runde“, hatte Jaspersen ihm erläutert, „denn ehrlich gesagt ist es so, dass die anderen nicht nur das Neue nicht lesen. Sie bilden sich überhaupt nicht weiter. Doch darin besteht ja gerade der Sinn unseres Treffens. Wie können wir Grundtvigs Ideen umsetzen, wenn unser Kreis aus ungebildeten Leuten besteht? Und ganz bewusst schließe ich an vorderster Stelle Pastor Klaasen damit ein.“
So kam ein einfacher Handwerksgeselle schon nach wenigen Monaten zu der Ehre, mit den angesehensten Bürgern der Stadt ein Treffen zu veranstalten und dabei schon zu Beginn an einer außerordentlich wichtigen Entscheidung beteiligt zu sein, nämlich ob das Treffen in Zukunft weiterhin Frederiks-Treffen oder Christians-Treffen heißen sollte.
Schon 1839 war König Friedrich VI. gestorben, und sein Vetter Christian VIII. hatte den Thron bestiegen.
Während die Fraktion um den alten Postmeister unter Hurra-Rufen Pastor Klaasens die Meinung vertrat, neben dem erpresserischen Einfluss des Deutschen Bundes sei es auch die besondere Schwäche des verstorbenen Königs gewesen, dass es nun Ständeversammlungen und sogar eine sogenannte schleswig-holsteinische Regierung gäbe, wies die Gruppe um Jaspersen darauf hin, dass nicht Schwäche, sondern Einsicht und Weisheit Frederik zu diesen Entscheidungen geführt hätten.
„Man muss sich an den modernen Entwicklungen orientieren“, betonte Jaspersen. „Die Geschichte hat ihren Lauf, und es ist falsch, sich gegen alles und jeden zu stellen.“
Dieser Redebeitrag endete in einem aufruhrähnlichen Rufen und unbändigen Gebrüll aller Beteiligten, wobei niemand mehr den anderen verstand und sich zeitweilig alle gegen den verdutzten Klaasen wandten, der dies überhaupt nicht begriff, weil er doch gar keinen und auch keinen weiterführenden oder parteiergreifenden Redebeitrag geliefert hatte und weil ihn doch ohnehin niemand verstanden hätte, wenn er eine wohin auch immer abweichende Meinung geäußert hätte.
Schließlich übertönte Gustav Simonsson erfolgreich das Durcheinander, indem er in die wild gestikulierende Gruppe schrie: „Ist Dänemark ein Admiralitätsstaat?“
Sofort trat Ruhe ein. Man suchte sich wieder seinen Platz und sein Glas, und aus dem allertiefsten Punkt des Schweigens hörte man unerwartet Pastor Klaasen sprechen: „Aber selbstverständlich.“
Das brachte sofort Jaspersen auf den Plan, der nun ziemlich salopp fragte, warum denn das nach Meinung des Pastors selbstverständlich sei. Klaasen, der wie alle außer Simonsson immer noch nicht die besondere Gemeinheit dieser Frage bemerkte, stellte nun ausführlich dar, dass Dänemark im Gegensatz zu vielen anderen Staaten über eine nun wieder aufgebaute Flotte verfüge und damit auch über außerordentlich viele Admiräle, die wegen der politischen und militärischen Bedeutung der Flotte auch eine ganz besondere Bedeutung im dänischen Staat hätten.
„Da sehen Sie's“, wandte sich Jaspersen nun vor allen an Simonsson. „Wie sollen wir mit diesem Defizit an Bildung, mit dieser selbstgefälligen Ignoranz auch nur im Ansatz“, und nun erhob sich die Stimme des Apothekers zu einem pfeifenden, schrillen Ton, „eine Volkshochschule im Sinne Grundtvigs aufbauen?“
In einer kleinen Pause, in der sich alle außer Simonsson und Jaspersen fragten, um was es hier eigentlich ging und was wohl als Nächstes geschehen würde, ging der Apotheker vor seinen Gästen Kräfte sammelnd auf und ab, um dann mit einem kleinen Vortrag anzuheben:
„Es gibt da einige Herren südlich unserer Grenzen, die mit der Theorie einkaufen gehen, Dänemark sei wegen seiner Flotte ein idealer Partner eines germanischen Großreichs. Wie ein Magnet, meinen diese Herren, würde unser Land von diesen 40 Millionen Großgermanen angezogen werden. Die Flotte, die diesen Großgermanen ja fehlt und die unser Land unter unserem König Frederik unter großen Entbehrungen nach der Zerstörung durch die Engländer wiederaufgebaut hat, diese Flotte, meinen diese Herren nun, sei es, was sie brauchen. Deshalb nennen sie unseren Staat abfällig einen Admiralitätsstaat. Und sie meinen zusätzlich, wir müssten uns schnell für sie entscheiden, sonst würden sie uns nämlich bald an den Rand des Abgrunds bringen. Doch wir dürfen uns wohl noch frei entscheiden, mit wem wir gehen, meine Herren.
Wir gehen mit Christian wie zuvor mit Frederik, der uns vor diesen Leuten beschützt hat. Und so zollen wir Friedrich die Ehre, unser Treffen weiterhin nach ihm zu benennen.“
Alle standen feierlich auf, prosteten sich zu und sagten zueinander: „Auf König Frederik und König Christian!“
Damit war eine wesentliche Entscheidung unter Mithilfe des neuen Mitglieds Gustav Simonsson gefällt worden.
Einige Wochen später stand Jaspersen in der Tür zur Schlosserei. Bootsmann, der nun meist in der Werkstatt war und dicht am Feuer lag, sah kurz auf. Auch Boye blickte von der Arbeit auf und warf dem Apotheker einen Guten-Tag hin. Jaspersen wusste zwar, dass der Schlosser sehr wortkarg geworden war, konnte sich aber nicht erklären, warum er überhaupt nicht sprach. Schließlich überging er diese Peinlichkeit und bemühte sich um ein Gespräch, bei dem Boye möglichst nicht antworten musste: „Ach, ich seh schon, mein guter Deletre, dass Sie wirklich viel Arbeit haben.“
Boye sah ihn an und antwortete, er sei froh, wenn er genügend Aufträge bekäme.
„Das letzte Feuer hat ja auch viel in meinem Laboratorium zerstört. Hier also entstehen die Apparaturen und Halterungen, die Sie mir bauen. Ah, und dies soll sicherlich die Kippvorrichtung werden, über die ich schon mit Ihrer Frau gesprochen habe.“
Jaspersen hielt ein Eisengestänge in der Hand, und Boye machte ihm deutlich, dass die Vorrichtung schon am Abend fertig sein könne, wenn der Apotheker sie wirklich so schnell brauche.
„Wäre es unverschämt, Herr Deletre, wenn ich die Kippvorrichtung schon heute Abend bekommen würde? Ich meine, das ist nicht so abgesprochen mit Ihrer Frau. Aber es würde mich doch außerordentlich freuen. ... Sie sollten sich einen Gesellen nehmen, solange Ihr Sohn in der Fremde arbeitet, Deletre.“
Boye stand vor seinem Feuer, in das er gerade ein Scharnier hielt und sah sich fragend zu dem Apotheker um.
„Na ja, ich meine nur, das wäre auch gut für Sie und Ihre Familie.“
Der Schlosser begann Jaspersen zu erklären, dass er zurzeit ganz gut zurechtkäme.
„Und sehen Sie, da habe ich gerade zufällig einen guten Mann an der Hand. Soll er sich denn mal bei Ihnen vorstellen?“
Nochmals wollte Boye erklären, dass er gut zurechtkäme, als Jaspersen aber das Thema wechselte: „Sagen Sie, Deletre, Ihre Tochter, könnten Sie nicht einmal mit ihr sprechen, dass sie mir noch das eine oder andere Bild überlässt?“
Boye musste an dieser Stelle ganz offen darauf hinweisen, dass er die Malerei seiner Tochter für großen Unsinn hielt.
„Sie sind doch in ihrem Fach auch schon fast ein Künstler, Deletre. Sie werden doch am besten verstehen, was sie uns mit ihren Bildern sagen will. Ich verlass´ mich da ganz auf Sie. Zwei, drei Bilder. Ich zahle ja auch dafür.“
Als Boye sich wieder seinem Feuer zuwandte, verließ der Apotheker die Werkstatt fröhlich und wunderte sich nur ein wenig, dass der griesgrämige Handwerker nicht einmal den Abschiedsgruß erwidert hatte.
Aber der war ihm ja schon immer etwas suspekt gewesen. Eigentlich sei aber die gesamte Familie etwas eigenartig. Und dabei müsse man diesen Pedersen miteinschließen. Völlig undurchschaubar sei dieser Mann. Oder würde er zu Recht auch von höchsten Kreisen so verehrt? Gut, man kenne sich kaum. Und diese eine Möglichkeit damals. Da gab es dann die Unterbrechung durch diese eigenartige Krebssache. War schon sehr außergewöhnlich damals. Heute komme einem das schon fast wie ein Traum vor.
Na, und Anders Deletre? Den hat man ja auch kaum kennengelernt. Sollte mal mit ihm sprechen, wenn er wieder hier ist. Hab´ganz vergessen zu fragen, wann der mal wiederkommt. Studiert jetzt in Göttingen. Von dort hört man ja auch keine guten Sachen. War Dahlmann nicht in Göttingen? Klar. Ja, und die Brüder Grimm. Sind dort alle suspendiert worden. Recht so. Nur die kleine Gesche ist anders. Na ja, so weit man den Rest kennt. Eigenartige Bilder. Auch irgendwie eigenartig. Auch der Hund.
Noch am späten Abend brachte Sieke die Kippvorrichtung mit Willems Hilfe zur Apotheke. Auf dem Weg kamen ihnen stumm Leute entgegen, die in Richtung des Hafens eilten. Jaspersen stand in seiner Eingangstür, denn er wollte gerade das Haus verlassen.
„Es ist nett von Ihnen, Frau Deletre, dass Sie an solch einem unheimlichen Abend noch vorbeikommen“, flüsterte er etwas verkrampft, ohne Willem zu beachten. Erst jetzt bemerkten Sieke und Willem, dass mit diesem Winterabend etwas nicht stimmte. Der Mond stand voll und außergewöhnlich groß über der Stadt und erleuchtete bei wolkenlosem Himmel jeden Winkel, und alles warf lange, gut sichtbare Schatten. Zusätzlich war es aber absolut still, sodass der gerade gesprochene Satz Jaspersens wie aus weiter Ferne zu kommen schien.
Er nahm ihnen das eiserne Gestell ab und versuchte, es durch die offene Eingangstür zu manövrieren. Dabei stieß er gegen die Tür, und das Geräusch, das dadurch verursacht wurde, drang wie eine schmerzhafte Explosion durch die Straßen und wehte von den Häusern zurück.
Mit einem entschuldigenden Blick verschloss der Apotheker seine kunstvoll geschnitzte Eingangstür, wies flüsternd darauf hin, dass er gerade auf dem Wege zum Hafen sei und schlich davon.
Einen Augenblick warteten Sieke und Willem noch etwas verwirrt und begannen dann schweigend, ohne gemeinsame Absprache, ebenfalls den Weg zum Hafen, ohne zu wissen, warum.
Viele Menschen warteten dort schon, sahen ins Hafenbecken, sprachen aber kein Wort miteinander. Das Mondlicht spiegelte sich im Schlick, und mit einem Mal sahen es auch Sieke und Willem: Obwohl bei Vollmond eher eine Springtide zu erwarten war, gab es kein Wasser mehr und alle Schiffe und kleineren Boote lagen leicht gekippt auf dem Trockenen. Es knisterte leise im Schlick, und an höheren Stellen, wo das Wasser zuerst abgeflossen war, wurde die Oberfläche des Schlickes schon stumpfer. Dennoch war es kein schwarzer Schlick, sondern es sah durch das Mondlicht aus wie eine Schneelandschaft, obwohl jeder wusste, dass es in diesem Winter noch nicht geschneit hatte.
Die meisten Menschen waren am Hafenausgang zusammengekommen, sprachen sehr still miteinander und starrten über das breite Flussbett in die Flussmündung; doch auch hier sah es genauso aus. Der Fluss hatte kein Wasser mehr; weder führte er Wasser in die Mündung noch kam das Tidenwasser, obwohl schon seit geraumer Zeit hohe Flut sein musste. Sieke fand in dieser Nacht ihre gesamte Familie am Ausgang des Hafens, und sogar Bootsmann hatte die warme Schlosserwerkstatt verlassen und wartete auf seinem Holzstumpf stundenlang in der Kälte auf das Wasser, das jedoch ausblieb.
Schließlich lockerte sich die Stimmung ein wenig; man sprach lauter, und plötzlich übertönte ein Lotse alle anderen, indem er Jaspersen zurief: „Na, Herr Apotheker, nun sind Schleswig und Holstein wohl endgültig zusammengeführt. Man kommt wohl bald trockenen Fußes von einem zum anderen.“
„Ja“, rief ein anderer aus der Menge, „da steht den Deutschen ja auch nichts mehr im Weg, Schleswig und Holstein gemeinsam zu nehmen.“
Und noch jemand fügte hinzu: „Wieso nur Schleswig und Holstein. Jütland kommt auch noch dazu.“
In das allgemeine Lachen der Menge antwortete Jaspersen mit fester Stimme: „Und wenn alle unsere Soldaten von der Nord- bis an die Ostsee an diesem Fluss stehen müssten. Kein Deutscher wird uns Schleswig nehmen.“
Einige lachten noch oder machten weitere, leise Bemerkungen. Doch die Äußerung Jaspersens hatte sie ruhiger werden lassen.
In der Nacht wurden alle Schotten geschlossen, weil man ein nachfolgendes Hochwasser befürchtete. Aber auch am nächsten Morgen, der einen sonnigen, aber kalten Tag versprach, blieb das Wasser aus - sogar, als eine neue Flut hätte einsetzen müssen. Viele Bauern kamen an diesem Tag in die Stadt, um mit anderen den unbegreiflichen Zustand zu besprechen. Sie berichteten, dass auch die Gräben leergelaufen waren und zum Glück das Vieh nicht mehr draußen sei, weil es ja sonst überall hätte hinlaufen können.
Andere äußerten ihre Furcht vor drohendem Frischwassermangel, da stündlich der Wasserstand in den Brunnen merkbar sank. Lorenzen wurde durch die Stadt geschickt, um auszurufen, dass besondere Vorsicht mit offenem Feuer geboten sei und die örtliche Brandwehr mögliche Löscharbeiten wegen des Wassermangels nicht zusichern könne. Mit der Zeit vergaß der blöde Gemeindeausrufer den Zusammenhang seiner Sätze und reduzierte sich nur noch auf „Vorsicht mit Feuer!“. Doch auch dieser Hinweis war ausreichend, hatte sich der Rest dessen, was er noch am frühen Morgen ausgerufen hatte, ohnehin bei jedem eingeprägt.
Am Abend sollte eine neue Flut kommen. Die Menschenmenge am Hafen wuchs ständig an, als die Sonne in der Mündung zum Meer glutrot unterging. Noch während dieses Schauspiels, das alle leise betrachteten, folgte ihr der volle Mond nach Westen und ging kurz nach der Sonne an fast der gleichen Stelle am Horizont unter. Als nur noch ein kleiner Rest von ihm übrigblieb, wurde es sehr schnell dunkel, sodass die ersten aus der Menschenmenge losliefen, um ihre Laternen zu holen. Dann hörte man zunächst leise und schließlich immer lauter das Rauschen des Wassers und zunehmendes Knistern des Schlicks. Sowohl vom Meer wie auch aus dem Fluss heraus floss Wasser, das sich vor der Hafenausfahrt traf, langsam Strudel und feinen Schaum bildete, sich dann vereinigte und in den Hafen eindrang.
Nach einigen Minuten wurden die Menschen gesprächig und begannen herumzulaufen, denn man befürchtete, nun würde all das Wasser zusammenkommen, das zuvor ausgeblieben war. Deshalb wurden nochmals alle Schotten überprüft und Sand oder Erde zwischen die doppelten Bohlenreihen geworfen, so weit es noch nicht geschehen war. Seeleute und Fischer gingen auf ihre Schiffe, um nach dem Anheben der Schiffskörper Tau einzuholen und alles an Deck zu sichern. Aber eine besonders hohe Flut blieb in dieser klaren, windstillen Nacht aus, und nach den nächsten Tagen, in denen es immer kälter wurde und der Fluss den Kampf darum begann zuzufrieren, obwohl Ebbe und Flut die dichte Eisdecke immer wieder versuchten zu zerstören, wurden alle Maßnahmen gegen drohende Wassereinbrüche wieder abgebaut.
Erst im späten Winter setzte eine Sturmflut ein, die zwar keine besonders gefährliche Höhe erreichte, aber große, feste Eisschollen in den Hafen und bei stetem Ansteigen des Wassers bis an die Wände der um den Hafen stehenden Häuser drückte. Diese Eismassen kratzten das Gras von den Deichen, zerquetschten kleinere Boote, ließen die Holzbohlen der Schotten knirschen und zermalmten Poller und Zäune. Nach dem Ablaufen der Flut blieben die riesigen, zum Teil aufeinander geschobenen Schollen in den Vorgärten und auf der Hafenstraße liegen, wo sie erst mit dem Einsetzen des Frühlings endgültig tauten und nur noch kleine Dreckhaufen hinterließen, die noch den gesamten Sommer hinweg zu sehen waren, weil sie auf dem Boden zu kleben schienen.
Gesche schenkte ihrem Vater in diesem Sommer ein Bild, das Aus dem Feuer hieß und angeblich etwas mit dem Ereignis um das fehlende Wasser im Winter zu tun hatte. Da sie mittlerweile im Haushalt einer Kaufmannsfamilie arbeitete, hatte sie erst nach langer Zeit das Bild beendet, an dem nicht nur bemerkenswert war, dass niemand den Namen mit dem fehlenden Wasser in Verbindung bringen konnte. Es war auch das größte Bild, das Gesche bis dahin gemalt hatte, denn es passte gerade noch durch die Schlossertür, hatte eine Leinwand, war auf einem von Willem gebauten Holzrahmen aufgespannt. Und es war in seiner Größe fast ausschließlich safrangelb, was jedoch weder mit Wasser noch eindeutig mit Feuer in Verbindung zu bringen war. Aus der gelben Grundfarbe kamen perspektivisch gemalte Würfel hervor, die sich in einer rotierenden Bewegung zu befinden schienen, sodass man schon fast glauben konnte, sie würden einem gleich um den Kopf fliegen.
Als Gesche und Willem das Bild in die Werkstatt brachten, hielt Boye einmal wieder ein rotglühendes Eisenstück in einer Zange. Er fragte Willem, warum sie denn nun diese gelbe Wand hineinbringen würden, und Willem erklärte seinem Vater, dass dies ein Geschenk von Gesche sei, ein Bild, das sie selbst gemalt habe und in das das gesamte Geld gegangen sei, das sie von Jaspersen für ein verkauftes Bild bekommen habe. Das rührte Boye, und Willem wusste schon sehr genau, warum er diese Erklärung gewählt hatte.
Boye trat an seine Tochter heran und versuchte ein letztes Gespräch: „Ich weiß, dass Du mit mir über Dein Bild sprechen willst. Aber ich verstehe es nicht. Ich will aber darüber nachdenken, denn ...“
Doch schnell wandte sich Gesche von ihm ab und verließ den Raum.
„Ich verstehe sie nicht“, deutete Boye zu Willem.
„Sie uns auch nicht“, antwortete der Sohn.
Beide nahmen das große Bild und hängten es so in der Schlosserei auf, dass der Vater es immer sehen konnte, wenn er an seinem Feuer stand. Den gesamten Sommer und Herbst hindurch grübelte Boye über das Bild nach, ohne zu einem Ergebnis zu kommen.
Gesche hingegen machte sich Gedanken über eine Begegnung, die sie eines Tages im Hause ihrer Eltern mit einem jungen Schlosser hatte, der Gustav Simonsson hieß und vorbeigeschickt worden war, um nach Arbeit zu fragen, dann aber von Sieke statt von Boye erfahren musste, man könne sich keinen Gesellen leisten. Dieser junge Mann, der ausschließlich Dänisch sprach, schlich sich immer wieder in Gesches Kopf und ihren Körper hinein, obwohl sie sich schwor, es nicht zuzulassen.
Gesche und Marin sprachen zwar nicht darüber, aber auch Marin hatte ein ähnliches Problem mit Kopf und Körper. Alles hatte damit begonnen, dass sie eines Tages auf der Straße einem der beiden in der Stadt tätigen Doktoren der Medizin, Dr. Helmer, begegnet war, den sie schon seit vielen Jahren flüchtig kannte. Helmer war mehr als doppelt so alt wie Marin, ein schon weißhaariger, dünner Mann, der einen weißen, spitzen Bart trug, eine spitze Nase hatte und aus Augen heraus sah, die so grün waren, wie Marin sie noch nie zuvor gesehen hatte. Er hatte eine wunderbare, weiche, aber starke Stimme, und Marin hatte gehört, dass er nicht nur einen eindrucksvollen Tenor habe, sondern auch über die besondere Begabung verfüge, fast jedes Musikinstrument spielen zu können.
So sah sie nicht fort, als dieser Mann ihr entgegenkam, sondern suchte seine Augen. Helmer blieb daraufhin stehen, sprach Marin an und fragte, ob es denn stimme, dass sie, wie er schon mehrfach gehört habe, so gern und so schön singen würde.
Schließlich lud er sie ein, doch einmal einen Besuch bei der örtlichen Liedertafel zu machen, die von ihm geleitet wurde. Sehr umständlich fügte er dann hinzu, dass dies natürlich der Erlaubnis der Eltern bedürfe und ansonsten ja ohnehin nur Männer in diesem Kreis anzutreffen seien. Aber, es sei doch eine große Bereicherung, wenn einmal eine Frauenstimme dabei wäre, fuhr er dann fort, um dann sehr unvermittelt zu sagen: „Und wir singen deutsches Liedgut.“
Einige Abende später ging Marin zur Liedertafel. Sieke begleitete sie, weil auch sie gern sang und weil es unschicklich für Marin gewesen wäre, allein zu gehen. Die Liedertafel traf sich regelmäßig im Nebenzimmer eines kleinen Gartenlokals, begann den Abend mit dem Lied Ein feste Burg ist unser Gott und wurde von Dr. Helmer, dessen Tenor aus den dreißig Männerstimmen herausscholl, dirigiert.
Danach wurde ein Lied gesungen, das offensichtlich viele in diesem Kreis noch nicht kannten. Es hieß Der deutsche Rhein , und die letzte Strophe, die besonders beeindruckte, lautete:
„Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein,
Solang dort kühne Knaben um schlanke Dirnen frein ...“
Statt „Feierlich“ oder „Gehalten“ stand über dem Lied, es solle „Begeistert“ gesungen werden. Ein junger Handwerker, der auffällig feierlich gesungen hatte, fragte in die Runde, was der Zusammenhang zwischen dem Rhein und kühnen Knaben oder schlanken Dirnen sei. Es waren Fragen, die sehr viele in dieser Runde hatten, und an diesem Abend schien die Geduld des Arztes besonders gefordert zu sein. Er führte schließlich aus, dass es darauf ankäme, zunächst einmal den gesamten Inhalt des Liedes zu verstehen, und dies könne nur geschehen, indem man das Lied aus seiner Zeit heraus, in der es entstanden sei, sehe. Es sei entstanden, als die Franzosen ihre Grenze gern weiter in den Westen verlegt hätten, nämlich an den Rhein. Dadurch sei einigen deutschen Ländern großer Schaden zugefügt worden. Der Rhein solle frei von einer Grenze sein, und das Lied sage aus, das man ihn daher bis auf den letzten Mann verteidigt habe. Deshalb sei auch die Aussage „des letzten Manns Gebein“ enthalten.
Diese Ausführungen boten sehr viel Gesprächsstoff, und besonders erboste man sich über die Franzosen und äußerte die Meinung, man könne doch nicht willkürlich eine Grenze verändern. Schließlich unterbrach Dr. Helmer diese Gespräche, die zunehmend unergiebiger wurden, und hielt einen kleinen Vortrag, in dem er sich für die vielen Aktivitäten bedankte, die von den Mitgliedern der Liedertafel entwickelt worden wären, um das für den Sommer geplante, große Sängerfest feiern zu können.
„Wir werden“, fuhr er für Marin unverständlich fort, „ein kleines Zeichen für das deutsche Lied setzen, das hier in Schleswig um sein Da-sein ringen muss.“
Anschließend wurden Noten und Texte für ein neues Lied verteilt, das sich mit dem „deutschen Vaterland“ beschäftigte. Als sich die Liedertafel aufgelöst hatte, wartete Marin mit ihrer Mutter Dr. Helmer an der Ausgangstür ab, um sich zu erkundigen, was er gemeint hatte, als er davon sprach, das deutsche Lied müsse um sein Da-sein ringen.
Helmer fragte sehr erstaunt, ob man denn nichts von Skamlingsbanken gehört habe und erklärte in schlichten Worten, es habe ein großes Volksfest Dänischgesinnter in Skamlingsbanken bei Kolding gegeben. Man hatte damit einen Abgeordneten ehren wollen, der in der Schleswiger Ständeversammlung nicht nur aufgerufen hatte, dort nur noch Dänisch und nicht Deutsch zu sprechen, sondern dies auch konsequent tat.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.