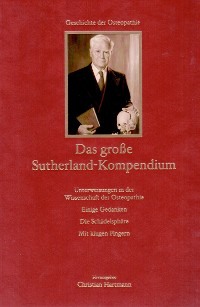Kitabı oku: «Das große Sutherland-Kompendium», sayfa 10
ÜBERLEGUNGEN ZUR BEHANDLUNG
Behandlung des Os palatinum
Die Kunst, diese Behandlungsmethode beim Ganglion sphenopalatinum anzuwenden, entspricht der Kunstfertigkeit eines Uhrmachers, der eine kleine Damenuhr zu reparieren hat, im Vergleich zu den Fähigkeiten eines Mechanikers, der Autos repariert.
Es handelt sich um ein kleines Ding, das mit Fingerspitzengefühl behandelt werden muss, nicht mit einer entschiedenen Manipulation. In der Kunst Ihres Wissens um den Mechanismus benutzen Sie einen so leichten, sanften Kontakt, wie Sie ihn beobachten können, wenn ein Vogel auf einem Zweig landet, ohne die Rinde zu verletzen.
Dann erlauben Sie den Kräften der Natur, eine Korrektur durchzuführen. Verstehen Sie? Wie viele aus der Profession der Osteopathen sind sich dessen wirklich bewusst?
Warum habe ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Divergenz jener kleinen Furchen gelenkt, die mit den Enden der Procc. pterygoidei artikulieren und die gleichermaßen nach hinten divergieren und nach vorne konvergieren? Als Uhrmacher müssen Sie dieses mechanische Prinzip berücksichtigen.
Wenn Sie die Spur nehmen, in der ein Lastwagen fährt und diese Spur ist am Ende schief, hätten Sie Schwierigkeiten, durch diese Spur zu kommen. Das ist das Prinzip. Betrachten Sie die mechanische Situation, wenn diese Furche entweder in Außen- oder Innenrotation gedreht wird. Sie sehen die Störung im Bewegungsablauf der Procc. pterygoidei oder der Lastwagenräder, die in der Spur laufen sollen.
Als Nächstes müssen Sie verstehen, wie man das besagte Os palatinum in die richtige Richtung drehen kann, sodass es mit den Procc. pterygoidei übereinstimmt. Rufen Sie sich in Erinnerung, dass sie posterior divergieren. Demnach müssen Sie sich bemühen, den hinteren Rand des Os palatinum lateral zu drehen, um es an die Divergenz der Procc. pterygoidei anzupassen. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Wenn Sie das Os palatinum medial drehen, induzieren Sie es in die falsche Richtung. Sie könnten die Bewegung des Proc. pterygoideus in der Furche blockieren und somit die Bewegung des Os sphenoidale.
Ich möchte, dass Sie die Kunst, die osteopathische Kunst, anwenden, um das Problem des kleinen Os palatinum in seiner Beziehung zum Proc. pterygoideus des Os sphenoidale zu lösen. Ich möchte, dass Sie nachdenken und so lange üben, bis Sie die Kunst beherrschen, die mechanischen Probleme der Ossa palatina zu lösen. Es wird Ihnen viel Arbeit ersparen und Ihren Patienten nutzen. Als Erstes werden Sie bemerken, dass Patienten von nah und fern kommen.
Ich möchte Ihnen nun ein paar Anleitungen für die meines Erachtens korrekte Behandlungsmethode zur Behebung einer Fehlstellung des Os palatinum geben:
1. Als Erstes nehmen Sie einen Schädel und betrachten die Unterseite, um sich die Verbindung des Os palatinum mit der Maxilla und mit den Enden des Proc. pterygoideus des Os sphenoidale vor Augen zu führen (Zeichnung I–11).
2. Zweitens untersuchen Sie das Os palatinum von allen Seiten, vor allem die schmale Kurve auf der hinteren Oberfläche der waagerechten Platte. Unsichtbar dahinter verlaufen jene doppelten Furchen, die posterior in seitlicher Richtung divergieren. Diese Richtung entspricht dem Verlauf der Procc. pterygoidei.
3. Drittens benötigen Sie eine sanfte Behandlungsmethode, die es ermöglicht, das Os palatinum nach lateral zu drehen: nicht rückwärts, vorwärts oder aufwärts, sondern lateral. Das muss so sein, damit die Kufe und die Rille in der Furche aufeinanderpassen. Die Furche auf der Rückseite des Os palatinum passt genau zu den Enden der Procc. pterygoidei, die darin hin und her laufen, wie ein Schiffchen.
4. Wenn Sie das Os palatinum lateral drehen, drehen Sie es in die gleiche Richtung, in welcher der Proc. pterygoideus hängt. Das Os sphenoidale ist ein einziger Knochen. Beim Os palatinum haben wir jedoch zwei Knochen, einen auf jeder Seite.
So drehen Sie die Rille, nicht den Proc. pterygoideus, um eine glatte gelenkige Beweglichkeit zu haben. Wie werden Sie das tun?
Wenn Sie sich die Unterseite des Schädels an der Rückseite der Choanen anschauen, sehen Sie etwas herunterhängen. Das ist der Hamulus an der Lamina medialis des Proc. pterygoideus. Seien Sie vorsichtig.
Gehen Sie dort nicht hinein. Es gab einen Vorfall, bei dem jemand ihn abbrach. Er ist jedoch ein Hinweis. Sie brauchen nun nicht in den Mund zu sehen. Wenn Sie auf der Seite des Patienten stehen, an der Sie gerade arbeiten, nehmen Sie Ihren Zeigefinger und führen Sie ihn auf der Kaufläche der oberen Zähne so weit entlang, bis Ihr Finger auf den Hamulus trifft, den Führer, der Ihnen zeigt, dass Sie weit genug gegangen sind.
Den Patienten macht es im Allgemeinen nichts aus, wenn Sie sie an der Kaufläche der Zähne berühren. Alles, was Sie als Nächstes tun müssen, ist, Ihren Finger auf dem Fulkrum der Zähne zu drehen und die Fingerspitze an die hintere Begrenzung der Lamina horizontalis des Os palatinum, an die Kurve, sinken zu lassen. Dies ist ein praktischer Kontakt für Ihre Fingerspitze.

ZEICHNUNG I–11: ANSICHT DES SCHÄDELS MIT DER SUTURA PALATOMAXILLARIS
Beachten Sie die Lage des Hamulus auf der Lamina pterygoidea medialis.
Der weiche Gaumen beginnt an dieser Kurve. Wenn Ihr Finger dort hingesunken ist, haben Sie das Weichgewebe etwas zusammengefaltet, sodass Sie etwas oberhalb des Bogens sind. Jetzt drehen Sie Ihren Finger herum, indem Sie das Fulkrum benutzen, um den Bogen zu erreichen. Nun müssen Sie lediglich Ihren Finger so drehen, dass er das Os palatinum lateral dreht.
Wenn Sie Ihren Mechanismus verstehen, brauchen Sie nicht in den Mund zu sehen, denn Sie wissen genau, wo Sie sich befinden und was Sie zu tun beabsichtigen. Während Sie Ihren Zeigefinger auf den Zähnen entlangführen, bleibt der proximale Anteil Ihres Fingers auf den Zähnen, um als Fulkrum zu dienen. Besitzt der Patient keine Zähne mehr, können Sie den Finger auch auf dem Zahnfleisch entlangführen.
Benutzen Sie das Fulkrum, das durch Ihren auf den Zähnen balancierten Zeigefinger entsteht. Sobald Sie Ihren Finger auf dem Fulkrum drehen, lassen Sie ihn über diesen Bogen auf den hinteren Rand des Gaumens sinken.
Sie können den Bogen fühlen. Ebenso können Sie den Strain in den Nebenhöhlen fühlen und auch die Veränderung, die durch diese Art von Strain entstanden ist. Alles, was Sie nun tun müssen, ist, Ihren Finger drehen.
Schieben Sie nichts, manipulieren Sie nichts – das ist nicht die Wissenschaft. Drehen Sie Ihren Finger nur ganz und Sie werden wissen, wann sich der Knochen lateral dreht.
Sie werden auch wissen, wann und ob Sie Ihren Finger in die falsche Richtung gedreht haben. Sie sind erfahrene Behandler in dieser Kunst und Sie werden wissen, wie Sie diesen Knochen durch die Drehung Ihres Fingers seitlich drehen können. Es spielt keine Rolle, ob die Dysfunktion sich in Innen- oder Außenrotation zeigt; Sie müssen den Knochen lediglich lateral drehen, um ihn an die Divergenz nach posterior des Proc. pterygoideus anzupassen. Das ist der springende Punkt. Sie können dazu Atemkooperation oder die Tide zu Hilfe nehmen. Seien Sie einfach, sanft und schnell. Benutzen Sie die Ossa frontalia, um das Os sphenoidale mit Ihrer anderen Hand gleichzeitig in Flexion zu bringen.
Wenn Sie diese Vorgehensweise in der Praxis anwenden und herausfinden, welch eine Hilfe es bei Ihrer gesamten Behandlung darstellt, besitzen Sie eine zuverlässige Methode, um Probleme, in denen es um die Verbindungen der Ossa palatina geht, schnell zu beseitigen. Bei sämtlichen Dysfunktionen im Bereich des Schädels ändert sich der Faktor vordere Konvergenz und hintere Divergenz nicht. Das Os palatinum ist Torsionstraumen und Fehlstellungen ausgeliefert. Das versteckte Problem, dem abgeholfen werden muss, verlangt Wiederanpassung und Berichtigung. Wenn Sie die Alae majores mit einem Kontakt an den Ossa frontalia drehen, können Sie die Bewegung oder die fehlende Bewegung der Procc. pterygoidei in den Furchen auf der Rückseite der Ossa palatina spüren. Sie wissen es, wenn Sie die richtige Position haben.
Untersuchen und studieren Sie, ob die Ursache eines Problems am Os palatinum nicht ein Problem der Maxilla gewesen sein könnte. Dann beobachten Sie das Os zygomaticum in der Relation zur Maxilla.
Stellen Sie sich den Mechanismus zwischen Os zygomaticum und Maxilla, der den Sinus maxillaris lüftet, bildlich vor. Erinnern Sie sich daran, dass ein L-förmiger Bereich auf beiden Knochen die Gelenkfunktion darstellt. Ist Ihnen aufgefallen, wie viele L-förmige Bereiche an diesen zahlreichen Mechanismen beteiligt sind? Nicht nur im Gesicht, sondern auch an den Iliosakralgelenken.
DIE BEHANDLUNG DES VOMER
Wenn wir über die Pumpenfunktion des Os zygomaticum am Sinus maxillaris nachdenken, kommt uns die Beziehung des Vomer zum Sinus sphenoidalis in den Sinn. Das Vomer ähnelt von der Gestalt her einer Pflugschar.
Es ist dünn, besteht aber aus zwei Schichten, die sich aufspalten, um Alae zu bilden, die glatt über das Rostrum des Os sphenoidale passen. Diese Verbindung befindet sich unterhalb des Corpus sphenoidalis mit dem Sinus sphenoidalis. Dieser luftgefüllte Hohlraum braucht Bewegung zum Luftaustausch, andernfalls gibt es eine Stauung der Luft. Sie sehen, dass das Vomer eine weitere Pumpe auf der zentralen Linie der beiden Kammern im Corpus des Os sphenoidale ist, die Luft ansaugt und wieder hinausdrückt.
Betrachten Sie nun die nasenseitigen Conchae im lebenden Körper, wie sie sich während In- und Exhalation eindrehen und ausdrehen. Sie verstehen ihre Funktion des Luftaufwärmens und -anfeuchtens, bevor diese in die Lungen strömt. Sie denken an die mechanische Aktion der Ossa frontalia in ihrer Beziehung zum Os ethmoidale. Verstehen Sie, was hier während Inhalation und Exhalation passiert?
Denken Sie dann an die unterschiedlichen Beschwerden, mit denen Ihre Patienten zu Ihnen kommen. Zu diesen Beschwerden gehören Stauungen im der Nase angrenzenden sinoidalen System mit übermäßiger Sekretbildung, Entzündungen, Stasis und Polypen. Denken Sie an den physiologischen Einfluss des Os sphenoidale auf den gesamten Mechanismus des Gesichtes. Was bedeutet eine Fehlstellung des Os sphenoidale für die Physiologie des Gesichts? Sehen Sie sich das Septum nasi an und denken Sie über Abweichungen und Ausbuchtungen der Lamina perpendicularis des Os ethmoidale und des Vomer nach. Wenn die ‚Wagendeichsel‘ sich verbiegt, warum wechseln wir nicht den ‚Wagen‘ und betrachten, wie sich die ‚Deichsel‘ wieder auf ihre richtige Spur begibt?
Es gibt eine Behandlung der Ossa palatina und des Vomer, die ich die ‚Wagendeichsel‘ nenne. Dies lässt sich durch das Bild eines Wagens mit Rädern und einer Deichsel veranschaulichen. Wenn Sie ein hölzernes Pferd nehmen und unter die Deichsel stellen, entsteht ein Fulkrum. Dann setzen Sie sich auf das Ende der Deichsel und gehen die Räder des Wagens hinauf. Lassen Sie uns die Procc. pterygoidei die Räder nennen, das Vomer die Deichsel, und den Finger des Therapeuten das hölzerne Pferd oder das Fulkrum.
Legen Sie einen Finger im Bereich der Sutura cruciata an das Munddach. Bitten Sie den Patienten, seinen Kopf vorsichtig auf Ihren Finger sinken zu lassen. Wenn er dies tut, wirkt das Fulkrum so, dass die Procc. pterygoidei nach oben in ihre Extensionsposition angehoben werden (Zeichnung I–5). Sie können den Patienten beibringen, das bei sich selbst auszuführen. Sie können am Ende der ‚Wagendeichsel‘ auch hinaus- und am Dach des Mundes nach vorne entlanggehen und es sanft anheben, um eine Bewegung am anderen Ende auszulösen.
Während wir über diesen Bereich nachdenken, führen Sie sich noch etwas anderes vor Augen: Wenn das Os sphenoidale sich in Exhalation so bewegt, dass es die Anguli laterales der Ossa frontalia nach innen zieht, tritt die Sutura metopica nach vorne. Gleichzeitig verengen und verlängern sich die Orbitae. Dies verändert ihre Gestalt ähnlich charakteristisch, wie dies auch bei Kurzsichtigkeit der Fall ist. Die Incisura ethmoidalis ist in diesem Moment verengt, und die Lamina perpendicularis des Os ethmoidale hebt sich zusammen mit der Spina ethmoidalis des Os sphenoidale. Während also alles enger wird, was passiert nun mit den Conchae nasales? Was machen die Bulbi olfactorii? Was geschieht mit all den luftgefüllten Hohlräumen? Wenn Sie sich das alles vor Augen geführt haben, sehen Sie, was Sie Ihren Patienten zeigen können, was diese alles für sich selbst tun können. Sie werden überrascht sein, zu erfahren, wie diese einfachen Techniken Ihren Patienten nützen können.
8. ‚KRUMME ZWEIGE‘: KOMPRESSION DER KONDYLÄREN ANTEILE DES OS OCCIPITALE
Der Ausdruck ‚krumme Zweige‘ basiert auf Dr. Stills Ausspruch ‚das Loch im Baum‘.50 Ich nehme an, dass er mit jenem ‚Loch im Baum‘ das Foramen magnum meint und dass er sich darauf bezieht, dass das Os occipitale bei der Geburt aus vier Anteilen besteht – zwei Partes laterales oder condylares, Pars sqamosa und Procc. basilaris. Diese Teile sind um das Foramen angeordnet und tragen direkt zur Form des ‚Loches‘ bei. Zum Zeitpunkt der Geburt besteht das Os sphenoidale aus drei Teilen – dem Corpus und den beiden Einheiten, die jeweils aus einem Ala major und Proc. pterygoideus bestehen. Das Os temporale besteht bei der Geburt ebenfalls aus drei Teilen: dem Pars petrosa, dem Pars sqamosa und dem tympanischen Ring.
Wenn man darüber nachdenkt, ist der lebendige menschliche Kopf zum Zeitpunkt der Geburt schon eine bemerkenswerte Struktur. In diesem Alter kann man ihn leicht als ein weichschaliges Ei oder einen modifizierten Globus bezeichnen, wohingegen es später im Leben schwieriger ist, ihn sich so vorzustellen. Alle Knochenanteile werden durch die Dura mater, die ‚Mutter Dura‘, zusammengehalten, die wie eine Membrana interossea funktioniert. So hält der Kopf des Neugeborenen zusammen und passt sich gleichzeitig an, um eine sichere Passage durch den Geburtskanal möglich zu machen. Denken Sie darüber nach!
Das Gelenk zwischen den Kondylen des Os occipitale und den Facetten des Atlas ist das einzige Gelenk, das bereits bei der Geburt voll ausgebildet ist. Sonst gibt es keine Gelenkflächen, da es zum Zeitpunkt der Geburt noch keine Gelenke mit ‚Führungen‘ gibt.
In der Tat wachsen die unterschiedlichen Teile der einzelnen Knochen der Schädelbasis, bis die einzelnen Knochen verknöchert und ihre Teile miteinander verschmolzen sind. Als Teil des Wachstumsvorganges treffen die verschiedenen Knochen aufeinander, und so beginnen sich zwischen ihnen allmählich Gelenke und Gelenkflächen zu entwickeln. Gelenkführungen für die gelenkige Bewegung zwischen den Knochen des menschlichen Schädels, an den Suturen, werden um das siebte bis neunte Lebensjahr oder sogar noch später gebildet.
Diese Tatsachen erfordern eine Analyse der vorherrschenden Bedingungen im Skelettsystem und insbesondere im Kopfbereich während des Säuglingsalters und der frühen Kindheit. Der von der Dura mater geführte Mechanismus ähnelt dem Bild zweier Telefonmasten mit einem von Mast zu Mast gespannten Kabel. Bei einem Schneesturm werden die Kabel vom Schnee so beladen, dass die Masten aus der Senkrechte geneigt werden, aber miteinander verbunden bleiben, sodass sie im gleichen Winkel schief stehen.
Ich möchte, dass Sie dieses Bild auf den Kopf des Kleinkindes übertragen, wenn äußere Kräfte seine Gestalt beeinflussen. Denken Sie an irgendein Trauma, entweder aufgrund der Anpassung an den Geburtskanal oder aufgrund späterer Stürze. Stellen Sie sich einen Zug an der ‚Mutter Dura‘ vor, der die Knochen aus ihrer normalen Stellung und ihren normalen Beziehungen herauszieht. Man muss die Membranen benutzen, um diese kleinen Knochen wieder in ihre normale Position zu bringen. Die Membranen werden bei der Wiederherstellung der normalen Stellung wie die Kabel zwischen den Masten funktionieren.
Sogar nach einer normalen Geburt finden wir eine Situation vor, die beachtenswert ist. Der Kopf des Kindes hat sich während der Geburt an den Geburtskanal mechanisch angepasst. Wenn das Neugeborene schreit und unter Mithilfe des atmosphärischen Drucks einatmet, ist der Schrei normalerweise kräftig, ein besonderer Schrei, mit oder ohne Klaps auf das Sakrum. Dieser Vorgang bringt die Zerebrospinale Flüssigkeit in Bewegung. Im Anschluss daran machen sich die Membranen an die Arbeit und ziehen die Knochen in Position.
Die Merkmale der okzipitoatlantalen Gelenke sind bei diesem Vorgang wichtig. Die Facetten des Atlas sind konkav. Sie konvergieren anterior und divergieren nach hinten. Sie konvergieren ebenfalls inferior und divergieren superior. Das Lig. transversum des Atlas hält sie in dieser Position. Die kleinen Kondylen auf der unteren Oberfläche der kondylären Teile des Os occipitale sind konvex und passen in die Facetten des Atlas. Die Kondylen laufen ihrerseits anterior zusammen und posterior auseinander, inferior zusammen und superior auseinander. Denken Sie daran, dass die Gelenke zwischen den Kondylen des Os occipitale und den Facetten des Atlas in diesem Lebensabschnitt die einzigen am Kopf bestehenden Gelenke sind.
Oberflächlich betrachtet ähneln jene Gelenke bikondylären Gelenken, die zwei Gelenkaktivitäten haben, sich jedoch funktionell als Einheit verhalten. Die atlantookzipitalen Gelenke etwa sind paarig angelegt. Man betrachtet sie aber besser als ein einzelnes Eigelenk mit einem großen zentralen Defizit an seinen Gelenkflächen.51
Die konkaven Facetten des Atlas nehmen die Kondylen des Os occipitale auf. Die Gelenke reichen auf beiden Seiten vom vorderen Ende der kondylären Anteile bis zum Proc. basilaris des Os occipitale.
Die Squama occipitalis grenzt an die hinteren Enden der Partes condylares. Die okzipitoatlantalen Gelenke sind bandgestützte Gelenkmechanismen.
[Anm. d. am. Hrsg.:] Die folgenden Informationen wurden während des Kurses von Howard A. Lippincott D.O.52 präsentiert. Dr. Sutherland beschrieb diese Lektion so: Sie liefert Informationen, die für das Verständnis einiger Probleme notwendig sind, welche in diesem Mechanismus unter verschiedenen Umständen vorkommen.“
Dieses Zusammentreffen der vorderen Enden der Kondylen und des hinteren Endes des Proc. basilaris ist keine transversale Gelenkverbindung. Die Gelenkfläche auf dem Proc. basilaris orientiert sich nach lateral; diejenige des Pars condylaris zeigt nach medial.
In vielen Fällen befindet sich die Verbindungsstelle beinahe auf der Sagittalebene. Der Pars basilaris ist zum Zeitpunkt der Geburt ziemlich gut ausgebildet: Er ist bereits verknöchert, aber zwischen den drei Teilen befindet sich Knorpel. Wenn die Partes laterales zusammenkommen, zusammengedrückt aufgrund der Konvergenz der Facetten des Atlas, beginnen sich die Kondylen gegen den zwischen dem Proc. basilaris und den Partes condylares liegenden Knorpel hineinzudrücken. Sie neigen dazu, aufeinander zuzugleiten. Da das Lig. transversum den Facetten des Atlas nicht erlaubt, nachzugeben, ist ein bestimmter Grad von Kompression die Folge.
Asymmetrien des Foramen magnum erscheinen häufig als Verengung des vorderen Anteils. Manchmal ist die Verformung nur minimal; in anderen Fällen zeigen seine Umrisse jedoch Variationen mit beträchtlichen Asymmetrien. Diese werden direkt durch die Position beeinflusst, in welcher sich der Proc. basilaris befand, während er komprimiert wurde. Selten gibt es in diesem Bereich Fälle von Entwicklungsanomalien. Abgesehen davon gibt es kaum etwas, was eine Divergenz der Kondylen verursachen kann, wenn sie in die Konvergenz des Atlas hineingedrückt wurden.
Eine Kompression oder ein Abknicken kann auch am posterioren Ende der kondylären Teile, also an der condylosquamalen Verbindung auftreten. Die Squama occipitalis ist kreisförmig, mit dem Inion als Zentrum. Der zentrale Orientierungspunkt am hinteren Rand des Foramen magnum befindet sich am Ende eines Radius vom Inion. Er wird als Ophisthion bezeichnet. Die Squama kann sich im oder gegen den Uhrzeigersinn um das Inion herum drehen. Diese Bewegung positioniert das Ophisthion nach rechts oder nach links. Diese Information sollte Teil einer strukturellen Untersuchung sein.
Abhängig davon, wie sich das Squama gedreht hat, kann man den Druck auf das hintere Ende der Partes condylares analysieren. Es besteht ein anterior-posteriorer Druck auf einer und ein mediolateraler Druck auf der anderen Seite. Die condylosquamale Verbindung kann auch in Beziehung zu den kondylären Teilen abgeknickt sein. Mit anderen Worten: Der Winkel zwischen Squama und Partes condylares kann spitzer oder stumpfer sein als gewöhnlich.
Die verschiedenen Zustände, die sich durch die Beziehungen zwischen den vier Teilen des Os occipitale ergeben können, genügen, um die unterschiedlichen Formen des Foramen magnum zu erklären.
Wenn diese Asymmetrien während des Wachstums im Säuglings- und Kindesalter weiterbestehen, lassen sie das Prinzip ‚So wie der Zweig gebogen wird, krümmt sich der Baum‘ Wirklichkeit werden.
Deshalb ist es äußerst wichtig, ein Neugeborenes genau und sorgfältig zu untersuchen. Zu jenem Zeitpunkt ist es einfach, die bereits handelnden Kräfte des Primären Atemmechanismus zu unterstützen, damit sich zwischen den einzelnen Schädelknochen, besonders zwischen den vier Anteilen des Os occipitale, normale Positionen und Beziehungen einstellen können.

ZEICHNUNG I–12: DAS OS OCCIPITALE BEI DER GEBURT, BESTEHEND AUS VIER TEILEN INNERHALB EINER CHONDRALEN MATRIX
Beachten Sie, dass die Gelenkkondylen teils auf den Partes condylares, teils auf der Pars basilaris des Os occipitale sitzen.
Vielerlei Behandlungsmethoden kann man benutzen, um Probleme zu beseitigen, die von solchen Asymmetrien des Säuglingsschädels, wie sie Dr. Lippincott beschreibt, hervorgerufen werden. Sie alle aber hängen vom richtigen Verständnis des Mechanismus und besonders der Reziproken Spannungsmembran ab, da diese die Knochen bewegt.
Ich habe schon auf die Ähnlichkeit des Tentoriums cerebelli mit der Falx cerebri aufmerksam gemacht und erklärt, dass es diese drei Sicheln gibt, die sich um ein Fulkrum herum bewegen. Das können Sie sich nun zunutze machen, um die Kompression auf die kondylären Anteile zu verringern, bevor die ‚Führungen‘ gebildet werden. Die Reziproke Spannungsmembran wird ebenso genutzt als eine der Kräfte, welche die Kompression im erwachsenen Schädel reduzieren.
Ich möchte, dass Sie Folgendes verstehen: Wenn man auf das Os frontale einer Seite eine kleine Spannung in eine bestimmte Richtung – sagen wir rechts – induziert, kommt es hinten bei der Squama occipitalis zu einer Bewegung, die sie nach links herumschwenken lässt, sodass das anteriore Ende des kondylären Anteils sich nach außen bewegt. Es ist von Nutzen, das Bild der Membranen an einem anatomischen Modell eines Neugeborenenschädels zu studieren. Dort können Sie sehen, dass sich der hintere Befestigungspol der Reziproken Spannungsmembran an der Innenseite der Squama occipitalis befindet. Wir nutzen die Membranen in Verbindung mit der Fluktuation der Zerebrospinalen Flüssigkeit, um eine Dekompression zu bekommen und die besagten kondylären Anteile vom Proc. basilaris zu entfernen, sodass er seinen normalen Platz und seine normalen Relationen wieder einnimmt. Wenn die Kondylen nach unten oder anterior in die Facetten des Atlas gedrückt werden, wird die Beziehung zwischen den Kondylen und dem Atlas gestört. Dadurch ist eine Belastung der okzipitoatlantalen Bänder und Gelenke entstanden. Zuerst muss man diese Dysfunktion korrigieren. Um diese Korrektur durchzuführen, werden die Bänder genutzt.
Da man den Atlas manuell unmöglich erreichen kann, zielt die Behandlung darauf ab, den Atlas zum Therapeuten zu führen. Der Therapeut lässt seinen Mittelfinger vom Inion bis nach unten zum Opisthion das Os occipitale hinuntergleiten. Der Kopf des Patienten liegt in der Hand des Therapeuten wie in einer Wiege. Die Hand des Therapeuten bleibt ruhig, die Kuppe seines Mittelfingers ist einfach unten nahe dem Rand des Foramen magnum platziert.
Wenn es dem Patienten möglich ist, arbeitet er mit, indem er das Kinn ein wenig Richtung Brust sinken lässt, ohne seinen Hals zu beugen. Während er so nickt, bewegt sich das Opisthion zurück und das Tuberculum posterior auf dem hinteren Bogen des Atlas bewegt sich auf den Finger des Therapeuten zu.53 Dies stabilisiert den Atlas und ermöglicht es den Kondylen des Os occipitale, sich auf die Divergenz des Atlas hinzubewegen, wodurch die Dysfunktion gelöst wird. Die okzipitoatlantalen Bänder bringen den Mechanismus des Gelenks wieder ins Gleichgewicht. Der Therapeut kann im Anschluss daran fortfahren, die Kompression der kondylären Anteile entsprechend der Diagnose zu lösen. Danach kann die Behandlung des Gelenks zwischen Os occipitale und Atlas, wenn nötig, noch einmal wiederholt werden, um noch einmal auszubalancieren.
Nützlich ist es, ein geistiges Bild von jener Stelle vor Augen zu haben, an der die Kondylen des Os occipitale auf das hintere Ende des Proc. basilaris treffen, denn man kann unmöglich direkt feststellen, wie der Proc. basilaris auf die Kompression reagiert hat. Ein kleiner Anteil des Gelenks mit seiner synovialen Membran befindet sich tatsächlich auf dem Proc. Basilaris (Zeichnung I–12). Wir können nicht wissen, wie sich die kompressiven Kräfte verteilt haben. Deshalb besteht das Ziel jeder Behandlungstechnik lediglich darin, die Anteile voneinander zu lösen. Am Kopf eines Neugeborenen sind die hinteren Enden der kondylären Teile dem Therapeuten zugänglich.
Sind die vorderen Enden beider kondylären Teile des Os occipitale symmetrisch in Richtung hinteres Ende des Proc. basilaris komprimiert, ist eine bilaterale Dekompression möglich. Dies kann durch die Korrektur der okzipitoatlantalen Dysfunktion geschehen, aber es kann auch einfacher sein, jede Seite einzeln zu behandeln.
Nehmen Sie Kontakt mit einer Seite auf und stabilisieren Sie sie. Dann, mit Ihrem Kontakt auf der anderen Seite, rotieren Sie diese Seite weg und dirigieren dabei die Tide von der gegenüberliegenden Seite des Schädeldaches. Dies ist eine delikate Vorgehensweise, die durch die Wahrnehmung des Therapeuten, von seinem Kontakt und von der Spannung am anderen Ende des kondylären Teils geleitet wird.
Falls nötig, kann dies auf der anderen Seite wiederholt werden. Eine präzise Atemkooperation findet oft durch ein gesundes und kräftiges Schreien des Patienten statt. Danach sollte das Ausbalancieren des Gelenks zwischen Os occipitale und Atlas folgen.
Das Prinzip ‚krummer Zweig‘ zeigt sich am deutlichsten beim Erwachsenen. Asymmetrie des Foramen magnum, hervorgerufen im Säuglings- oder Kindesalter, wird durch das Wachstum noch verstärkt und durch Stürze oder andere Verletzungen eventuell noch komplizierter gemacht.
Dieses Problem erfordert oft auch bei einem erwachsenen Patienten eine Lösung. Die Vorgehensweise bei der Dekompression ist die gleiche, nur dass die Kooperation sowohl durch Haltung als auch durch Atmung möglich ist. Um eine bilaterale Wirkung oder eine Wirkung auf die Mittellinie zu erreichen, bietet die Dorsalflexion beider Füße zur Stabilisierung des Behandlungsbereichs eine gute Möglichkeit. Bei der Behandlung eines unilateralen Problems bitten Sie den Patienten, den gegenüberliegenden Fuß dorsal zu flektieren. Bauen Sie die Spannung in Ihrer Berührung langsam auf und lösen Sie sie entsprechend langsam. Nach der Behandlung Erwachsener ist es sogar noch wichtiger, den Atlas wieder ins Gleichgewicht zu bringen, als bei Kindern.
Die Behandlung von Asymmetrien zwischen der Squama und den hinteren Enden der kondylären Anteile des Os occipitale folgt den gleichen Grundprinzipien: Wir nutzen die Dura mater, die Tide und die Atem- und Haltungskooperation des Patienten.
Die genaue Planung eines jeden Schrittes der manuellen Vorgehensweise ist notwendig für eine erfolgreiche Behandlung. Es werden in der medizinischen Literatur zahlreiche Asymmetrien in den Beziehungen der Knochenanteile der Schädelbasis bei der Geburt beschrieben. Die Folgen für die Zukunft eines solchen Kindes wurden jedoch weder ausreichend beachtet noch wurde eine Behandlung entwickelt, um die normalen Beziehungen wiederherzustellen. Ein grundlegendes Verständnis derartiger Probleme gibt es in der Wissenschaft der Osteopathie.
Mütter sind oft in Sorge aufgrund der Kopfform ihres Kindes direkt nach der Geburt. Meist werden sie dann von den Krankenschwestern und Ärzten beruhigt, dass sich solche Asymmetrien innerhalb von ein paar Tagen wieder geben.
Oft ist es auch so, dass die Form wieder so normal wird, wie es die Eltern gerne sehen.
Es ist äußerst interessant, darüber nachzudenken, was hier arbeitet, um eine solche Veränderung zu bewerkstelligen.
Schreien und Saugen des Säuglings haben auf verschiedenartige Weise die Funktion, die Knochen und Knochenteile wieder in die richtige Position zu bringen. Zudem unterstützt die regelmäßige Atemtätigkeit die Bewegung der Zerebrospinalen Flüssigkeit. Das hydraulische Liften, welches die Fluktuation der Zerebrospinalen Flüssigkeit dem Kopf des Kindes von innen gibt, ist ebenso sanft wie kräftig. Seine Arbeit wird durch das Schreien des Säuglings verstärkt. Die Probleme, die durch diese natürlichen Vorgänge verhindert werden, können nur dann verstanden werden, wenn bestimmte Umstände deren Wirksamkeit einschränken.54
Wenn Trauma den Kopf von oben oder hinten trifft, pränatal, postnatal und zuweilen während des normalen Durchtritts des Säuglings durch den Geburtskanal, kommt es zu einer bestimmten Anpassung. Beim normalen Geburtsverlauf schieben sich die Ossa parietalia während der Passage über die Ossa frontalia und das interparietale Os occipitale und der Kopf als Gesamtes passt sich so an, dass er ganz natürlich durch das mütterliche Becken hindurchtreten kann. Nach der Geburt kann es jedoch vorkommen, dass sich diese Adaptionen nicht wieder in die normale Position zurückbewegen.