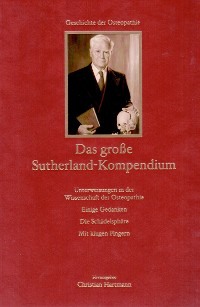Kitabı oku: «Das große Sutherland-Kompendium», sayfa 13
11. ENGPASS-NEUROPATHIE
Es ist wichtig, die Nervenfasern und Ganglien in ihrer Beziehung zur Bewegung der Knochen zu visualisieren, um ein komplettes diagnostisches Bild der Probleme Ihrer Patienten zu bekommen. Ich möchte mit Ihnen einige meiner Erfahrungen in bestimmten Situationen teilen. Denken Sie aber daran, dass die Möglichkeiten endlos sein können. Lernen Sie, mit Ihrem Wissen über den Verlauf, den die Nerven von ihren Nuclei zu ihrem jeweiligen Ziel nehmen, zu arbeiten. Berücksichtigen Sie dabei vor allem, dass unendlich kleine Strains im kranialen Bereich möglich sind.
Betrachten Sie die durale Umhüllung des V. Hirnnervs an seiner Verzweigung, dort wo die einzelnen Zweige das Ganglion trigeminale verlassen. Fokussieren Sie ihre Aufmerksamkeit auf einen unendlich kleinen Strain der duralen Umhüllung des mittleren Zweiges, dem N. maxillaris, wenn eine Rotation der Pars petrosa des Os temporale die Spannung in diesem Bereich erhöht. Eine solche Situation besteht häufig im Falle einer Trigeminusneuralgie. Stellen Sie sich vor, wie unangenehm es für einen Menschen ist, eine enganliegende Ärmelmanschette zu tragen. Dies ist ein passendes Bild für einen Vergleich mit dem unangenehmen Gefühl im Gesicht, das man bei einer Trigeminusneuralgie verspürt.
Es gibt eine weitere kleine Situation, die man bei einer Trigeminusneuralgie erkennen muss. Es handelt sich dabei um einen besonderen Strain im Verlauf des N. infraorbitalis, der durch eine Überdehnung hervorgerufen wird. Die enganliegende durale Umhüllung ist möglicherweise beeinträchtigt im Verlauf des Nervs, um die schmale Rinne am Proc. orbitalis des Os palatinum und weiter durch die Rille in der Maxilla, bis zu seinem Ausgang am Foramen infraorbitale unterhalb des Os zygomaticum.
Ich rate zu einer genauen Untersuchung, um zu wissen, ob winzige Strains in der Beziehungsmechanik zwischen den Ossa palatina und den Maxillen vorkommen. Denken Sie dabei immer an Auswirkungen auf das Ganglion pterygopalatinum. Diese Art Strain, hervorgerufen durch Überdehnung, kann auch im Verlauf des N. ischiadicus vorkommen. Es gibt spezifische Stellen im Verlauf all dieser Nerven, an welchen dieses Entrapment-Problem auftauchen kann.
Stellen Sie sich die Auswirkung von Bewegung auf die physiologische Funktion des Ganglion trigeminale vor. Letzteres befindet sich in der Nähe der Spitze der Partes petrosae der Ossa temporalia, an der diese spezielle rollende, rotierende Bewegung die gesamte Zeit regelmäßig stattfindet. Fühlen Sie die schaukelnde Bewegung der Lamina cribrosa des Os ethmoidale in Verbindung mit den Bulbi olfactorii. Sehen Sie nun die ‚Bewegungsvision‘ in der Aufhängung des Ganglion ciliare in den Orbitae.
Strains dieser Art treten möglicherweise auch im Bereich des Truncus cerebri zwischen dem Aquaeductus cerebri und dem Canalis centralis des Rückenmarks auf – das heißt im Bereich des vierten Ventrikelbodens64.
Erinnern Sie sich an die Position der Nuclei und daran, wie die Hirnnerven verlaufen. Mit Ausnahme der ersten beiden verlassen alle Hirnnerven den Schädel, also denken Sie auch besonders an die Foramina. Sie verstehen den Mechanismus des lebenden Gehirns, der in einem beweglichen Schädel sitzt und unter bestimmten Umständen allen möglichen Strains ausgesetzt ist. Betrachten Sie alle Austrittslöcher der Hirnnerven, um zu sehen, ob für ihre Passage genügend Raum vorhanden ist.
Denken Sie insbesondere an die Foramina jugulares. Man kann sie mit intervertebralen Foramina und die Partes petrosae der Ossa temporalia mit Rippenhälsen vergleichen. Was befindet sich dort am Foramen jugulare außer der V. jugularis interna? Der neunte, X. und XI. Hirnnerv auf ihrem Weg aus dem Schädel heraus. Können Änderungen der Größe und der Gestalt jenes Foramen, das durch zwei Knochen geformt wird, zu einer Entrapment-Neuropathie führen? Das ist möglich.
Nun wollen wir die Rippen und ihre dazugehörigen Wirbel betrachten. Denken Sie über die Auswirkung eines winzigen Strains im normalen Gelenkspiel der Rippenköpfchen nach. Dies könnte die nahegelegenen sympathischen Ganglien stören. Gleichzeitig halten Sie Ausschau nach Strains zwischen Wirbeln, die zusammen gehören und die Auswirkung auf die interkostalen Nerven, wobei Sie an die Gesamtverteilung jener Nerven denken. Prüfen Sie den gesamten Nervenverlauf eines Schmerzsignals zum dorsalen Wurzelganglion auf mechanische Faktoren, welche die Funktion und das Wohlbefinden stören können. In Fällen von Interkostalneuralgie, Neuritis und Herpes Zoster ist dies eindeutig nötig.
Eine Rippe rotiert während der Inhalation und Exhalation in Bezug auf die Mittellinienstrukturen nach innen und außen, ebenso wie alle paarigen lateralen Strukturen überall sonst im Körper. Stellen Sie sich den Rippenhals bildlich vor. Erinnert er Sie an die Bewegung einer Jalousie? Wenn die Jalousie geschlossen ist, gibt es noch Platz zwischen ihr und der Fensterscheibe. Sehen Sie sich sämtliche Rippenhälse beidseits der hinteren Thoraxwand an. Drehen Sie die Rippen in Gedanken, wie sich Jalousien drehen. Achten Sie dabei auf die Änderung des Raumes zwischen der Rippe und dem Gewebe davor – namentlich den Lungen. Visualisieren Sie die prävertebrale Faszie, die nahe an den sympathischen Ganglien und Blutgefäßen verläuft. Was geschieht, wenn die Jalousien, die Hälse der Rippen, nach innen oder außen rotieren? Die Bewegung verändert den Raum, den prävertebralen Raum zwischen Rippen und Lungen.
Nehmen wir an, eine dieser Jalousien (Rippen) luxiert entweder in Außen- oder Innenrotation, zusammen mit einer Störung der funktionellen Physiologie der Grenzstrangganglien – der sympathischen Ganglien. Was geschieht in der Nähe dieses Ganglion mit dem Rippenköpfchen, wenn die Rippe in einer Position festgehalten wird? Sie haben dann die gleiche Art von Störung vor sich, als ob jenes kleine Ding, das Ganglion pterygopalatinum genannt wird, nicht richtig arbeitet.
Angenommen Sie haben einen Patienten mit einer Hyperextension im Bereich der oberen oder mittleren Brustwirbelsäule: Sie haben sich bemüht, eine Änderung herbeizuführen, aber Sie haben keine Fortschritte gemacht. Warum bekommen Sie nicht das Ergebnis, um welches Sie sich bemüht haben? Weil der Kopf einer Rippe die zu ihr gehörigen Wirbel in dieser Position hält.

ZEICHNUNG I–15(A): ANTERIORE ANSICHT DER HINTEREN THORAXWAND
Gezeigt wird die Beziehung der sympathischen Grenzstrangganglien zu den kostovertebralen Gelenken.

ZEICHNUNG I–15(B): EIN TRANSVERSALER QUERSCHNITT DES KOSTOVERTEBRALEN GELENKS
Mit seiner Beziehung zu einem sympathischen Grenzstrangganglion.
Um diesen Zustand zu behandeln, müssen Sie lediglich die Schraube – also die Rippe – in einer Position halten. Es macht keinen Unterschied, ob Sie sie in Innen- oder Außenrotation halten. Sie halten die Schraube und bitten den Patienten die Mutter zu drehen – das heißt das Facettengelenk oder die Facettengelenke der dazugehörigen Wirbel. Der Patient tut dies, indem er die gegenüberliegende Schulter wegdreht oder vielleicht nur seinen Kopf. Wenn Atemkooperation zusätzlich zur Haltungskooperation angewandt wird, werden die mit den betroffenen Gelenken verbundenen Bänder, welche das Rippenköpfchen im Gelenk halten, es wieder in eine normale Position zurückführen.
Sie wenden die gleiche Haltungs- und Atemkooperation bei der entsprechenden Rippe der Gegenseite an. Was geschieht nun mit jener sogenannten chronischen Extensionsdysfunktion im Bereich des Thorax, wenn die normale Bewegungsfreiheit wiederhergestellt ist? Die gleichen Ergebnisse, die Sie vorfanden, als Sie bei Strains im kranialen Bereich Erleichterung verschafften. Die Entrapment-Neuropathie ist beseitigt.
12. TRAUMA
Es gibt drei verschiedene wichtige Aspekte, wenn wir über den lebendigen menschlichen Körper inklusive Schädel nachdenken. Der erste ist die Betrachtung der unwillkürlichen Physiologie, so wie sie ununterbrochen abläuft, mit ihren dazugehörigen mechanischen Aspekten. Hier beobachten wir die Flexion und Extension der Mittellinienstrukturen zusammen mit der Außen- und Innenrotation der paarigen lateralen Strukturen.
Der zweite wichtige Aspekt ist die Anpassung, die diese lebendige Struktur aufgrund von haltungsbedingten und diversen Belastungen durchführen muss. Dadurch entstehen Muster, die bei einer strukturellen osteopathischen Untersuchung bemerkt werden. Solche Muster sind beim Erwachsenen Ausdruck kleiner Strains, die zuerst in der Kindheit entstanden sind und sich später mit dem Wachstum vergrößert haben, das Phänomen des ‚krummen Zweiges‘.
Der dritte Aspekt sind die Traumen, im Sinne einer Verletzung durch die Einwirkung einer Kraft von außen auf den lebendigen Schädel. Falls sich der Kopf während der Übertragung einer solchen Kraft als Ganzes bewegen kann, werden die Auswirkungen auf den Mechanismus minimiert. Aber die Auswirkungen eines schwunghaften Impulses auf Trägheit (sobald also ein sich bewegendes Objekt auf ein stehendes trifft) zeigen ein Spektrum schwerwiegender Folgen und auch eine unbegrenzte Vielzahl damit verbundener Konsequenzen. Dieser kurze Vortrag von Dr. Sutherland vermittelt längst nicht alles, was er in den vielen Jahren seiner Unterrichtszeit zu diesem Thema zu sagen hatte.
Die Folgen eines Schädeltraumas sind in der osteopathischen Praxis sehr häufig anzutreffen. Strains im Bereich der kranialen membranösen Gelenke sind oft die Auswirkung von Operationen, die aufgrund eines anderen Problems durchgeführt wurden. Eine einfache Prozedur wie die Extraktion eines Zahnes kann ungewollt einen Strain des Gesichtsmechanismus oder sogar in der Fossa cranii posterior hervorrufen.
Die großen Verbesserungen im Transport verletzter Personen verhindern die vielen Sekundärverletzungen, die es früher noch häufiger gab. Man hat erkannt, dass ein verletzter oder bewusstloser menschlicher Körper unabsichtlichen Überlastungen eher ausgesetzt ist, weil der Muskeltonus, der die Gelenke sonst schützt, nicht arbeitet. Die Bänder erlauben unter solchen Umständen einen größeren Bewegungsradius, was dazu führen kann, dass es zu einem Strain durch Überbeanspruchung kommt.
In Notfällen, die vorrangige Aufmerksamkeit in einem anderen Bereich benötigen, gibt es häufig geringfügigere Traumen, die nicht vergessen werden sollten. Bei einem einzelnen Zwischenfall können oft viele Verletzungen auftreten. Ärzte müssen sich zuallererst um die dringendsten kümmern. Es gibt aber viele Folgeerscheinungen, die sich erst nach einiger Zeit manifestieren. Wenn sie nicht zu gegebener Zeit behandelt werden, können sie die Basis für spätere Beschwerden sein. Eine vollständige Untersuchung, welche all die kleinen, mit dem Unfall verbundenen Verletzungen berücksichtigt, sollte zum langfristigen Wohl des Patienten rechtzeitig durchgeführt werden.
Es gibt zahllose traumatische Folgen bei Unfällen, bei denen es um das Zusammentreffen eines schwunghaften Impulses und Trägheit geht. Zudem gibt es verschiedene Typen von Strains im kranialen membranösen Gelenkbereich aufgrund einer direkten äußeren Krafteinwirkung. Solche lokal begrenzten Geschehnisse müssen mithilfe lokaler Anatomie analysiert werden. Sollte hier auch noch mentaler und emotionaler Stress hinzukommen, werden die Auswirkungen noch verstärkt. ‚Schützengrabenschock‘ und heftige Erschütterung in der Umgebung sind ebenfalls äußere Kräfte, die sich auf den kranialen Mechanismus auswirken.
Wenn die Art der Entstehung eines traumatischen Zwischenfalls bekannt ist, wird bei der Benennung der Dysfunktion zunächst der Knochen genannt, der als erster von der äußeren Einwirkung betroffen wurde, und an zweiter Stelle dann der benachbarte Knochen. Zum Beispiel kann ein Schlag auf die Stirn das (die) Os frontale (Ossa frontalia) auf die Sutura coronalis zwischen die Ossa parietalia schieben. Das nennt man frontoparietale Dysfunktion. Erfolgte der Aufprall auf das Os parietale, spricht man von parietofrontaler Dysfunktion.
Als ich noch sehr jung war, hatte ich einen Bruder, Steve, der mich in Schwierigkeiten brachte. Er hatte die Gewohnheit, auf irgendeinen hohen Baum zu steigen und herunterzuspringen. Er landete leichtfüßig. Ich dagegen fiel auf meine Sitzhöcker. Wenn Sie aus größerer Höhe hinunterspringen und auf gestreckten Beinen landen oder auch wenn Sie hinunterfallen und auf Ihren Sitzhöckern landen, sind Sie beim Aufprall einem schwunghaften Impuls, der auf Trägheit trifft, ausgesetzt – und das nicht nur an einer Stelle.
Denken Sie an die Cisterna magna, an die Masse der Zerebrospinalen Flüssigkeit im Spatium subarachnoidale der Fossa cranii posterior. Wenn dort der durch Trägheit abgebremste Impuls ankommt, kann die Medulla oblongata in das Foramen magnum absinken, während das Cerebellum von oben darübersackt und die Zerebrospinale Flüssigkeit hinausgedrückt wird. Mit diesem Bild wird angedeutet, was bei einer solchen Art von Gelenkstrain im kranialen Bereich passieren kann. Man könnte sagen, dass das Cerebellum auf den vierten Ventrikel hinuntersackt und ihn komprimiert oder vielleicht, dass eine okzipitomastoidale Dysfunktion entsteht.
Drehen Sie die Wörter um und nennen Sie es eine mastoidokzipitale Dysfunktion. Dies ist eine andere Möglichkeit, da eine Kraft von außen auch zuerst die Ossa temporalia treffen kann. Man hat die gleichen Folgen. Es kommt zu einer Kompression in jenem wichtigen Bereich. Und was für ein träges Gefühl ergibt sich daraus. Sie werden dieses Problem (eine okzipitomastoidale Dysfunktion) auch bei vielen Patienten mit psychiatrischen Beschwerden antreffen.
Es gibt noch eine weitere Cisterna, die wir Cisterna interpeduncularis nennen. Sie liegt direkt über der Sella turcica. Ein Schlag von oben auf den Kopf kann dort eine ähnliche Kompression hervorrufen, welche die Flüssigkeit herausdrückt. Hier kann dies zu einer Einengung des Chiasma opticum führen. Manchmal wird dadurch die Retina des Augapfels beeinträchtigt und es kommt zu einem Papillenödem.
Die Membrana arachnoidea legt sich nicht wie die Pia mater in die Fissuren und Sulci des zerebralen Kortex. Diese Leptomeningen sind für die Verteilung der Zerebrospinalen Flüssigkeit an der Außenseite des Neuralrohrs zuständig. Die Membrana arachnoidea erstreckt sich über die Fissuren. Wenn es nun zu heftigen Vibrationen wie auf einem Kriegsschauplatz oder zu einer anderen heftigen Erschütterung kommt, blockiert diese Membran über dem zerebralen Kortex, der ja eine Konsistenz wie weicher Pudding hat. Daraus ergibt sich eine Störung der Fluktuation der Flüssigkeit im Bereich des Kortex. Bei Unfällen, bei denen es einen schwungvollen Impuls und dann einen Zusammenprall mit einem stehenden Objekt gibt, was ein ‚Schleudertrauma‘ mit sich bringt, gibt es normalerweise eine Erschütterung innerhalb des Schädels und einen Contrecoup-Effekt. Arbeit mit der Fluktuation der Zerebrospinalen Flüssigkeit, die den Normalzustand kurz nach so einem traumatischen Zwischenfall wiederherstellt, kann die Entwicklung eines postkommotionalen Syndroms verhindern. Zwar ist es auch noch lange nach einem Unfall möglich, den bei diesem Syndrom auftretenden Zustand zu verbessern, aber vorzubeugen ist besser.
Nehmen wir an, Sie bekommen einen Schlag auf das Os frontale in der Nähe des Angulus frontozygomaticus. Können Sie sich vorstellen, wie dies das kleine Os palatinum auf das Ganglion pterygopalatinum schieben kann? Je nach Richtung einer solchen Krafteinwirkung kann es zur Blockierung der sphenozygomatischen Gelenkverbindung in der lateralen Orbitawand kommen. Wenn der Schlag sehr heftig ist, kann es sogar zur Fraktur in der lateralen Orbitawand kommen. Solch ein Faktor in diesem Bereich kann auch die Bewegung des Os sphenoidale blockieren.
Man tut gut daran, die Tatsache zu berücksichtigen, dass die Pars petrosa des Os temporale nicht nur nach innen und außen in Relation zum Proc. basilaris des Os occipitale rotiert, sondern auch medial und lateral gleitet. Es kam schon vor, dass ein Golfball, der durch die Luft geflogen kam und auf dem mastoidalen Bereich des Os temporale genau hinter der Ohrmuschel landete, die Pars petrosa medial in die Schädelbasis schob. Daraus können komplizierte medizinische Probleme für den Patienten resultieren. Auf der anderen Seite kann ein Sturz, bei dem der Kopf mit der Squama occipitalis auf dem Gehsteig landet, zu einer Situation führen, in der das Os temporale lateral hinausgleitet. Die vorsichtige Anwendung des Prinzips der ausgeglichenen Membranspannung wird die prompte Wiederherstellung des Normalzustandes unterstützen. Der Patient wird über den plötzlichen Unterschied staunen.
***
Im Folgenden sind anatomische Charakteristika aufgeführt, die normalerweise die Effekte von Gewalteinwirkung auf den Schädel minimieren:
1. Die Dichte und Beweglichkeit der Kopfhaut.
2. Die kuppelartige Schädelform, wodurch relativ starke Schläge ausgehalten werden und auch abgleiten können.
3. Die Anzahl der Knochen, wodurch sich normalerweise die Kraft eines Schlages verteilt.
4. Die Suturen, welche die Übertragung der Gewalteinwirkung unterbrechen.
5. Die Membran zwischen den Suturen, die bei kleinen Kindern als linearer Puffer fungiert.
6. Die Elastizität der äußeren Schicht.
7. Das Überlappen einiger Knochen (z. B. das Os parietale durch die Squama temporalis) und die wechselnde Abschrägung benachbarter Knochen (z. B. an der Sutura coronalis).
8. Das Vorhandensein von Rippen oder Leisten (z. B. von der Crista galli bis zur Protuberantia interna des Os occipitale, von der Nasenwurzel bis zum Proc. zygomaticus, vom temporalen Grat der Orbita bis zum Os mastoideum, von einem Os mastoideum zum anderen, von der Protuberantia externa bis zum Foramen magnum).
9. Pfeiler (z. B. Proc. zygomaticus und Ala major des Os sphenoidale).
10. Die Beweglichkeit des Kopfes auf der Wirbelsäule.65
13. DIAGNOSE UND BEHANDLUNG
DIAGNOSE
Es gibt mehrere Grundsätze, die ich angewandt habe, um die Situation am lebendigen Kopf zu diagnostizieren. Der erste wichtige Punkt in diesem Prozess ist der Gebrauch Ihrer Hände bei der Palpation und den Bewegungstests. Dabei können Sie Ihren Tastsinn ebenso nutzen wie Ihr Sehvermögen, um Beobachtungen zur Schädel und Gesichtsform als Ganzes und auch im Detail anzustellen. Sie können zahlreiche Orientierungspunkte, die Größe und Form einzelner Knochen erspüren und den Verlauf der Suturen ertasten. Diese erste Untersuchung ist relativ oberflächlich, aber sie ist die Basis für Ihre weiteren Befunde.
Bei der Palpation legen Sie Ihre Finger sanft auf den Schädel, das Abdomen oder eine andere Stelle des Körpers des Patienten. Lassen Sie Ihre Hände sein wie ein Vogel, der auf einem Ast landet, ihn still berührt, um sich schließlich auf dieser Stelle niederzulassen. Während Ihre Finger dort fühlen, sehen, denken und wissen, können sie Ihnen in einer Minute mehr erzählen, als ein fester Griff in einer ganzen Stunde erfassen kann. Sie werden sich darin üben, zu beobachten ohne einzugreifen. Wenn Sie versuchen, das Schädeldach fest anzufassen, erfahren Sie nicht viel, da Sie den Tastsinn, den Propriozeptions-Sinn, mit der Bewegungskraft Ihrer Hand vermischen werden.
Jetzt möchte ich Ihnen etwas darüber erzählen, wie man die Berührung am Schädeldach nutzen kann, um die Vorgänge im Gelenkmechanismus der Schädelbasis zu erkennen und zu verstehen.
Zunächst muss ich erwähnen, dass Sie die Gelenkverbindungen der Knochen der Schädelbasis nicht direkt ertasten können. Deshalb wird Ihnen die Berührung des Schädeldachs zwei Dinge sagen: erstens Fakten über das Schädeldach selbst und zweitens Fakten über die Schädelbasis, die Sie über das Schädeldach wahrnehmen können.
Den manuellen Kontakt, den ich bei der Untersuchung des Schädeldachs zur Diagnose der Bewegung in der Schädelbasis am nützlichsten finde, kann man sich wie eine Zange vorstellen. Das heißt, Hände und Arme funktionieren gemeinsam wie besagtes Werkzeug. Es handelt sich hierbei um eine Modifikation jener Art des Kontakts, die Dr. Still bei seiner ‚Handgelenk-Technik‘ lehrte. Um das Schädeldach zu berühren, sitzt der Therapeut am Ende der Behandlungsbank und der Patient liegt auf dem Rücken. Der Therapeut platziert die Handinnenflächen auf den Ossa parietalia, also dem Schädeldach seines Patienten. Seine Daumen sind oberhalb des Vertex gekreuzt und seine Arme hängen entspannt von den Schultern. Dieses Arrangement kann man mit einer Zange vergleichen. Die Innenflächen der Finger passen sich dem Kopf des Patienten so an, dass man sie gut nutzen kann. Das Überkreuzen der Daumen schafft ein kleines Fulkrum, wie das Fulkrum einer Zange. Die Unterarme des Therapeuten entsprechen den Griffen der Zange.
Dann lernen Sie die Muskeln des Unterarms, die Flexoren, zu benutzen, um Ihren Kontakt am Patienten zu beeinflussen. Der Therapeut benutzt den M. flexor digitorum profundus und den M. flexor pollicis longus bei der Entwicklung seiner manuellen Fähigkeiten. Beachten Sie, dass meine Finger bei meiner Demonstration dieses Kontakts am Schädeldach nicht zu weit unten an der Seite des Patientenkopfes liegen. So kann ich nämlich die Schädelbasis nicht erreichen. Die Kontaktaufnahme mit den Ossa parietalia erfolgt durch die Innenflächen der proximalen Fingeranteile auf und hinter den Tubera parietalia.
Die Berührung ist plastisch, nicht fest, und erlaubt mir ein leichtes Liften, sobald sich die Ossa parietalia lateral bewegen. Die Anguli posteriores inferiores bewegen sich anterolateral. Die Bewegung an diesem Angulus verläuft auch nach oben und ist weiträumiger als die Bewegung der Anguli anteriores inferiores. Die Gelenkführungen tragen die Bewegung einfach weiter, sobald diese in Richtung Außenrotation begonnen hat. Die Bewegung in diese Richtung findet statt, wenn sich die sphenobasilare Verbindung in ihre Flexionsposition begibt.
Sie müssen also das Schädeldach lediglich in seine Flexionsposition bewegen – ihm sozusagen einen kleinen ‚Anstoß‘ geben. Die Flüssigkeit, die Tide, trägt es dann weiter zu seinem vollen Ausmaß der Flexionsbewegung. Sie zwingen also die Bewegung nicht über diesen Punkt im Bewegungsausmaß hinaus, welcher sich ergibt, wenn die Flüssigkeit weiterführt, was Sie begonnen haben. Die gleiche Vorgehensweise wird angewendet, um die Bewegung in Extension zu initiieren. Sie brauchen nur das Fulkrum, die gekreuzten Daumen, durch die Griffe, also die Unterarme, zu verändern. Wenden Sie eine geringe Kompression an, der ein Drehen der Ossa parietalia in Richtung Innenrotation folgt. Dies initiiert eine Extensionsbewegung an der sphenobasilaren Verbindung. So können Sie diagnostizieren, ob die Schädelbasis sich weiter in Flexion als in Extension bewegt oder umgekehrt. Sie werden es wissen, da Sie nichts erzwungen haben. Sie haben lediglich der Tide erlaubt, das Schädeldach in seinem normalen Bewegungsausmaß in Flexion und Extension zu bewegen.