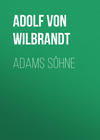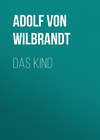Kitabı oku: «Adams Söhne», sayfa 12
Zweites Buch
I. Kapitel
Wittekind stand am Fenster, von der Morgensonne beschienen, und blickte auf den großen, feiertagsstillen Hof vor seinem Hause hinaus. Die Tore der Scheunen und Ställe, die den Hof rechts und links umgaben, waren alle geschlossen, und gegenwärtig nirgends ein Mensch zu seh’n; nur eine schwarze Katze und allerlei Hühnervolk, großes und kleines, wanderte auf dem sonnigen Hof umher.
Es war ein Sonntagsmorgen; der zweite Sonntag im Juli. In der Ferne stand ein leuchtendes Gebirge, aus Sommerwolken gebaut; sonst war alles eben und flach. Wittekind sah durch das offene Hoftor auf grünes Uferland, auf bräunlichen Schilf, den der Wind bewegte, auf den seeartig breiten, dunkelblauen Fluss und die jenseitigen Ufer, an denen sich ein einförmiger, ernster Tannenwald hinzog. Er fühlte sich wieder in der Heimat; doch nicht recht daheim.
Das Fenster war offen, von dem kleinen Teich her, der links hinter dem Hofe lag, kamen die zarten, piependen Stimmen junger Enten herüber, die ihren gelben Flaum auf dem Wasser wiegten. Er konnte sie schwimmen seh’n; als geborene Künstler ruderten sie nach allen Seiten über ihren leicht gekräuselten kleinen Ozean, den hier und da niedriger, grüner Schilf begrenzte. Am Ufer, bei der Entenbucht, irrte eine schwarze Henne umher, die einen Teil dieses Entenvölkchens ausgebrütet hatte; sie sah ihnen voll Unruhe und Muttersorge nach, auf der bretternen Einfassung der Bucht lief sie bis zum äußersten Rand hinaus, lüftete die Flügel, hob sich mehr als einmal zum Sprung, als müsse sie den Jungen nach, die so dreist davonschwammen; immer blieb sie aber wieder im Gefühl ihrer Ohnmacht verzagend steh’n.
Wittekind schaute ihr zu, sie ergötzte und rührte ihn. ›Worüber lächl’ ich denn?‹ dachte er auf einmal. ›Ist’s bei uns denn anders? Seh’n wir nicht auch so vom Ufer zu, wenn unsre groß gewordenen Kinder auf allerlei Wasser hinausschwimmen, wohin wir nicht folgen können? Wir meinen Wunder, wie sehr sie Unsresgleichen sind; auf einmal gehen sie ihre eigenen Wege, neue „Zeiten“, neue Instinkte führen sie, wir können’s nicht ändern, können sie nicht halten. Da stehen dann wir alten Hennen … Ja, mein Junge, mein Schwärmer – der mir noch hinausschwärmen wird, Gott mag wissen, wohin; mein teurer Junge, mein Berthold!‹ Vor wenigen Tagen erst hatte er ihn verlassen, es dünkte ihn schon eine Ewigkeit. In seiner Sehnsucht durchwanderte er die Tage zurück bis zu jenem Morgen in Salzburg: wie er da erschrak, ihn triefend am Ufer zu finden, ihn ins Gasthaus brachte, bettete und pflegte; – bis dann von der ›Gemse‹ ihr leichtes Gepäck kam, und der gute Alte zum Abschied, und sie gen München fuhren, über Kathi leidlich beruhigt, über Dorsay grübelnd und entrüstet, dem Untersberg noch wie einem Freunde winkend – und die eigene schwere Trennung auf dem Herzen … Auch die war nun vorbei, Vater Wittekind in seinem Norden allein.
Er sah staunend umher; so öde war ihm hier nicht mehr gewesen seit seiner Hausfrau Tod. Wie leicht täuscht sich der Mensch, wenn er, an einem Ort heimisch eingewurzelt, alles um sich her selber geschaffen, mit seinen Erinnerungen, seinem Geschmack, seiner Sinnesart angefüllt hat und nun denkt, diese Welt um ihn her habe ein Leben empfangen, werde immer lebendig auf ihn wirken. Wie freute ihn sonst, in seinem sinnlich kräftigen Lebensgefühl, dieses ›warme Nest‹, sein weiträumiges Wohnzimmer, von dessen olivengrüner Tapete seine Büchergestelle, mit den edlen, farbigen Einbänden, die alten, feierlich schönen Kupferstiche, die Büsten und Statuen, der mächtige braune Kachelofen, das geliebte Klavier ihn wie erprobte Lebensgefährten ansahen und den warmen Hauch ihres Daseins auszuatmen schienen. Jetzt freute ihn nichts. Am Klavier, bei Beethovens seelenvollsten Sonaten, überfiel ihn bald eine entmannende Wehmut; auf dem riesigen Schreibtisch lag ein Buch neben dem andern aufgeschlagen, keines hielt ihn fest: Shakespeare, Darwin, Ranke, Jhering, denn er ging allerlei Wege; in diesen Tagen umsonst: selbst sein Lieblingsheiltrank, der ›Faust‹, wollte jetzt nicht helfen.
Wie schön war draußen der Tag! Es ging ein warmer, aber nicht drückender Wind und tändelte mit seinem Sommer-Spielzeug, dem Getreide, dem nachgemachten wogenden Meer; reicher Feldersegen durchgoldete das Land, schöne Erntehoffnung. Es half alles nicht. Ihn freute weder Feiertag noch Werkeltag. Eine der trüben Zeiten war gekommen, wo das Leben kalt und beklemmend wie ein nasses Tuch um die Seele liegt; wo der Tisch der Natur nicht für uns gedeckt scheint, weil wir nach Versagtem hungern, und unsere reinen Gesinnungen uns mehr zur Last, als zum Troste sind. Ihm fielen Waldenburgs Worte aus jenem vertraulichen Gespräch ein: »Du kommst mir vor wie einer von diesen freiwilligen Nordpolfahrern … Was hast du auf deinem Gut, am Wasser, mit den Zuckerrüben? – — Ich bin auf der Welt, um sie zu genießen.« … Er fühlte mit bitterem Lächeln, dass er Waldenburg fast beneiden könnte: der packt das Glück mit frecher Satyrfaust bei den Haaren und zwingt es an seine Brust; dem macht es kein Herzweh, keinen Sohn zu haben; dem fehlt seine Frau nicht mehr, er hat die der andern: und er sitzt da irgendwo am Meer mit diesem interessanten, begehrten Rätsel, dieser großäugigen, blassen Marie…
Wittekind verlor die Ruhe, er verließ das Fenster und ging im Zimmer umher. Seine Schwester Emma trat hinter ihm in die Tür; eine kurze, breitschultrige Gestalt mit großem Kopf, dem Bruder gar nicht ähnlich, auch in den Gebärden nicht; seit einigen Jahren führte sie das Haus.
»Hast du mich gerufen, Karl?« fragte sie.
»Ich? – Nein.«
»Du hast aber irgendwas gerufen, Karl. Ich hörte deine Stimme.«
»Sonderbar!« sagte er. »Das ist mir durchaus nicht bewusst.«
Sie sah ihn mit einer Art von mütterlicher Sorge und Unzufriedenheit an, und blickte dann auf den Tisch, an dem er gefrühstückt hatte.
»Deine Tasse ist auch noch halb voll«, meldete ihre trockene Stimme.
»So bleibt sie auch«, sagte er sanft, die Hand an seiner Stirn.
Sie hob die Achseln und ging wieder hinaus.
Wittekind sah ihr nach. Was nützte ihm jetzt diese gute Frau! Sie ahnte nicht, was er wollte oder was ihm fehlte. Gott hatte sie zur Wirtschafterin bestimmt, und dazu allein; sie fühlte auch ihren Wert, sie sah mit halb geringschätziger Hochachtung auf den Bruder herab, dem sie, so oft er ausging, ein Stück Schokolade oder ein Butterbrot oder seine Geldbörse in die Tasche steckte; den sie für einen gut beanlagten, aber durch die Bücher aus Abwege gekommenen, unpraktischen Menschen hielt. ›Was ist sie mir?‹ dachte er. ›So viel wie diese olivengrüne Tapete…‹
Einsam! Einsam! Einsam! Er trat wieder ans Fenster; seine blauen Augen starrten matt und leblos hinaus. Ein paar Lust-Yachten mit hohen, weißen, leuchtenden Segeln, vom Südost getrieben, zogen wie Riesenschmetterlinge auf dem Fluss vorüber; ein Anblick, den er oft von diesen Fenstern genoss, der ihm die Brust zu schwellen pflegte, denn gleich seinem Berthold war er ein leidenschaftlicher Segler seit der Knabenzeit. Er kreuzte die Arme und sah ihnen nach; es ging ihm wunderlich, seine Seele schien sich zu öffnen. Ihm war, als zögen da beflügelte Seelen hin, ins blaue Leben hinein.
»Freie, tapfere Seelen, die sich aufgemacht … Spann’ deine Flügel aus!« sagte seine Stimme, ihn selber überraschend.
»Ja«, wiederholte er sich mit wachsendem, schwellendem Bewusstsein: »spann’ deine Flügel aus! Schwing' dich aus! Sei ein Mann! – Ei, das Leben wär’ wunderleicht, wenn es nur gute Stunden hätte, die von selber aufstiegen. Heut’ aber heißt es: zeig’, was du kannst, wer du bist!«—
Er richtete seine männliche Gestalt breitbrüstig auf, er dehnte sich und sprach mit freier, tönender Stimme seinen Lieblingsspruch, den er aus einem irgendwo gelesenen umgedichtet hatte:
»Der Ruf erscholl:
So halt’ ich still.
Ich muss und soll:
Ich kann und will!«
»Nun ja denn«, sagte er noch einmal, lächelnd und nach seinem Hut an der Wand greifend: »ich kann und ich will! Hinaus will ich vor allem; will auch meine Segelpferde reiten lassen. Wozu hätten wir denn diesen Feiertag. Aufs Wasser, aufs Meer hinaus!«—
Er rief ins andre Zimmer hinein, dass er ›in See stechen‹ wolle und wohl nicht vor Abend zurückkomme; rief draußen den Fritz, einen fünfzehnjährigen Jungen, den er als seinen ›Schiffsjungen‹ mitzunehmen pflegte, und ging mit großen, jugendlichen Schritten über den Hof.
Wo seine Feldmark am weitesten in den Flusslauf vorsprang, hatte er sich einen kleinen, schilfumsäumten Hafen angelegt, in dem außer einigen kleineren Booten auch eine Segelyacht schaukelte, die ›Möwe‹ genannt; ein starkes, seetüchtiges Fahrzeug mit zwei schlanken Masten, ein gedeckter Raum im Vorderteil war eben groß genug, dass zwei oder drei genügsame Männer darin übernachten konnten. In dieser Yacht hatte er schon manches Mal den südwestlichen Winkel der Ostsee kreuz und quer durchstreift, auch die nahen dänischen Inseln besucht; es lebte in ihm nordgermanisches Seefahrerblut, das ihn oft vom kornbauenden Land auf die große, himmelumflossene Wasserwüste hinauszog. Der Wind war günstig; und schon der Wasserdunst erfrischte ihm das Herz. Fritz, vor Freude lachend – ein rotblonder Bursche mit gewaltigen Knochen, der im nächsten Frühjahr als wirklicher Kajütenjunge nach Amerika mitgeh’n wollte – zeigte mit glühendem Eifer seine Seemannskünste; sie schwammen bald mit gefüllten Segeln, mit dreiviertel Wind, auf dem breiten Fluss, der noch eine Strecke abwärts sich bis zu zwei Seemeilen weitete, von dunklen und helleren Wäldern oder langen Wiesenstreifen umschlossen. Die Wellen erhöhten sich hier, das Schiffchen schnitt wie ein Pfeil hindurch. Schneller, als Wittekind gedacht hatte, kam es an den ›Durchstich‹, wo sich der See zu einem schmalen Wasserfaden zusammenzieht, nur eben breit genug, um der Schifffahrt ausreichenden Raum zu lassen. Diesen Kanal hinab fuhren sie an dem langgestreckten Hafenstädtchen hin, an großen und kleinen Dampfern und Segelschiffen vorbei, endlich in die See hinaus. Auf der blauen, bewegten Fläche blitzte hier und da – draußen mehr und mehr – der Silberschaum, den der Südost aus seinen Flügeln spritzte. Phantastische Wolken stiegen in der uferlosen Ferne wie Spielzeuge der Meerweiber oder wie märchenhafte Seegeschöpfe auf; dazwischen zog sich der Rauch vorüberfahrender Dampfer in lang gefegten Streifen wie endlose Wimpel hin. Die Lichter der Sonne tanzten auf den Wellen. Möwen und Seeschwalben, einzeln und in Haufen, strichen über die Brandung und weiter ins Meer hinaus; ihre hellen, halb singenden Rufe stiegen wie aus dem Wasser auf, vom Wind verweht und verflatternd.
Wittekind ward wohl ums Herz.
»Wohin fahren wir, Herr?« fragte der ›Schiffsjunge‹. Lächelnd zuckte Wittekind die Achseln; was lag ihm daran, wohin? »Nur so ins Leben hinaus!« – —
Auf einmal errötete er, über seinen eigenen Gedanken: ihm fiel das nächste Seebad dort im Westen ein, hinter dem hohen Ufer, und dass dort Waldenburg sein möchte und – andere mit ihm. Ob dieser Gedanke schon in ihm dämmerte, als ihm die Lust kam, wie jene ›geflügelten Seelen‹ auch hinauszusegeln? Was sollte er sagen; ihm war’s nicht bewusst. Er wusste auch nicht, würde er sie dort finden oder nicht? Er hatte vergessen, Waldenburg zu fragen; oder es nicht gewollt. ›Umso besser‹, dacht’ er; ›so segle ich ohne Ziel, nur eine unbestimmte Ahnung in der steuernden Hand, auf die Ferne zu…‹ Er steuerte aber schon nach Westen; das Schiff, dem der Südost nun in die Flanke fiel, tanzte lebhafter, unruhiger dahin, seiner eigenen Seele gleich, die ein innerer, warmer Wind zu schwellen, zu tragen schien. Der letzte Rest von Lebensunmut hatte ihn verlassen; er horchte auf die lieblich schrillen Töne der Meeresvögel, die ihn ins Unbekannte hinauszulocken schienen, und seinen Spruch wiederholend, obwohl er kaum mehr passte, sang er vor sich hin:
»Ich muss und soll,
Ich kann und will! – —«
Die Ufer an dieser Küste fesseln das Auge nicht; nur wo die bleichen Sanddünen sich höher auftürmen, gleich erstarrten Wellen, oder auf steilen, gelblichen Uferrändern sich edler Laubwald erhebt, wird der Gegensatz zwischen Land und Meer anziehend und malerisch Wittekind segelte ungeduldig vorwärts, ohne die Augen viel auf das Land zu richten; ihn erquickte mehr die salzige Kraft der durchfeuchteten Luft, das Aufrauschen der Wellen an seinem Bug und Bord, und die rastlose, stampfende Gewalt, mit der sein Seeross, die ›Möwe‹, sich den Weg durch die Schaumflut bahnte. Die eintönige Küste zog langsam an ihm vorbei, aber er sah schon sein Ziel: vor einem dunklen Wald, der ans Ufer vorsprang, leuchteten weiße Häuser, wie zurückgebliebener Schaum über dem Wasser aufragend. Er kam näher, und die zierliche Bauart dieser villenähnlichen Häuser zeichnete sich gegen den hohen, majestätischen Buchenwald ab; sie zogen sich in langer Reihe, doch unregelmäßig am steinigen Gestade hin, und wo aus dem Wald die Fahrstraße hervortrat und den Strand erreichte, drängten sich höhere Gebäude, zum Teil wie Burgen bezinnt und betürmt, zusammen. Wittekind steuerte auf einen hohen Steg zu, der im Viereck ins Meer gebaut war und auf eingerammten Pfählen schwebte; hier legten die Schiffe an, und die Sommergäste ergingen sich auf den langen Bretterwegen über der friedlichen Brandung oder träumten auf Bänken, von der salzigen Flut umrauscht. Die Sonne stand schon hoch, als er hier landete; der erwärmte, schattenlose Strand war fast menschenleer. Nur rückwärts im Wald bewegten sich hier und da Gruppen von lichtgekleideten oder farbigen Gestalten mit bunten Mützen und Hüten; Kinder sprangen umher oder spielten Ball, oder lagen im Schatten. Von den Menschen, an die er dachte, sah Wittekinds scharfes Auge nichts. Vielleicht war es nur ein Wahn, er werde sie hier finden; gab es doch so viele Seebäder an der langen Küste. Freilich schien nur dies, das vornehmste, eines Mannes würdig, der ›Europa regieren könnte‹ und danach rang, Exzellenz zu werden … ›Nun, ich bin wenigstens hier!‹ dachte Wittekind; ›und ich genieße den Tag!‹ – Er hatte angelegt, übergab die ›Möwe‹ der Obhut seines Schiffsjungen, sagte ihm, wo er ihn am Nachmittag aufzusuchen habe, da sie dann heimfahren wollten, und ging über den Steg ans Land.
Ihn lockte vor allem das westliche, ansteigende Gestade, das sich zuletzt mit steilem Abfall über den Strand erhebt, und der herrliche Wald, der diese Hochfläche bedeckt. So weit er Wald ist und die Buchen – hier und da mit Eichen gemischt – geschlossen beisammensteh’n, ragen die grauen Stämme schlank und grade wie edle, lebendige Säulen auf; die aber dem Rand zunächst und oft nur in Paaren oder vereinzelt stehen, zeigen in ihrem Wuchs den furchtbaren Kampf, den sie mit den Winterstürmen aus Nordwest und Nordosten kämpfen: sie erreichen den Himmel nicht, sie winden sich in den abenteuerlichsten Gestalten, wie Schlangen, die mit einem gewaltigen Feind um ihr Leben ringen. Es war Wittekind immer ein wunderlicher, fast ergreifender Eindruck, diese ›Kämpfer‹ zu seh’n, die für den Säulenhain da hinter ihnen sich aufopfern; sie erschienen ihm wie die Vorkämpfer in wilden, werdenden Zeiten unserer Menschenvölker, denen die späteren Geschlechter ihr Wohlsein, ihre edlere Bildung, ihr friedliches Zusammenleben verdanken.
›Freilich‹, dachte er, als er an den Zickzackformen und Schlangenwindungen dieser Vorhut entlangschritt, – ›auch so zu kämpfen, für sich und die andern, ist schön! Lieber so ein „Barbar“ als ein Waldenburg sein; lieber der Sturmnacht die zerzauste Brust entgegenwerfen, um den Wald zu retten, als wie ein glattes, dünnes Schattenbäumchen „seinen Tag genießen“!‹
Mit solchen Gedanken beschäftigt hätte er fast überseh’n, dass hinter einigen dieser Vorkämpfer, auf einer dem Meer zugewendeten Bank, eine Dame saß, die über ein Buch hinwegträumte und dem vorübergehenden Wittekind mit den Augen folgte. Sie stieß aber einen Ton der Überraschung aus, der ihn zum Stehen brachte. Das unklare Gefühl, das ihn durchfuhr, hatte ihn nicht getäuscht. Die Gestalt erhob sich, und er erkannte Frau von Tarnow, deren freundliches, erstauntes Lächeln ihn begrüßte. Er erstaunte jedoch mehr als sie: denn sie hatte sich in dieser einen Woche verändert, sie war kaum mehr bleich zu nennen, die Wangen waren voller, das ganze Gesicht verjüngt. Sie lächelte von neuem, und zwar über seine Verwunderung, die sie wohl bemerkte. Dann trat sie ihm entgegen und reichte ihm die Hand.
»Ich freue mich, Sie zu seh’n«, sagte die schöne, tiefe Stimme, die ihm noch klangreicher und herzlicher erschien als beim ersten Begegnen. »Wie kommen Sie auf einmal hierher?«
»Ich bin in dieser Gegend zu Hause«, antwortete er; indem er das sagte, errötete er, ohne zu wissen, warum. »Ich bin hergesegelt … Also Sie wohnen hier? Sie mit Ihren Tilburgs?«
»Ja, und mit Herrn von Waldenburg«, sagte sie unbefangen. »Sie sehen mich noch immer so schrecklich verwundert an. Hatten Sie denn gedacht, ich werde und müsse immer so gespenstisch aussehen, wie damals in Grödig?«
»Nein – o nein —« erwiderte er verwirrt. »Aber dieses – außerordentliche Aufblühen – in so kurzer Zeit – —«
Sie sah mit einem trüben Lächeln vor sich hin, während ihr Sonnenschirm an einem der verrenkten Baumstämme bohrte.
»Nun«, sagte sie, – »ich bin noch jung. Allerlei Umstände hatten mich so kalkig, so alt gemacht. Hier am Strand, die Salzluft – oder – — Kurz, ich weiß nicht. Ich bin so furchtbar elastisch, lieber Herr Wittekind; bin nicht umzubringen!«
»Wie mich das freut«, murmelte er bewegt. Es tat ihm wohl, dieses ›lieber Herr Wittekind‹ zu hören; – dann aber dachte er plötzlich: ›So spricht eine junge Frau zu einem alten Mann!‹ – Er fühlte einen Druck in der Brust. Er blickte an Frau von Tarnows Gestalt hinunter; ein helles, leichtes Kleid umfloss sie, ein lederner Gürtel, wie damals, gab ihrem schlanken Wuchs das Mädchenhafte, das den großen, schicksalstraurigen Augen widersprach. Ihm war, als stünde da auf dem hohen Ufer die Jugend vor ihm; und als wolle sie nun von ihm Abschied nehmen…
Auf einmal überlief es ihn sonderbar, als Frau von Tarnow fragte:
»Und Ihr Sohn? Ihr Berthold? Wie geht es dem? – Ich hab’ oft an ihn denken müssen. Und wie glücklich Sie sind, so einen Sohn zu haben…«
Sie brach ab und blickte auf die See hinaus; ihre leicht gefärbten Wangen schienen wieder zu erblassen. Wittekind bemerkte das und war eine Weile still.
»Meinem Berthold«, sagte er endlich, »geht es wieder gut. – Ich danke Ihnen sehr – dass Sie ihn nicht vergessen … Sind Sie oft so allein am Meer?«
»O ja«, erwiderte sie. »Das ist mein Glück und meine Medizin.«
»Und kennen Sie auch den kleinen Spiegelsee, mitten im Wald? Der ist hier in der Nähe —«
»Gewiss«, sagte sie; »den kenn’ ich seit dem ersten Tag. Ich hab’ ihn gern; mit und ohne Sonne. Ich wäre vor Tisch auch noch hingegangen … Wollen Sie? – Oder wollten Sie allein —?«
»Nein«, erwiderte Wittekind rasch. »Wenn es Ihnen recht ist, dass ich Sie begleite —«
Sie lächelte ihn nur an, so liebenswürdig und gut, dass seine Beklemmung verschwand. Darauf gingen sie vorwärts, am Wald entlang, dann in ihn hinein. Sie erreichten bald ein Bächlein, das kein Wind bewegte, denn zwischen den Baumriesen lag es wie eingebettet, und floss so sacht, als rühre es sich gar nicht, dem unsichtbaren Strande zu. Man hatte es künstlich geleitet und eingefasst, und es fiel in Stufen; der seichte Grund war mit den dunklen Blättern vergangener Jahre bedeckt, und in dem tiefen Schatten schien das Wasser schwarz, nur wo einzelne Sonnenstrahlen hineinblitzten, zeigten sich die Blätter am Grund wie braunrötliche Flecken. Es stimmte schon träumerisch und feierlich, an diesem schwarzen Gewässer in dem hohen Buchen-Tempel hinzugeh’n. Als sie dann ins Lichte kamen, lag der ›Spiegelsee‹ da, zu dem der Bach sich verbreitete; ein kleines Grund, fast ebenso dunkel gefärbt, aber der ganze Wald spiegelte sich darin. Die von der hohen Sonne angestrahlten Stämme, die schönsten natürlichen Säulen, weißlich grau, von innerer Kraft geschwellt, von der widerstehenden Rinde wie von Eisen umschlossen, leuchteten wie regungslose, schlafende Schlangenleiber in der schwarzen Tiefe. Um sie her grünten goldig die gespiegelten Laubkronen, ein verzauberter, umgekehrter Wald. Der blaue Himmel leuchtete zwischen ihnen herauf.
»Ja, auch hier ist es schön«, sagte Frau von Tarnow, nachdem sie eine Weile beide geschwiegen hatten. »Aber, Herr Wittekind, – Sie sagten mir eigentlich noch nichts von Ihrem Sohn. Bei diesem heimlichen, märchenhaften See fällt er mir wieder ein … Nicht wahr – verzeihen Sie meine Offenheit – er ist auch so etwas Absonderliches, Wunderbares; ein märchenhafter Jüngling, in dieser nüchternen Welt. Wie wenn sich auch so ein fremder Himmel, eine höhere Welt in ihm spiegelte; – ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es gelingt mir nicht —«
»Doch!« sagte Wittekind lächelnd; »es gelingt Ihnen ganz gut. Und es rührt mich herzlich, wie schön Sie von ihm denken!«
Sie sah gedankenvoll auf den Wald da unten im Wasser; schmerzliche Gefühle, so schien es, spannten ihre Züge. Mit gesenkter Stimme sagte sie:
»Der wird der Welt nicht wehtun; aber die Welt ihm.«
»Ich fürchte auch«, erwiderte Wittekind. »Und sie werden sich beide nicht kennen: die Welt ihn nicht, und er nicht die Welt. Wüsst’ er nur so recht, was er in ihr will! – Leider hat er meine Freude am Landleben, am ›Wirtschaften‹ nicht geerbt.«—
»Ah!« sagte Frau von Tarnow, die schönen, dunklen Brauen emporziehend, »Sie sind Landmann?«
Er lächelte:
»Seh’n Sie mir das nicht an? – Allerdings bin ich nicht so eine richtige Feldmaus, sondern eine Art von Amphibie: leb’ auch viel auf dem Wasser; wie heute. So gehört mir die ganze Welt! Wird mir’s auf meiner Feldmark zu eng, so fahr’ ich auf die See hinaus; und versperrt mir der Winter das, so fahr’ ich in die Stadt – meine alte Vaterstat – die eine Meile von mir flussaufwärts liegt; oder noch vier, fünf Stunden weiter nach Berlin, wo ja jetzt die Bäume in den Himmel wachsen. Da saug’ ich mich dann voll, wie die Hummel auf dem Kleefeld, und kehre beladen und zufrieden in mein Nest zurück.«
Die junge Frau nickte; auf einer der Bänke, die am Ufer standen, hatte sie sich gesetzt und ihren Schirm in die Erde gebohrt.
»Sie haben recht«, sagte sie langsam. »So macht’ ich’s auch – wenn ich könnte. Zuweilen in die Welt hinein, und dann wieder heraus! – Ich hab’ nun so viel in großen Städten gelebt; am längsten in New York; in diesem ruhelosen Gewimmel dacht’ ich oft: wenn ich doch Farmer wäre! Besser war’s dann in Wien, und auch in .Berlin; aber das ganze Jahr, das ganze Leben —? Nein! Sich ›vollsaugen‹, wie Sie sagen, und dann wieder in die Einfachheit, den Frieden, die Sammlung zurück … Sammlung! Das schönste Wort!«
»Sie würden also gern auf dem Lande leben?«
»So wie Sie: mit Meer und Stadt! – — Aber nun seufzen Sie ja – und machen gar kein zufriedenes Gesicht.«
Wittekind erschrak. Hatte er geseufzt so dass sie es hörte? – Ihm war auf einmal wieder eine Schwere auf die Brust gefallen, ihre Worte, ihre Stimme gingen ihm durchs Herz. Und sie sagte doch nichts, das ihn nicht erfreute … Er sah ihr ins Gesicht. Dann bemühte er sich, so ruhig wie möglich zu erwidern:
»Ich dachte nur eben – dass ich einsam bin.«
»Sind Sie das? Dann bedaur’ ich Sie. – — Aber wie verschieden sind die Wünsche der Menschen. Ich wollte, ich könnte so einsam sein, wie Sie!«
Sie sagte das mit einem Lächeln, das ihn sehr ergriff. Ihre Wimpern zuckten. Wittekind stand noch immer, an die Bank gelehnt; er setzte sich nun auch und fasste sich ein Herz.
»Verzeihen Sie mir – oder gestatten Sie mir eine Frage —« sagte er, sich halb zu ihr wendend. »Nach allem, was Sie da sagen – — seien Sie mir nicht böse.«– —
»Sprechen Sie nur alles, was Sie denken.«
»Dies denk’ ich schon lange … ›Sammlung‹ sagten Sie. Wie halten Sie es dann bei diesen – Tilburgs aus? – Hab’ ich Sie verletzt?« fragte er, da sie eine Weile schwieg.
»O nein«, erwiderte sie, und ein Blick aus ihren großen Augen traf ihn, der für ihre Worte gut sagte. »Von Ihnen verletzt es mich nicht. Sie versteh’n das Fragen so gut; – ich nur nicht das Antworten. Wie ich es aushalte? – Ich will es Ihnen sagen. Dann aber, bitte, fragen Sie nicht weiter … Es ist schwer, sehr schwer; bei den Tilburgs, mein’ ich. Aber das will ich eben; das brauch’ ich. Nur eine schwere Aufgabe, eine große Anspannung – bei der ich mich fort und fort zum Opfer bringen muss – nur die kann mir das erschütterte Gleichgewicht zurückgeben… «
Sie brach ab. Mit fest geschlossenen Lippen starrte sie ins Wasser. Ihr Schirm schnellte ein Steinchen, das am Boden lag, in die dunkle Flut, so dass der gespiegelte Wald in Verwirrung geriet. Dann aber saß sie still.
Auch Wittekind schwieg.
›Ich wusst’ es‹, dachte er bewegt: ›sie hat viel erlebt…‹
Nur um von ihrem persönlichen Geschick hinweg wieder ins Allgemeine zu kommen, ergriff er endlich das Wort:
»Ja«, sagte er, »wie leicht man in diesem sogenannten ›Kampf ums Dasein‹ das Gleichgewicht verliert! Wie schwer es überhaupt ist, sich den Lebenstrieb, die Lebensfreude gegen die unzähligen Trübungen zu bewahren, die immer unterwegs sind: Sorge, Verdruss, Mitleid, Schicksale … Ich hab’ früh von meinem Vater gelernt, diesen Kampf zu kämpfen; meine gute Mutter war immer sorgenvoll, mein Vater hatte das göttliche Talent, jede gute Stunde gründlich zu genießen, jeden Druck wieder abzuschütteln. Aber er kämpfte auch redlich, wehrte sich mit Händen und Füßen gegen das Ermatten; – und da liegt eben unsere Pflicht. Wie ein Vogel, dem die Flügel gekürzt sind, muss man sich oft mit Gewalt vom Boden heben, sich in die Luft werfen, wenigstens eine Strecke weit – damit man doch von dem Fleck hinwegkommt, wo nicht gut atmen ist, oder ein Sumpf uns hinabzieh’n will. Über unsere kurzen Flügel dürfen wir wohl nicht klagen; der gute Wille macht sie länger, denk’ ich; und erkämpftes Glück ist ja doppeltes – wie des Soldaten Löhnung im Krieg!«
Die junge Frau sah ihn zustimmend, herzlich und dankbar an. Sie bewegte mehrmals die Lippen, doch ohne etwas zu sagen. Endlich brachte sie, mit wenig Stimme, wie ein junges Mädchen, hervor:
»Wie gern hör’ ich Sie so reden. Wie gut ist das. – Es tut mir so gut!«
Plötzlich aber sprang sie auf.
»Wieviel ist die Uhr?« fragte sie. »Verzeihen Sie«, setzte sie hinzu, »ich habe ja selber eine … Ich bin ganz verwirrt!« – Sie zog eine kleine goldene Uhr aus ihrem Gürtel hervor, sah auf das Zifferblatt und stampfte mit dem Fuß auf die Erde; die erste drollig heftige Bewegung, die Wittekind an ihr wahrnahm. »Ich wusst’ es ja!« sagte sie unwillig. »Ich muss fort!«
»Wohin?« fragte er erschrocken.
»Zu Tisch! – Wir essen heute beim Geheimrat Waldenburg; Graf Lana und die Gräfin auch…«
Ein helles, jugendliches Lächeln ging auf einmal über ihr Gesicht.
»Aber was tut das?« sagte sie. »Sie sind ja Herrn von Waldenburgs Freund, und Sie gehen mit.«
»Ich? – Liebe gnädige Frau – das ist eine Gesellschaft, in die ich, ehrlich gestanden —«
Aber sie unterbrach ihn, mit einem unerwartet mutwilligen, reizenden Ausdruck im Gesicht:
»Also liegt Ihnen nichts daran, mein Herr, noch länger mit mir zu sein? Ich freue mich darauf – verlängere meine kurzen Flügel, wie Sie es verlangen, werde mutig, unternehmend – werde offenherzig – und Sie wünschen sich’s nicht?«
»Aber was denken Sie«, entgegnete Wittekind, der über das ganze Gesicht wie ein Jüngling errötete; seine gebräunte, von Natur weiße Haut ward rosig angeflogen. »Ich, der ich von der ersten Stunde an – — und der ich heute nur – —«
Sie ließ ihn nicht ausreden:
»Gut, so gehen Sie mit! Überwinden Sie sich nur auch; ›erkämpftes Glück‹, wissen Sie, ›ist ja doppeltes.‹ Dem Geheimrat Waldenburg sind Sie sehr willkommen. Ich führe Sie quer durch den Wald!«