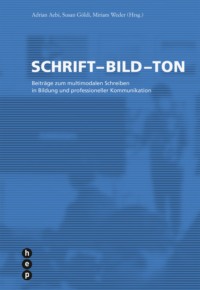Kitabı oku: «Schrift - Bild - Ton (E-Book)», sayfa 4
Final comments
This chapter has proposed a way of recognizing and analyzing resources drawn on in producing voice in a range of genres and modes. Voice is about negotiating amongst a set of choices. Allowing students the opportunity to work with various media can enable them to experiment with the properties of these and exploit their affordances in more mindful ways. To develop academic voice, students can be encouraged to recognize constraints – both working within them and using a variety of resources to counterbalance them. My aim has been partly to look for semiotic categories that work across modes in order to devise metalanguages for teaching and learning. These include the concepts of engagement; citation; provenance; transformation; transduction. Most importantly, a metalanguage gives one the tools to think about things in ways that we would not otherwise have had. In this sense metalanguages serve as a way of «verbalising what you know in relation to other ways of knowing» (Thesen 2001, 143). This is important for enabling student access into academic discourse. It can also have important implications for assessment practices. Effective teaching of writing and text construction in all its forms thus involves a dialogue between the culture and discourses of academia and those of students, offering students from diverse backgrounds an empowering and critical experience, not just pathways to established conventions.
References
Archer, A. (2010). Challenges and Potentials of Writing Centres in South African Tertiary Institutions. South African Journal of Higher Education, 24(4), 495–510.
Archer, A. (2013). Voice as Design: Exploring academic Voice in multimodal Texts in Higher Education. In M. Bock, & N. Pachler (Eds.), Multimodality and Social Semiosis. Communication, Meaning-Making, and Learning in the Work of Gunther Kress (pp. 150–161). New York and London: Routledge.
Archer, A. (2018). Academic Voice re-imag(in)ed: Interest and Design in Artwork and three dimensional Artefacts. Multimodal Communication, 7(1). Doi: https://doi.org/10.1515/mc-2017-0016
Archer, A., & Björkvall, A. (2018). Material Sign-Making in diverse Contexts: upcycled Artefacts as refracting global / local Discourses. In A. Sherris, & E. Adami (Eds.), Making Signs, translanguaging Ethnographies: Exploring urban, rural and educational Spaces (pp. 45–63). Clevedon: Multilingual Matters.
Bakhtin, M. (1981). From the Prehistory of novelistic Discourse. In M. Holquist (Ed. and trans.), The dialogic Imagination. Four Essays by M. Bakhtin (pp. 41–83). Austin: University of Texas Press.
Bell, S. (2016). Writing against formal Constraints in Art and Design: Making Words count. In A. Archer, & E. Breuer (Eds.), Multimodality in Higher Education (pp. 136–166). Leiden: Brill.
Björkvall, A. (2018). Critical Genre Analysis of Management Texts in the public Sector. Towards a theoretical and methodological Framework. In D. Wojahn, C. Seiler Brylla, & G. Westberg (Eds.), Kritiska text- och diskursstudier (pp. 57–80). Huddinge: Södertörns högskola.
Blommaert, J. (2005). Discourse. Cambridge: Cambridge University Press.
Clark, R., & Ivanicˇ, R. (1997). The Politics of Writing. London and New York: Routledge.
Cope, B., & Kalantzis, M. (Eds.) (1993). The Powers of Literacy. A Genre Approach to teaching Writing. London, Washington: Falmer Press.
Elbow, P. (2007). Voice in Writing again. Embracing Contraries. College English, 70(2), 168–188.
Huang, C., & Archer, A. (2014). Fluidity of modal Logics in the Translation of Manga: The Case of Kishimoto’s Naruto. Visual Communication, 13(4), 471–486. doi: https://doi.org/10.1177/1470357214541746.
Hyland, K. (1999). Disciplinary Discourses: Writer Stance in research Articles. In C. Candlin, & K. Hyland (Eds.), Writing: Texts, Processes and Practices (pp. 99–121). London and New York: Longman.
Kress, G. (2010). A Social Semiotic Approach to contemporary Communication. Oxon, New York: Routledge.
Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2001). Multimodal Discourse. The Modes and Media of contemporary Communication. London: Arnold.
Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2006). Reading Images. The Grammar of visual Design. London: Routledge.
Lea, M.R., & Street, B. (1998). Student Writing and Faculty Feedback in Higher Education: an academic Literacies Approach. Studies in Higher Education, 23(2), 157–165.
Prince, R., & Archer, A. (2014). Exploring academic Voice in multimodal quantitative Texts. Literacy and Numeracy studies, 22(1), 39–57.
Thesen, L. (2001). Modes, Literacies and Power: A University Case Study. Language and Education, 14(2 and 3), 132–145.
Thesen, L. (2014). Risk as productive: Working with Dilemmas in the Writing of Research. In L. Thesen, & L. Cooper (Eds.), Risk in Academic Writing. Postgraduate Students, their Teachers and the Making of Knowledge (pp. 1–24). Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters.
wa Thiong’o, N. (1986). Decolonizing the Mind. The Politics of Language in African Literature. London: James Curry.
Vermittlung multimodaler Textkompetenz: Ein Erfahrungsbericht
Ursina Kellerhals, Vinzenz Rast
Visualisieren als wiederentdeckte Kulturtechnik
Die Bedeutung visueller Elemente in der schriftlichen Alltagskommunikation – Bild oder Bewegtbild – ist über die letzten zwei Jahrzehnte stark gewachsen. Haben wir früher vor allem über unsere Handschrift und mehr oder weniger fehlerlose Typoskripte immer auch visuelle Information vermittelt, bleibt heute fast keine Botschaft mehr ohne Illustration, Fotografie oder Film: Emojis ergänzen Text in Whatsapp, Posts in Instagram verzichten oft ganz auf Text, im Buhlen um Aufmerksamkeit werden Texte auf Twitter oder LinkedIn mit animierten Bildern auffällig gemacht.
Multimodales Schreiben gehört heute zu unseren gesellschaftlichen Grundkompetenzen und somit zu den Fertigkeiten, die von Studienabgängerinnen und -abgängern erwartet werden. Neben Schreiben und Reden muss auch Visualisieren in Ausbildungen integriert werden.
In journalistischen Texten hat das Bild – auch das Bewegtbild – schon lange einen festen Platz. Dieses Phänomen kann am Beispiel der New York Times gezeigt werden.1 Nachdem die erste Ausgabe am 18. September 1851 erscheint, dauert es mehr als 60 Jahre bis zum ersten Bild auf der Titelseite. Mitte des 20. Jahrhunderts werden die Bilder fester Bestandteil. Ab 1997 sind sie dann auch in Farbe (Jobson 2017).
Die Wichtigkeit des Bildes sowie das Zusammenspiel von Bild- und Textelementen finden in der Werbeforschung wie auch in der linguistischen Analyse von Werbetexten schon länger Beachtung (Leech 1966; Dyer 1982; Vestergaard & Schrøder 1986; Janich 2001; Kellerhals 2008; Stöckl 2012 und andere). Hier gehen die Untersuchungen (meist implizit) davon aus, dass die multimodalen Texte von Spezialistinnen und Spezialisten entwickelt und erstellt werden.
Zu beobachten ist, dass vermehrt – bei privaten wie auch bei professionell eingesetzten Texten – statt statische Bilder Bewegtbilder (Gifs, kurze Filmsequenzen) verwendet werden. Auch im Bereich Infografik werden je länger, je häufiger animierte Diagramme eingesetzt.
Das Erstellen – oder Schreiben – multimodaler Texte muss gelernt sein. Auch visuelle Kommunikation hat ihre Regeln, die wir beim Lesen anwenden, derer wir uns aber meist wenig bewusst sind. Wir nehmen Bilder rascher auf als Sätze. Irrtümer können sich – zum Beispiel in Diagrammen – schneller verbreiten, weil der fehlerhafte Inhalt im Bild unmittelbarer und intuitiver wahrgenommen wird. Dies zeigt sich zum Beispiel an der Illustration zu einem Artikel auf einem Hochschul-Blog, die wir aus Anonymitätsgründen nachgezeichnet haben (vgl. Abbildung 7). Hier war vermutlich der Wunsch nach Gefälligkeit oder Unterhaltung der Stolperstein, was im Übrigen in Infografiken sehr oft zu beobachten ist.

Abbildung 7: Design als Stolperfalle (anonymisierte Verfremdung des Originals)
Dreidimensionale Darstellungen sind zwar schön, aber das Volumen der Pyramiden entspricht nicht den in der Studie erhobenen Unterschieden zwischen 21,4 Prozent, 22,2 Prozent und 56,4 Prozent. Die Visualisierung ist überzeichnet. Und die Schatten verstärken den falschen Eindruck weiter; auch die Schattenflächen geben das Verhältnis nicht korrekt wieder.
Ansprechendes Design ist wichtig heutzutage, aber noch wichtiger wäre die Einhaltung eines visuellen Regelwerks, das im Gegensatz zu Wörterbüchern und Regelgrammatiken bei der nichtvisuellen Sprache fehlt. Man könnte aber – basierend auf mathematisch-geometrischen und statistischen Regeln oder anhand von gestalterischen Grundsätzen – durchaus Normen und Richtlinien formulieren und diese auch analogen Kategorien zu Orthografie, Grammatik, textlichen oder stilistischen Aspekten zuordnen. Und der angemessene Umgang mit einem solchen visuellen Regelwerk wäre als Kompetenz in die Ausbildung zu integrieren.
Die Vermittlung von Textkompetenz bedeutet also die Vermittlung des Schreibens multimodaler Texte. Das Kompetenzzentrum Business Communication der Hochschule Luzern ist bestrebt, diesem Bedürfnis mit neuen Ausbildungsinhalten nachzukommen. Multimodales Schreiben gehört zum Studium, um den erfolgreichen Einstieg der Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Luzern in die Arbeitswelt zu sichern.
Der folgende Bericht soll Einblick in unsere Erfahrungen mit dem Unterricht in visueller Kommunikation geben. Wir berichten dabei primär über didaktische Stolpersteine und unsere Erkenntnisse daraus. Damit erhoffen wir uns, andere bei der Vermittlung von multimodalem Schreiben unterstützen zu können.
Visual Communication in Corporate Contexts – ein neu konzipiertes Modul
Der vorliegende Erfahrungsbericht bezieht sich ausschließlich auf ein neu konzipiertes Modul im englischsprachigen Studiengang International Bachelor of Business Administration an der Hochschule Luzern – Wirtschaft. Dieses Modul namens Visual Communication in Corporate Contexts legt seinen Schwerpunkt explizit auf die Vermittlung von Textkompetenz, die konsequent multimodal ist.
Das 14-wöchige Modul ist aus drei Sequenzen aufgebaut. Die erste widmet sich Bild-Text-Kompositionen und darauf aufbauend den Produktverpackungen bzw. -etiketten. Die zweite Sequenz hat Infografiken zum Thema. Im dritten Teil werden die Studierenden angeleitet, wie ein Erklärvideo aufgebaut und umgesetzt wird.
Mit dem ersten Thema können wir so an ein vorangehendes Modul anknüpfen, in dem multimodale Werbetexte analysiert werden. Ebenso war uns bei der Konzeption wichtig, das bewegte Bild miteinzubeziehen, weil dieses an Wichtigkeit gewinnt. Das zeigt sich zum Beispiel auf Social-Media-Kanälen oder auch darin, dass schriftliche Bedienungsanleitungen durch Online-Erklärvideos ersetzt werden. Wir können das auch an unserem eigenen Verhalten beobachten. Wie schnell ist ein Online-Tutorial gefunden, nahezu zu jedem Problem (Batteriewechsel des Autoschlüssels, Fragen zu Softwarenutzung, das perfekte Soufflé backen etc.). In den einzelnen Apps der Adobe-Suite, die man inzwischen nur noch mieten kann, sind Tutorials direkt in die Software eingebaut. Nur so können diese mit den immer kürzeren Entwicklungszyklen überhaupt aktuell bleiben. Gedruckte Anleitungen beziehungsweise Bücher zur Nutzung der Adobe-Programme wären am Tag des Erscheinens wieder veraltet.
Die mittlere Sequenz – Infografiken – betrifft ein Genre der visuellen Kommunikation, dessen Einbezug in unsere Ausbildungsgänge auch deshalb wichtig ist, weil seine Komplexität oftmals unterschätzt wird. Zudem wird in den verschiedensten Bereichen vermehrt mit Erkenntnissen aus Daten gearbeitet, die natürlich häufig grafisch aufbereitet werden.
In jeder der Sequenzen erarbeiten die Studierenden je ein multimodales Produkt. Die Ergebnisse werden Ende Semester in einem Leistungsnachweis-Portfolio zusammengestellt und reflektiert.
Die erste Durchführung des Moduls zeigte deutlich, dass der Infografik-Teil die größte didaktische Herausforderung darstellt. Aus diesem Grund fokussieren wir in unserem Erfahrungsbericht auf diese Sequenz.
Visualisieren mit Infografiken
Datenvisualisierung kann zwei Ziele verfolgen: In den meisten Fällen sollen Erkenntnisse aus Daten visuell kommuniziert werden. Das Abfüllen von Daten in Grafiken kann aber auch der Analyse selbst dienen, weil Erkenntnisse, die in den Daten versteckt sind, rascher erkennbar werden. Diese zweite Funktion der Datenvisualisierung wird in der Lernsequenz jedoch bewusst ausgeklammert, weil der Fokus auf der Sensibilisierung für die Wahl und korrekte Anwendung des richtigen Charts für spezifische Aussagen sowie dem Vermitteln von Botschaften mit Grafiken liegen soll.
Für die Infografik-Vermittlungssequenz stehen drei zweistündige Sitzungen zur Verfügung, die im Wochenrhythmus stattfinden. Nach einem kurzen theoretischen Input zu verschiedenen Diagrammen, ihren Funktionen und einem Einblick in erste sich durchsetzende Normen- und Regelwerke zur Datenvisualisierung basierend auf McCandless (2012 und o.J.), Tufte (2001) oder Wong (2010), folgt ein kurzer Vertiefungsschritt. Danach erhalten die Studierenden den Auftrag, ein Set von drei Infografiken auf Basis eines selbst gewählten Datensatzes zu erstellen, um eine Gesamtbotschaft zum Ausdruck zu bringen. Als Datenfundus dienen die online zugänglichen Statistiken der OECD (OECD o.J.; OECD – Better Life Index, o.J.). Die Studierenden arbeiten an dieser Aufgabe in mehreren Arbeitsdurchgängen und erhalten regelmäßig Feedback. Die finalisierte Version ist Bestandteil des Portfolios, welches kurz nach Semesterende eingereicht wird und 50 Prozent der Gesamtnote der Modulbewertung ausmacht.
Im Folgenden wird der Aufbau der Sequenz in der ersten Durchführung im Frühlingssemester 2018 beschrieben. Diese fand mit zwei Halbklassen bestehend aus 18 respektive 17 Studierenden statt.
In der ersten Sitzung wurden die Studierenden ins Thema eingeführt und erhielten eine Übersicht über Chart-Typen, ihre Funktionen und mögliche Fehlerquellen. Der Theorie-Input wurde mit konkreten Fällen (und publizierten fehlerhaften Grafiken) aus Medienberichten und Studien unterlegt, welche die Studierenden in Gruppen diskutierten. Dieser Schritt diente zur Vertiefung und Schärfung des Bewusstseins für diagrammtypische Fallstricke.
Danach wurde die Aufgabe der Sequenz (vgl. oben) eingeführt und die Datensätze vorgestellt (OECD o.J.). Die Studierenden sollten nun in den Datensätzen nach ihrer Botschaft, ihrer Geschichte suchen. Sie begannen während der ersten Sitzung mit dieser Suche und hatten die Aufgabe, sich bis zur nächsten Sitzung weiter mit den Datensätzen und möglichen Themen auseinanderzusetzen und ihre Botschaft zu entwickeln.
Die zweite Sitzung war die erste von insgesamt zwei Werkstattsequenzen. Die Studierenden präsentierten ihre Projekte und erhielten Rückmeldungen aus der Klasse und von der Dozentin. Nachdem sie ihre Ideen für ihre Botschaft vorgestellt und die dazugehörigen Datensätze benannt hatten, begannen sie mit den Visualisierungen. Vor diesem Arbeitsschritt wurde – um Unsicherheiten vorwegzunehmen – der ganze Entwicklungsprozess von der Auswahl der Daten über die Formulierung einer Botschaft bis hin zur Visualisierung anhand einer Beispiellösung aufgezeigt.
Die Studierenden sollten ihre Visualisierungen in einem ersten Schritt skizzieren und danach mithilfe von Software-Tools erstellen.2 Sollte eine Grafik zu komplex sein, um sie grafisch im zur Verfügung stehenden Zeitraum umsetzen zu können, waren auch Handskizzen in der Endversion erlaubt. Während der Werkstattsitzung unterstützte die Dozentin Studierende individuell und half bei Fragen zu Datensätzen, Darstellungsformen und Aufgabenstellung.
Zwischen den beiden Werkstattsitzungen hatten die Studierenden den Auftrag, die erste Version ihrer drei Diagramme fertigzustellen und diese auf einen Modul-internen Wordpress-Blog hochzuladen, sodass die Studierenden den Stand der Projekte innerhalb der Klasse einsehen und – in der Sitzung dann – unkompliziert dem Plenum präsentieren konnten. Dort sollten die Studierenden den Erstellungsprozess kommentieren sowie über die Schwierigkeiten und ihrem Umgang damit Auskunft geben.
In der Werkstatt arbeiteten die Studierenden dann in Paaren und wendeten die Methode des lauten Denkens an. Diese qualitative Methode, die in den Sozialwissenschaften und der Pädagogik entwickelt wurde, wird inzwischen auch in Usability-Tests bei der Softwareentwicklung angewendet (Hofmann 2017). Hofmann (2017, Abs. 1) beschreibt die Methode wie folgt: «Das Laute Denken ist eine Methode, die verwendet wird, um kognitive Vorgänge erfassbar zu machen, die sonst implizit und damit unausgesprochen bleiben.» Mit der Methode kann der Decodierungsprozess überprüft werden. Werden die visuellen Aussagen Außenstehenden sofort klar oder muss die Kommunikation noch geschärft werden? Besteht Bedeutungsverwirrung beziehungsweise müssen die Inhalte eindeutiger aufbereitet werden? Mit diesen Rückmeldungen und dem Klären abschließender individueller Fragen wurde die Sequenz abgeschlossen. Die Dozentin gab den Studierenden noch die in Abbildung 8 gezeigte Checkliste mit zur selbstständigen Finalisierung der Infografik-Sets fürs Semesterabschluss-Portfolio.
Die Aufgabe beinhaltet mindestens eine Grafik, die flächenproportional (area-proportionate) ist. Der Grund für diesen Zusatz liegt darin, dass oftmals gegen mathematisch-geometrische Regeln verstoßen wird, wenn – teils aus Gründen der Ästhetik – die Daten zwei- oder dreidimensional dargestellt werden. Ein Beispiel für diese Erscheinung wurde eingangs erwähnt (Abbildung 7), wo das Volumen der Pyramiden eine viel größere Menge suggeriert als die, die dargestellt werden sollte. Die Schwierigkeiten bestehen aber auch im zweidimensionalen Raum, wenn Flächen einen Datenpunkt darstellen. Je nach Diagrammtyp gibt es bei Flächendiagrammen zusätzliche Restriktionen. Kuchen- oder Baumdiagramme3 eignen sich nur für abgeschlossene Mengen (100 Prozent). Anteile der Fläche werden dann einzelnen Kategorien zugeordnet.

Abbildung 8: Checkliste Sequenz Infografik
Die Studierenden sollten weiter nicht einfach beschreibende Überschriften, sondern aussagekräftige Headlines für ihre drei Grafiken finden. So wurden sie gezwungen, in ihren ausgewählten Datensätzen ihre Botschaften oder eben ihre Geschichte zu finden. Wie weiter unten ausgeführt wird, stellte dieser Teil der Aufgabe eine besondere Herausforderung dar. Weitere Punkte der Checkliste entsprechen den diskutierten visuellen Regeln, so zum Beispiel das Überprüfen nach grafischen Redundanzen. Jedes Element einer Grafik muss eine Funktion erfüllen, sonst ist es überflüssig und stört die Ästhetik oder verwirrt beim Lesen. Tufte (2001, S. 51) bringt dies auf den Punkt mit seinem grafischen Prinzip: «Graphical excellence is that which gives to the viewer the greatest number of ideas in the shortest time with the least ink in the smallest space.»
Wie oben erwähnt, fand diese Überprüfungsschlaufe im Selbststudium während des restlichen Semesters statt. In den Abschluss-Portfolios ergänzten die Studierenden ihre überarbeiteten Diagramme mit einem kurzen Text, in dem sie den kreativen Prozess beschrieben und reflektierten.
Fragestellung und Vorgehen
Schon beim Konzipieren des Moduls waren wir uns der hohen Anforderungen an die Eingangskompetenzen der Studierenden bewusst. Was bringen die Studierenden an mathematischen Fähigkeiten mit? Sind sie im Umgang mit Daten geübt? Inwiefern sind sie sich intuitiv der verschiedenen Funktionen der Chart-Typen bewusst? Zudem wird der Studiengang oftmals von Austauschstudierenden4 mitbelegt, deren detaillierte Eingangskompetenzen noch schwieriger einschätzbar sind. Aus diesem Grund war es für uns wichtig, die Erfahrungen der ersten Durchführung festzuhalten und – auf der Basis der Ergebnisse – für die didaktische Verbesserung des Moduls zu nutzen. Neben den Beobachtungen durch die Dozierende selbst wurden die Werkstattsitzungen von einem weiteren Dozenten besucht. Er war bestrebt, als teilnehmender Beobachter möglichst viele Aspekte der Lerndynamik festzuhalten. In den Resultaten unten werden diese Beobachtungen beschrieben und diskutiert. Die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen dienen einerseits der Optimierung des Moduls (insbesondere der Sequenz Infografik), sind aber auch als Tipps für Lehrende gedacht, die multimodales Schreiben unterrichten (wollen).