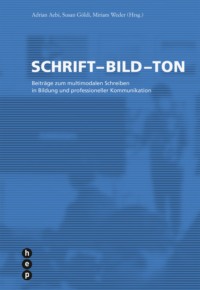Kitabı oku: «Schrift - Bild - Ton (E-Book)», sayfa 5
Resultate – Beobachtungen und erstellte Diagramme
Im Folgenden beschreiben wir die Beobachtungen der beiden Werkstattsitzungen und spiegeln diese an den – überarbeiteten – Diagrammen, welche die Studierenden als Teil ihres Leistungsnachweis-Portfolios am Ende des Semesters einreichten.
Beobachtungen aus den beiden Werkstattsitzungen
In den beiden Werkstattsitzungen fiel auf, dass vielen Studierenden mathematisches Basiswissen fehlt. So bereitete es unerwartet große Schwierigkeiten, Zahlen zwei- oder dreidimensional richtig darzustellen, wie zum Beispiel bei der Verwendung von flächenproportionalen Darstellungen.
Trotz des Vorbereitungsauftrags fiel es den meisten Studierenden zudem schwer, Themen zu finden und darin Botschaften zu erkennen. Da sie ohne diese Konzeptionsphase begannen, Datensätze in Diagramme zu fassen, hatten sie Mühe mit dem Auftrag, die Aussage einer Grafik auf eine Headline zu verdichten. Das Finden und Aufarbeiten von (zusammenhängenden) Informationen zu Botschaften – also der journalistische Umgang mit den Datensätzen – stellte sich als sehr viel anspruchsvoller dar als erwartet.
Insgesamt stellte der teilnehmende Beobachter fest, dass die Studierenden sehr unterschiedlich vorgingen. Wie oben erwähnt, waren sie teilweise gegenüber den Datensatz-Tabellen ratlos und suchten Inspiration bei bestehenden Infografiken. Kaum jemand setzte Skizzen ein. Diagrammfunktionen in unterschiedlichen Software-Tools wurden oftmals im Trial-and-Error-Verfahren eingesetzt. Gefiel ein ansehnliches Ergebnis, wurde dieses kaum mehr infrage gestellt.
Oftmals schien auch eine Vorstellung vom Diagramm zu bestehen, bevor Thema und Botschaft gefunden worden waren, zum Beispiel wenn Studierende mit Landkartendiagrammen arbeiteten. Die Diagramme an sich genügten ihnen, obwohl sie inhaltlich nicht Bestandteil des abzuliefernden Diagrammsets (geschweige denn einer kohärenten Botschaft) waren. In einzelnen Fällen wurden Darstellungen, welche die Statistik-Plattformen (OECD o.J.; Statista o.J.) schon aufbereitet anbieten, als Inspiration genutzt, was teils zu einer gefährlichen Nähe zum Plagiat führte.
Einzelne Austauschstudierende nutzten die Zeit in den Werkstattsequenzen wenig zielführend und gaben sich zu früh mit inhaltsarmen, rasch erstellten Diagrammen zufrieden. Der Gruppendynamik war dies nicht zuträglich. Diesen voreiligen Fokus auf die Tools konnten wir oft, aber nicht systematisch beobachten. Er führte auch zu falschen Anwendungen im Bereich flächenproportionaler Grafiken (zum Beispiel Baumdiagramme für nicht abgeschlossene Mengen).
Auffallend waren auch der unsichere Umgang mit Zahlen und Diagrammen und die mangelhafte Überprüfung der scheinbar perfekten Entwürfe. Deren teils verführerisch professionellem Design, das diese Hilfsmittel generieren, steht insgesamt ein wenig gefestigtes mathematisches Verständnis gegenüber, mit dem die aufbereiteten Zahlenzusammenhänge überprüft werden müssen. So wurden zum Beispiel absolute Zahlen angeführt, wo wenn überhaupt nur Anteilswerte verglichen werden konnten. Oder die Ergebnisse wurden keinem Realitätstest unterzogen. Ein simpler Plausibilitätstest – also mit etwas Abstand das Dargestellte betrachten und sich fragen, ob das überhaupt sein kann oder ob das überhaupt Sinn ergibt – wurde nicht ausgeführt.
Finalisierte Diagramme der Studierenden
Betrachten wir die von den Studierenden kreierten Produkte, so widerspiegeln diese teils die oben beschriebenen Schwierigkeiten. Es finden sich aber auch gelungene Botschaften in den Diagrammen. Zur Illustration der Ergebnisse führen wir unten exemplarisch drei Diagramme an.
Im ersten Beispiel (vgl. Abbildung 9) ist die Headline stimmig; auch im Set ist das Diagramm sinnvoll, da die Studentin in allen Grafiken auf Gesundheitskosten (hier relativ zum Bruttosozialprodukt eines Landes) der OECD-Staaten fokussiert. Ebenso gibt sie die Datenquelle an. Einziger Kritikpunkt ist, dass das Diagramm der Musterlösung, die im Unterricht vorgestellt worden war, formal sehr ähnlich ist. Aber die Studentin hat in den Daten ihre eigene Botschaft gesucht und gefunden.
Abbildung 9: Beispiel aus den Studierendenportfolios – gelungen
Weniger gelungen ist das Beispiel in Abbildung 10. Die Headline passt nicht zu den Zahlen. Entwicklungen werden üblicherweise als Liniendiagramme dargestellt, wobei der Zeitraum von 2012 bis 2015 zu kurz ist, um die Entwicklung der Lebenserwartung aussagekräftig darzustellen. Das verwendete Säulendiagramm zeigt auch nur einen Ausschnitt der Y-Achse an, was zu einer visuellen Überhöhung der Unterschiede führt. Hier zeigt sich zudem die Schwierigkeit, Diagramme richtig zu interpretieren oder – vice versa – die gefundene Botschaft mit den richtigen Datendarstellungen zu untermauern. So stellt das Diagramm nur Daten des einen inhaltlichen Aspekts dar, während die Headline zwei Themen in Zusammenhang bringt.

Abbildung 10: Beispiel aus den Studierendenportfolios – misslungen
Abbildung 10 illustriert weiter eine zentrale Stolperfalle im Umgang mit Daten: Die Korrelation von Daten können einen vermeintlichen Zusammenhang insinuieren. Über die Qualität der Abhängigkeit sagt statistische Korrelation jedoch nichts aus. Trotzdem geschieht es häufig, dass wir in diesen Fällen fälschlicherweise Kausalität ableiten, was dann die Interpretation der Daten entsprechend verzerrt oder gar falsch ausfallen lässt.
Neben der Schwierigkeit mit den Inhalten zeigen einige Beispiele aus den Portfolios fehlende Überprüfung der Daten bzw. der mathematischen Zusammenhänge. Das dritte Beispiel (vgl. Abbildung 11) illustriert die falsche Verwendung eines Baumdiagrammes, das trotz der Diskussionen während der Werkstattsitzungen in einem der Portfolios doch so verwendet wurde.

Abbildung 11: Beispiel aus den Studierendenportfolios – falsche Flächenproportionalität
Flächenproportionale Grafiken wie dieses Baumdiagramm eignen sich, um die Anteile der Kategorien (hier Länder) an einer geschlossenen Menge aufzuzeigen. Geht es jedoch um den Vergleich von Länderkennzahlen, so muss man die Flächen auch visuell möglichst vergleichbar gestalten, sprich unterschiedlich große Quadrate, Kreise oder Balken mit gleicher Breite nebeneinander reihen. Die ausgewählten Kennzahlen geben zwar relative Zahlen wieder, bilden in der Summe aber keine Gesamtheit, was jedoch durch den gewählten Diagrammtyp suggeriert wird. Weitere Schwächen des Beispiels sind fehlende Zahlen zu den Teilflächen sowie eine rein zufällige, nicht funktional begründete Farbgebung.
Neben den gelungenen und den misslungenen Diagrammen wurden in Einzelfällen auch substanzarme Diagrammsets abgeliefert, besonders von jenen Studierenden, die sich schon während des Werkstattunterrichts kaum auf die Arbeit an den Aufgaben einließen.
Learnings für die Überarbeitung der Sequenz und des Moduls insgesamt
Die erste Durchführung des Moduls hat gezeigt, dass unsere Studierenden in ihrem Umgang mit Diagrammen unsicher sind. Es fällt ihnen schwer, Daten zu lesen, sie flüchten sich rasch in elektronische Tools oder sie unterschätzen die Komplexität der Aufgabe. Die Hilfsmittel nehmen es den Autorinnen und Autoren nicht ab, vorgängig Inhalte zu erarbeiten, sprich, die Themen und Botschaften zu finden und die Visualisierung zu konzipieren. Die Darstellungen mögen zwar schön aussehen, inhaltlich können sie aber nichtssagend bis falsch sein. Hier zeigt sich weiter, dass für solche Visualisierungen ein mathematisches Basiswissen, etwas Erfahrung im Umgang mit Daten sowie ein Gespür für Datenqualität nötig sind. Das erste Learning ist also, dass das Modul einem Bedarf der Studierenden entspricht.
Die zweite Erkenntnis ist, dass die Studierenden in der Sequenz Infografik überfordert wurden. Die Aufgabe war zu wenig strukturiert, sowohl in Bezug auf den Umgang mit Datenmaterial wie auch in der Erarbeitung der visuellen Darstellung der Information. Folgende didaktische Anpassungen sind daher nötig:
Die Sequenz muss zusätzlich strukturiert werden. Es braucht eine Trennung zwischen den Arbeitsschritten: Zuerst ist der Inhalt zu entwickeln (Thema wählen, Daten sichten, Botschaft erkennen), auf dessen Basis dann die Visualisierung konzipiert wird. Dann sollen die Zahlen aufbereitet und gestaltet werden. Erst in dieser zweiten Phase geht es darum, Tools kennenzulernen und richtig anzuwenden. Davor müssen diese noch ausgeschlossen werden. Die Visualisierung wird idealerweise zuerst von Hand skizziert.
Didaktisch ist es geschickter, wenn Erfolgserlebnisse eingebaut werden. Der Auftrag muss in kleinere Arbeitspakete gebündelt werden. Anhand dieser kann die Dozentin oder der Dozent konsequenter durch den gesamten Auftrag führen. So werden auch Zwischenerfolge für die Studierenden möglich, was für sie befriedigender ist und den Lernerfolg erhöhen dürfte.
Obwohl die Aufgabe insgesamt sehr schwierig angelegt war, wurde sie dennoch von vielen Studierenden unterschätzt. Mit modernen Tools können mit nur wenigen Klicks grafisch sehr ansprechende Diagramme erstellt werden. Für die Lernsequenz bedeutet dies, dass die Komplexität der Aufgabe mit den Studierenden besser reflektiert werden sollte. Gute Infografiken sind aufwendig und anspruchsvoll. In der Übungssequenz sollten neben der Diskussion von problematischen Beispielen auch gelungene, anspruchsvolle Beispiele in ihrer Komplexität von den Studierenden analysiert werden.
Die Voraussetzung an mathematisches Grundwissen und das nötige Bewusstsein für den Umgang mit Zahlen muss mitbedacht werden. Allenfalls sind individualisierte Tutorials während der Werkstatt einzubauen, in denen Studierende mit mangelnden Vorkenntnissen unterstützt werden können. Weiter ist die Konzeptions- und Strukturierungsphase zentral für die Qualität des Schlussresultats. Studierende unterschätzen die Wichtigkeit der Planung und beginnen zu schnell mit Umsetzungen.
Motivierende Rückmeldungen der Studierenden
Die gesamthafte Bewertung der Studierenden nach Abschluss des Moduls war äußerst positiv. Sie beurteilten den Kurs als sehr praxisrelevant, lehrreich und spannend. Dies war für die Dozierende umso erfreulicher, als die Infografik-Sequenz noch didaktische Mängel aufwies. Die Erkenntnisse aus der teilnehmenden Beobachtung während der Workshops und die Reflexion der Resultate haben zentrale Schwachstellen in der Sequenz Infografik aufgezeigt und wichtige Impulse gegeben, um das Modul für seine nächste Durchführung zu verbessern.
Literatur und Tools
Begley, J. (2017). Every NYT Front Page since 1852. Abgerufen von https://: vimeo.com/204951759
Dyer, G. (1982). Advertising as Communication. London: Methuen.
Hofmann, M. (2017). Die Erhebungsmethode des Lauten Denkens. QUASUS. Methoden qualitativer Sozial-, Unterrichts- und Schulforschung. Abgerufen von https://quasus.ph-freiburg.de/2217-2/
Janich, N. (2001). Werbesprache: Ein Arbeitsbuch (4. Auflage). Tübingen: Narr.
Jobson, C. (2017). The Rise of the Image: Every NY Times Front Page since 1852 in Under a Minute. Abgerufen von https://www.thisiscolossal.com/2017/02/the-rise-of-the-image-every-ny-times-front-page-since-1852-in-under-a-minute/
Kellerhals, U. (2008). «There is no better way to fly.» Die Wirkung englischer Slogans in der Deutschschweizer Anzeigenwerbung. Zürich: Rüegger.
Leech, G.N. (1966). English in Advertising: A linguistic Study of Advertising in Great Britain. London: Longman.
McCandless, D. (2012). Information is Beautiful (2. Auflage). London: William Collins.
McCandless, D. (o. J.) Infografik-Beispiele. Abgerufen am 20.5.2019 von https://informationisbeautiful.net/
N.N. (2016). Wie die Medien über den 11. September 2001 berichteten. Abgerufen von https://www.sueddeutsche.de/politik/presseschau-zu-so-titelte-die-presse-ueber-den-terror-am-september-1.3150143-6
OECD (o.J.). Statistiken der OECD-Länder. Abgerufen von https://stats.oecd.org/
OECD Better Life Index (o.J.). Better Life Index. Abgerufen von http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111
Statista (o.J.). Statistikportal Deutschland. Abgerufen von https://de.statista.com/.
Stöckl, H. (2012). Werbekommunikation semiotisch. In N. Janich (Hrsg.), Handbuch Werbekommunikation. Sprachwissenschaftliche und interdisziplinäre Zugänge (S. 243 – 262). Tübingen: UTB Francke.
Tufte, E.R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information (2. Auflage). Cheshire: Graphics Press.
Wong, D.M. (2010). The Wall Street Journal Guide to Information Graphics: The Dos and Don’ts of Presenting Data, Facts, and Figures. New York: Norton.
Vestergaard, T., & Schroeder, K. (1985). The Language of Advertising. Bd. 9: Language in Society. Oxford: Basil Blackwell.
Poster im Hochschulkontext: Multimodalität gezielt ausschöpfen
Roswitha Dubach, Anita Gertiser, Ruth Wiederkehr
Einführung
Poster sind ein zentrales Medium für Forscherinnen, Forscher und Studierende, um die wichtigsten Resultate ihrer Studien an Konferenzen und Ausstellungen zu präsentieren. Mit visuell attraktiven Elementen und fokussiertem sowie aussagekräftigem Text sollen Poster von ihrem Inhalt überzeugen und die Adressierten in einen wissenschaftlichen Diskurs einbinden.
Poster sind per se multimodal (Ball & Charlton 2015, S. 42). Elemente wie Titel, Fotos, Grafiken, Schemata, Textblöcke übernehmen in Postern verschiedene Funktionen und sollen sich inhaltlich ergänzen. Diese Funktionen beziehungsweise funktionalen Handlungsabschnitte sind dabei durch verschiedene Modalitäten realisiert, in einem Poster entweder durch Sprache oder durch Visualisierungen. Im Idealfall werden diese funktionalen Handlungsabschnitte sinnstiftend verknüpft und nutzen das multimodale Potenzial für das meaning making. So kann das breite Publikum trotz unterschiedlichen Wissensständen und unterschiedlichen Intentionen bei der Poster-Session angesprochen werden (Archer & Breuer 2015, S. 2 f. und 9).
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, sinnstiftende Verknüpfungen in Postern zu beschreiben und aus den Ergebnissen Erkenntnisse für die Lehre abzuleiten. Denn bisher enthalten Studienratgeber zu Postern kaum Hinweise auf explizite Verknüpfungen zwischen (visuellen und textlichen) Handlungsabschnitten, auch wenn sie das Zusammenspiel von Bild und Text erwähnen (vgl. beispielsweise Foster 2017, S. 294 f.). Gemäß Hartmut Stöckl haben solche Analysen Pioniercharakter, da sinnstiftende Verknüpfungen und Verknüpfungsmuster «in multimodalen Gesamttexten» bisher «unzureichend beschrieben» worden sind (Stöckl 2016, S. 4).
Die Basis der Analyse bilden 45 Poster zu Diplomarbeiten (Thesen) an der Hochschule für Technik der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Sie wurden im Rahmen einer öffentlichen Postersession präsentiert und nach engen Formatvorgaben (Templates) erstellt. Als Analysemodell dient die «multimodale Textanalyse» von Hartmut Stöckl (Stöckl 2016). Für die Bild-Text-Beziehungen stützt sich die Analyse zusätzlich auf die Erkenntnisse Kerstin Alexanders zur visuellen Kommunikation im technischen Umfeld (Alexander 2013, S. 63–80).
In einem ersten Schritt werden die Posterelemente definiert, zweitens erfolgt die Benennung der Funktionen der Elemente. Schließlich beschreibt diese Untersuchung, wie die einzelnen Funktionen zu sinnhaften Aussagen verknüpft werden und welche Folgerungen daraus für die Lehre im Bereich Poster gezogen werden können.
Korpus und Posterelemente
In Postersessionen zeigt sich, dass auditive Elemente wie die gesprochene Sprache und Geräusche elementar sind für die Sinnübertragung. Durch die Interaktion aller Zeichensysteme – durch Sprache, Bild und Ton – fügen sich Poster im Idealfall tatsächlich zu einem Sinnganzen und fungieren als «kommunikative Handlungen» (Stöckl 2011, S. 45). Diese Untersuchung klammert die auditiven Elemente aus und konzentriert sich auf den eindimensionalen Bereich: visuelle Zeichentypen, die als Zeichenmodalitäten Sprache und Bild beinhalten (Stöckl 2016, S. 6).
Die Binnenstruktur der 45 untersuchten Poster setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Es lassen sich zehn Elemente-Kategorien bilden:
1 Corporate-Design-Elemente: Kopf, Logo, grüner Balken
2 Titel: Haupttitel, Untertitel, Zwischentitel
3 Text A: Fließtext
4 Text B: Infoboxen
5 Text C: Aufzählungen durch Bullet-Points (in Abb. 12 nicht enthalten)
6 Text D: Bildlegenden und -beschriftung
7 Visualisierungen A: Bilder, Fotografien, Skizzen, Karten
8 Visualisierungen B: Diagramme (auch Blockdiagramme), Tabellen (in Abb. 12 nicht enthalten)
9 Visualisierungen C: Schemata
10 Visualisierungen D: Informationsgrafiken (Infografik), komplexe Darstellungen (von Abläufen/Zusammenhängen) (in Abb. 12 nicht enthalten)
Sowohl Aufzählungen (Text C) als auch Diagramme, Tabellen und Informationsgrafiken (Visualisierungen B und D) sind im Template (vgl. Abbildung 12) nicht enthalten, werden aber häufig verwendet.

Abbildung 12: Die Formatvorgaben für die Poster zu Diplomarbeiten sind eng: grüner Balken, Logo, Haupttitel, Lead, Bilder, Zwischentitel, Text, Infoboxen, Credit(s). Bild: Hochschule für Technik FHNW
Die Kategorien 1 und 2 (Corporate-Design-Elemente sowie Titel) sind bei den untersuchten Postern durchgehend vertreten, da die Elemente an der Hochschule obligatorisch einzufügen sind. Generell werden die Textkategorien A bis D unterschiedlich häufig gewählt: Während Fließtext als erklärender Text in allen 45 untersuchten Postern vorkommt, enthalten 20 Poster im Korpus Infoboxen oder Aufzählungen (Elemente Text B und C). Legenden und Beschriftungen (Element Text D) hingegen sind dann notwendig, wenn Visualisierungen enthalten sind. Visuelle Elemente der Kategorien 7 und 8 (Visualisierungen A und B) finden sich ebenfalls auf allen Postern. Schemata sind zum Beispiel in der Elektrotechnik häufig. Bei insgesamt 18 der 45 untersuchten Poster kommt eine Form von Schema oder eine Abbildung eines Schemas vor. Informationsgrafiken (Infografiken), also die Darstellung von (komplexen) Zusammenhängen auf visueller Ebene, oder andere komplexe Visualisierungen hingegen sind selten. Insgesamt sind in 8 der 45 Poster Arten von Visualisierungen enthalten, die einer Infografik ähnlich sind oder die mehrere visuelle Ebenen (zum Beispiel eine Karte und weitere textliche und visuelle Elemente) kombinieren. Generell zeigt sich, dass sich die Studierenden stark an den Vorgaben beziehungsweise Vorschlägen orientieren, die im Template enthalten sind. Nebst Corporate-Design-Elementen, Titeln und Fließtext gehören dazu sowohl die Infoboxen als auch Fotografien oder Skizzen. Nachfolgend sollen besonders die häufig verwendeten Elemente weiter betrachtet werden.
Handlungsstrukturen
Alle aufgeführten Elemente übernehmen innerhalb eines Posters Funktionen. Diese funktionalen Textteile oder funktionalen Handlungsabschnitte werden auch als Stages bezeichnet. Dabei informiert die Analyseebene der Stages auch darüber, ob die Funktionen der Abschnitte über Sprache oder über Bilder vermittelt werden – und in welchem mengen- und gewichtmäßigen Verhältnis die beiden Modalitäten zueinanderstehen (Stöckl 2016, S. 23–26).
Am nachfolgenden Beispiel (Abbildung 13) wird verdeutlicht, was Stages sind. Dabei ist zu beachten, dass es sich hierbei um ein Poster handelt, das die Formatvorlage erweitert. Es fällt auf, dass zwischen Textboxen formale Verbindungen bestehen. Um diese formalen oder um andere Verbindungen geht es indes erst beim dritten Analyseschritt.

Abbildung 13: Am Poster «Finance Dashboard» können verschiedene funktionale Handlungsabschnitte (Stages) gezeigt werden. Bild: Hochschule für Technik FHNW
Der Titel setzt das Thema, den Inhalt des Posters: Es geht um ein Finance-Dashboard. Der Untertitel bestimmt das Thema genauer. Er verdeutlicht, dass die Evaluation einer intelligenten Geschäftssoftware (für Finanzangelegenheiten) im Zentrum steht. Der zweite Untertitel sowie der grüne Balken am linken Rand verfolgen keinen inhaltlichen Zweck. Diese Stages verorten die Arbeit im Hochschulbetrieb; es handelt sich um eine Diplomarbeit aus dem Jahr 2015 in der Vertiefungsrichtung Process-Controlling. Das Titelbild hat wiederum einen inhaltlichen Zweck. Es führt Elemente eines Finance-Dashboards und einen Geschäftsherrn vor Augen. Gemäß Bildlegende, die den Inhalt des Bildes definiert, handelt es sich um die Darstellung von «Business Intelligence». Das Diagramm unterhalb der Bildlegende sowie der vertikale Zeitstrahl zeigen den Projektmanagementprozess in zeitlicher Dimension auf. Diese Stages informieren also wiederum auf organisatorischer, nicht auf inhaltlicher Ebene.
Anhand von Abbildung 13 konnten unter anderem folgende Funktionen einzelner Stages gezeigt werden: Thema setzen, verdeutlichen, organisatorisch verorten, vor Augen führen, also verbildlichen, definieren, Projektmanagementprozess aufzeigen.
Die Realisierung der Stages und deren Gewichtung unterscheiden sich. Vier Stages sind geschrieben-sprachlich vermittelt, die restlichen vier sprachlich und visuell beziehungsweise bildlich. Das Titelbild (Geschäftsmann) hat durch seine Breite und die Platzierung einen hohen Status; es sticht ins Auge. Es hat aber ein geringes Gewicht. Denn erst durch den Text in der Legende erhält es seine Bedeutung. Die geschriebene Sprache dagegen hat ein hohes Gewicht, und zwar unabhängig von ihrem mengenmäßigen oder augenfälligen Anteil, also ihrem Status. Die Sprache ist bedeutungsgebend (vgl. Nöth 2016, S. 206–209). Dieses Phänomen illustriert auch der grüne Balken: Er sticht ins Auge, hat also einen hohen Status, aber inhaltlich ein sehr geringes Gewicht, da er außer der Verortung im Hochschulkontext keine projektbezogene Bedeutung trägt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.