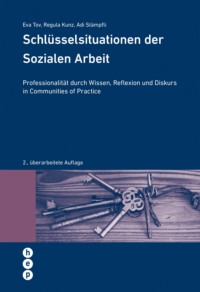Kitabı oku: «Schlüsselsituationen der Sozialen Arbeit», sayfa 2
Prolog
Prolog
Die Welt als Ganzes werden wir mit diesem Buch nicht verändern, aber uns hat es verändert. Die Vorstellung, dass es möglich ist, die scheinbaren Gegensätze von Theorie und Praxis zusammenzubringen, war der Motor zur Entstehung des Buches. Von Studierenden und Ausbildenden in der Praxis der Sozialen Arbeit und immer mehr auch von wissenschaftlich Tätigen und Dozierenden hören wir, dass unser Modell Aufmerksamkeit erregt, Interesse weckt.
In diesem Buch werden wir auf verschiedene Ansätze von Lernen hinweisen. Dabei fällt auf, dass im Kontext von lebenslangem Lernen die Unterschiede zwischen formellem und informellem, zwischen privatem und beruflichem Lernen oder zwischen Lernen an der Hochschule und Lernen in der Praxis sich aufzulösen beginnen.
Bei der Entstehung des Buches hat der Begriff der Community of Practice (CoP, Plural CoPs) eine zunehmend wichtigere Bedeutung für uns bekommen. Man könnte ihn zwar mit »Praxisgemeinschaft« übersetzen. Da damit im Deutschen aber eher ein Zusammenschluss von Partnern assoziiert wird, zum Beispiel in Gemeinschaftspraxen von Hausärztinnen oder etwa von Physiotherapeuten, verwenden wir den englischen Originalbegriff.
Unsere Arbeitsweise war gekennzeichnet von gemeinsamem Lernen. Sie war intensiv, partizipativ, aushandelnd, ständig erprobend und reflektierend. Wir haben Erkenntnisse immer wieder infrage gestellt und versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen. Wir bemühten uns darum, die Theorien und Modelle, mit denen wir uns im Laufe der Jahre beschäftigten, in ihrer Eigenlogik zu verstehen und gleichzeitig für die Beantwortung unserer Fragen zu nutzen und zueinander in Beziehung zu setzen. Dieser Diskurs und das Ringen um Sinn sind zum Fundament unseres Ansatzes der Arbeit mit Schlüsselsituationen geworden. Als Team haben wir mit der Zeit unser eigenes Verständnis einer CoP entwickelt. Wir verstehen Wissenschaft und Praxis, Wissen und Handeln, Sein und Werden in Anlehnung an Lave und Wenger (1991) und Wenger (1998) nicht als Gegensätze, sondern als Dualität. All diese Aspekte bedingen sich gegenseitig.
Die Ideen, die wir in diesem Buch in Worte gefasst haben, entstanden in enger Kooperation und gemeinsamer Reflexion. Unsere unterschiedlichen Erfahrungen, Wissensbestände und Motivationen haben die Zusammenarbeit in der »Arbeitsgruppe Schlüsselsituationen« geprägt. In einem spannenden Prozess, in dem wir immer wieder die Bedeutung von Theorien für die Gestaltung der Praxis-Theorie-Relationierung aushandelten, haben wir uns professionell und persönlich verändert. Im gemeinsamen Handeln entwickelten wir mit der Zeit Erkenntnisse, die wir für die Entwicklung des Modells »Schlüsselsituationen in der Sozialen Arbeit« nutzen konnten. Über unsere Motivation an der Sache, unsere Neugierde und unser Engagement haben wir eine Intensität und Tiefe in unseren fachlichen und persönlichen Auseinandersetzungen entwickelt, die für uns alle neu war. Immer wieder waren wir erstaunt, wie Türen, die fest verschlossen schienen, auf einmal aufgingen, wie sich kreative Lösungen für objektiv scheinbar nicht lösbare Aspekte auftaten und welche Zugkraft sich entfaltete, die um ein Vielfaches unsere addierten Einzelkräfte überstieg. Wir lernten zu staunen über das, was sich einstellt, wenn man sich auf den Strom der Veränderung einlässt, statt gegen ihn zu schwimmen. Je tiefer wir in unserem Arbeitsprozess vorstießen, desto mehr Ideen entstanden und desto deutlicher kristallisierten sich Visionen zur Weiterentwicklung heraus. Sie waren ein natürliches Resultat dessen, was in unserer CoP geschah. Die Entwicklung von einer Arbeitsgruppe hin zu einer CoP wollen wir in diesem Prolog darstellen. Wie beim Modell der »Schlüsselsituationen« selbst gehen wir von einer Geschichte aus und nehmen diese als Ausgangspunkt, um exemplarisch die Bedeutung einer CoP zu beleuchten.
Am Anfang unserer Beschäftigung mit dem Ansatz des situationsbezogenen Lernens stand die im Jahr 2005 an der Vorgängerinstitution der heutigen Hochschule für Soziale Arbeit in Basel durchgeführte Weiterentwicklung des damaligen Curriculums. Nach der Fusion zur Fachhochschule Nordwestschweiz wurde dieser Prozess 2008, nach einer fusionsbedingten Unterbrechung[2], weiterverfolgt. Die Weiterentwicklung des Modells »Schlüsselsituationen« wurde in einer Arbeitsgruppe vorangetrieben mit dem Ziel, es für die Lehre in den Wissens- und Kompetenzintegrationsmodulen sowie in der Praxisausbildung nutzbar zu machen. Anfänglich nannte sich diese Gruppe »AG Konkrete Kompetenzen« in Anlehnung an Kaiser (2005b). Die Arbeitsgruppe präsentierte ihre Ideen und die zugrunde liegenden Theorien in verschiedenen Fachstellen innerhalb der Hochschule für Soziale Arbeit. Im Frühling 2009 entschieden wir, anstelle des Begriffs der »konkreten Kompetenzen« neu den der »Schlüsselsituationen« zu verwenden, und zwar im Sinne von zentralen Situationen aus dem Berufsalltag.
Durch das Heraustragen der Ideen in andere Gremien und in informellen Pausengesprächen entstand ein Austausch zu möglichen theoretischen Anknüpfungspunkten des Modells »Schlüsselsituationen«. Schöns (1983, 1987) »reflective practice« und Laves und Wengers (1991) »situated learning« wurden diskutiert. Durch diese gemeinsamen Gedankengänge wurde das Interesse von anderen geweckt, und die Arbeitsgruppe vergrößerte sich im Frühling 2010. Dies führte zu einer Erweiterung der Perspektiven.
Erstmals wurden Veranstaltungen in der Lehre nach dem sich entwickelnden Modell durchgeführt und wurde gleichzeitig die Literatur aufgearbeitet. Der Arbeitsgruppe gehörten nun am Rande auch zwei Professionelle der Sozialen Arbeit als externe Lehrbeauftragte und andere Dozierende an, die alle in der Lehre tätig waren.
Im Herbst 2010 begann eine intensive theoretische Beschäftigung mit den Begriffen »Lernen«, Community of Practice, »Handeln« und »Praxis-Theorie-Relationierung«. Wir gingen von uns bereits bekannten Definitionen und Theorien aus. Erklärtes Ziel dabei war, Lernen im professionellen Kontext erklären zu können. Wir wollten eine theoretisch fundierte Aufbereitung dieser Ansätze vorantreiben. Die Hauptbezugspunkte waren einerseits die »konkreten Kompetenzen« von Kaiser (2005b) und andererseits das »situierte Lernen«. Wir wollten Lernen allerdings umfassend, aus verschiedenen theoretischen Perspektiven (Illeris, 2010; Kolb, 1993; Jarvis, 2009; Schön, 1983 und 1987; Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998; Kaiser, 2005a und 2005b) verstehen und eine Arbeitsdefinition von Lernen für uns entwickeln. Außerdem fragten wir uns, wie diese Theorien mit dem Modell der Schlüsselsituationen in Verbindung gebracht werden konnten.
Die Erfahrungen in der Lehre, der Austausch mit den involvierten Studierenden und Lehrbeauftragten und die Auseinandersetzung mit den Theorien führten zu verschiedenen Anpassungen des Modells. In den Modulen zur Wissensintegration und in der Weiterbildung für Praxisbildende konnten wir die Erkenntnisse aus unserer Arbeitsgruppe, die sich im Laufe der Zeit zu einer CoP entwickelte, einspeisen, konnten Anpassungen vornehmen und Neuerungen ausprobieren. Die regelmäßig durchgeführten Evaluationen gaben uns wichtige Hinweise, wie das von uns im Laufe der Zeit entwickelte Lernarrangement von den Studierenden aufgenommen wurde und welche Fortschritte sie damit machten.
Trotzdem konnten wir noch kaum eine Verbindung von situated learning mit Schlüsselsituationen herleiten, auch die Verbindung zu den Communities of Practice war noch zu wenig deutlich. In einer dieser Sitzungen entstand zum ersten Mal die Idee einer »Internetplattform« und das Bild einer virtuellen CoP, in der Schlüsselsituationen abgebildet und bearbeitet werden. Diese »Leitbilder« halfen als Vorstellungskraft, die Vision der Arbeit mit und den Diskurs über Schlüsselsituationen zu entwickeln, und trieben uns in unserer Arbeit immer wieder an.
In der Vorbereitung auf die Veranstaltungen im Herbst 2011 erstellten wir einen Reader für die Studierenden und die Lehrbeauftragten. Dazu setzten wir uns gezielt mit der sozialen Theorie des Lernens nach Wenger (1998) auseinander. Textvorlagen wurden produziert, diskutiert, verworfen und wieder neu gestaltet. Die abstrakte Ebene des Originals stellte immer wieder eine intellektuelle Herausforderung dar. Im Bemühen, das Modell zu verstehen, stellten wir fest, dass die soziokulturelle Herkunft des Konzeptes wahrscheinlich maßgebend für dessen Verständnis ist. Während die in der deutschen Tradition entstandenen konstruktivistischen Theorien stark individualistisch ausgerichtet sind, hatte die soziale Theorie des Lernens von Anfang an den Fokus auf soziale Gemeinschaften in Anlehnung an Giddens (1997, Konstitution der Gesellschaft) und Suchman (1987, Plans and situated actions, eine ethnografische Studie zur Firma Xerox). Daraus ist im englischen Sprachraum das Konzept des situierten Lernens entstanden. Diese beiden Traditionen von situiertem Lernen trafen nun in unserer CoP aufeinander.
Herausfordernd gestaltete sich auch die sprachliche Bearbeitung. An der Hochschule für Soziale Arbeit (HSA) der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) werden zum Beispiel zentrale Begriffe wie Verstehen und Deuten verwendet, die ihre Wurzeln in der deutschen Hermeneutik haben. Auf den ersten Blick schienen sie als Übersetzung von »negotiation of meaning« (deuten) und »experience of meaning« (verstehen) (Wenger, 1998) durchaus tauglich. bei genauerem Hinsehen stellten wir aber fest, dass »verstehen« und »deuten« dem Charakter der Erfahrung von Menschen als sozialen Wesen – ein Aspekt, den Lave und Wenger (1991) immer wieder betonen – nicht nahe genug kommen. Daher schien die Wendung »Aushandeln von Bedeutung« passender. Darin kommt der soziale Aspekt besser zum Ausdruck.
Wir entdeckten auch Klärungsbedarf betreffend die Situiertheit von Wissen. Wie Lave und Wenger (1991) erklären, ist situiertes Wissen nicht von einer Situation in eine andere übertragbar. Wir fragten uns, wie radikal sie das meinten. Diese zentrale Frage zur Konzeption von Schlüsselsituationen mussten wir beantworten können. Ließen sich Analogieschlüsse – wie wir sie im Kurs »Schlüsselsituationen« anstreben – überhaupt mit der sozialen Theorie des Lernens erklären? Inwiefern kann also Wissen, wie Dreyfus und Dreyfus (1987) dies in der Expertinnen- und Expertenforschung beschreiben, via Geschichten oder Analogien zu bestimmten Situationen in andere Situationen übertragen werden? Diese Fragen wollten wir in einem nächsten Schritt klären.
Weitere Fragen betrafen die Konsequenzen der Theorie für die Lernarrangements der Studierenden: Inwiefern können wir im Kurs »Schlüsselsituationen« von CoPs sprechen? Falls die Kleingruppen als solche verstanden werden können, stellt sich die Frage, inwiefern wir diese gestalten und fördern können. Unsere Antworten auf diese Fragen werden im Buch besprochen.
Die Fortschritte bei der Umsetzung der Lernplattform regte unsere Vorstellungskraft weiter an. Wir stellen uns vor, dass Ausbildende und ehemalige Studierende, die mit dem Modell der Schlüsselsituationen vertraut sind, diese in Praxis und Ausbildung weiterhin nutzen. So könnte sich die Plattform auch in Zukunft als Ressource und das Reflexionsmodell als wirkungsvolles Arbeitsinstrument erweisen.
In den teilweise ganztägigen Sitzungen kamen wir der Sache langsam auf die Spur, fanden Antworten auf die oben formulierten Fragen und hielten unsere Erkenntnisse in unserem Reader fest. Im Herbst 2011 passten wir das Programm für die Veranstaltung aufgrund dieser Erkenntnisse und neuer Vorgaben an und trafen Absprachen mit den involvierten Dozierenden und externen Lehrbeauftragten.
Gegen Ende 2011 waren wir dann so weit, dass wir mit unserem Modell an eine breitere Öffentlichkeit treten konnten, und konkretisierten das Vorgehen hinsichtlich von Publikationen und Teilnahme an einer internationalen Tagung.
In der Bearbeitung von Reader und Publikation setzten wir die Diskussionen fort und schärften unser Verständnis. Wir begannen, zwei Ausrichtungen des Modells »Schlüsselsituationen« zu differenzieren: zum einen die Arbeit mit Schlüsselsituationen als Modell zur Reflexion, zum zweiten den Diskurs über Schlüsselsituationen als Systematik für das Wissensmanagement und für einen Fachdiskurs zu professioneller Praxis in der Sozialen Arbeit. Schließlich veröffentlichten wir unser Modell erstmals im European Journal of Social Education (Staempfli, Kunz & Tov, 2012) und stellten es in zwei Workshops auf einer europäischen Tagung in Marseille vor.
Im Frühling 2012 begannen sich einschneidende Veränderungen abzuzeichnen. Zwei der drei Kernmitglieder der CoP »Schlüsselsituationen« kündigten an, im Verlaufe des Jahres die Hochschule für Soziale Arbeit FHNW in Richtung Israel und England zu verlassen. Trotzdem arbeiteten wir ab Herbst 2012 an diesem Buch weiter und vermochten das Projekt über die geografischen Grenzen hinweg weiterzuführen. Wie sich die weitere Zusammenarbeit entwickeln wird, ist allerdings noch offen, wobei zwei geplante Dissertationsvorhaben sich explizit dem Modell »Schlüsselsituationen« widmen.
Mit dieser Geschichte unserer CoP möchten wir verdeutlichen, dass die Ideen in diesem Buch, wie es Freire im Motto zu diesem Teil über das »Wort« schreibt, im Zusammenspiel von Reflexion und Aktion entstanden sind. Ganz im Sinne Freires haben wir diese radikale Interaktion, die uns und darüber unsere Welt verändert hat, erfahren. Im stetigen Wechselspiel von Ausprobieren und Reflektieren haben wir eine Veränderung der Welt im Kleinen erreicht.
Nur durch dieses reflexive Zusammenspiel von Handeln und Wissen gelingt die Relationierung von Theorie und Praxis. Sie kann weder rein theoretisch noch rein praktisch gestaltet werden. Professionalität kann in unserem Verständnis durch den Diskurs über die Bedeutung von Wissen und Praxis (Handeln) gefördert werden. Wir möchten die Leserinnen und Leser ermutigen, selbst auf die Suche nach Antworten zu gehen und dabei auch Neues auszuprobieren. Wir hoffen, dass die im Buch enthaltenen Ideen dazu anregen.
The case is not in the book
Donald A. Schön
1 Einleitung
1
Einleitung
Der einleitende Teil gibt eine erste Übersicht zum Modell »Schlüsselsituationen« mit den beiden Aspekten Arbeit mit und Diskurs über Schlüsselsituationen. Wir verorten das Modell im Kontext des Diskurses zur Relationierung von Theorie und Praxis und vor dem Hintergrund der Hochschulentwicklung. Schließlich geben wir eine Übersicht zu den einzelnen Teilen des Buches und Lesehinweise.
Überblick
Eine grundlegende Frage jeder Profession und somit auch der Sozialen Arbeit ist, was Professionalität ausmacht und wie diese gefördert werden kann. Wir geben in diesem Buch mit dem Modell »Schlüsselsituationen der Sozialen Arbeit« Antworten auf diese Fragen.
Der Berufskodex der Sozialen Arbeit verpflichtet die Profession, ihre Erklärungen, Methoden und Vorgehensweisen auf wissenschaftlich fundierte Grundlagen zu stellen (AvenirSocial, 2010; siehe auch www.avenirsocial.ch/cm_data/EthikprinzSozArbeitIFSW.pdf). Gleichzeitig sind Entscheidungen nach Abwägen aufgrund von ethischen Grundsätzen zu fällen. »Professionell handeln« bedeutet demnach, wissens- und wertebasiert zu handeln. Im Reflexionsmodell »Arbeit mit Schlüsselsituationen« streben wir beides an, indem die Verbindung von Wissen und Handeln anhand von Situationen der Sozialen Arbeit unter Berücksichtigung von situativen Kontexten geschieht und die Situation mit auf Werten basierenden Qualitätsstandards reflektiert wird. Dabei wird die Bedeutung von Theorie und Praxis in Communities of Practice (CoPs) ausgehandelt. Der »Arbeit mit Schlüsselsituationen« ist der Hauptteil dieses Buches gewidmet.
Wir wagen aber auch einen Blick in die Zukunft, denn es reicht nicht aus, wenn Professionelle der Sozialen Arbeit situativ reflektieren. Der Berufskodex weist nämlich auch darauf hin, dass Wissen zu teilen und hinsichtlich der Qualität zu überprüfen ist (AvenirSocial, 2010). Wie dies geschehen kann, stellen wir anhand unserer Perspektive einer virtuellen CoP rund um eine offene Plattform vor. Darauf wird das kasuistische Wissen, das in Schlüsselsituationen dokumentiert wird, veröffentlicht. Die Plattform ermöglicht damit einen fachlichen Diskurs über Schlüsselsituationen und trägt so durch die Relationierung von Wissen und Handeln über die Grenzen von scientific und professional communities hinaus zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit bei.
Bevor wir unser Modell vorstellen, wollen wir in dieser Einleitung auf den gegenwärtigen Diskurs zur Relationierung von Theorie und Praxis als konstitutives Problem der Profession eingehen. Wir zeigen die Entwicklungen der Hochschullandschaft auf und illustrieren, wie diese die Entstehung des Modells »Schlüsselsituationen« beeinflusst haben. Schließlich stellen wir die einzelnen Teile des Buches kurz vor.
Relationierung von Theorie und Praxis
Ganz im Sinne unseres Modells, bei dem wir von erlebten Situationen ausgehen, wollen wir den Diskurs zur Relationierung von Wissen und Handeln mit einer Alltagsgeschichte beginnen: Wenn wir ein Problem mit der Bedienung des Fernsehers haben, versuchen wir es zu lösen, indem wir verschiedene Funktionen ausprobieren. Falls dies nicht zum Ziel führt, lesen wir die Bedienungsanleitung, manchmal funktioniert das, manchmal auch nicht. Dieses – zugegebenermaßen – alltägliche Problem kann durchaus auf diese Weise gelöst werden. Wir halten uns dabei an ein situativ genutztes technisch-rationales Verständnis von Problemlösung. Auf die Soziale Arbeit übertragen, würde dies bedeuten, dass in einer herausfordernden Situation auf der Basis von Erfahrungen Lösungen gesucht werden. Man probiert mal aus, ob bewährte Interventionen auch in der aktuellen problemhaften Situation zur Lösung verhelfen. Wenn dies nicht genügt, konsultiert der Sozialarbeiter oder die Sozialpädagogin vielleicht Kolleginnen, Mitarbeiter oder einen Fachartikel, um sich die Studienresultate einer ähnlich gelagerten Problemstellung zu vergegenwärtigen. Er oder sie versucht dann, die so gewonnenen Erkenntnisse auf den Fall zu beziehen. Aber im Unterschied zu Fernsehgeräten, bei denen eine begrenzte Anzahl vergleichbarer Modelle auf dem Markt sind, sind Adressatinnen und Adressaten der Sozialen Arbeit alle einzigartig und somit auch jeweils die Problemstellungen. Für eine professionelle Tätigkeit stellt sich die Herausforderung im Grundsatz ähnlich dar, jedoch viel komplexer. Es lassen sich aber keine Anleitungen in der Literatur finden, wie wir in einer spezifischen Situation vorzugehen haben, denn »the case is not in the book«, wie das Schön (1983, S. 5) so prägnant ausdrückt.
In der inzwischen nicht mehr aktuellen Diskussion zum Verhältnis von Theorie und Praxis im Sinne eines Transfers (Dewe, 2012; Eugster, 2000) wurde Professionalität in einen direkten Zusammenhang mit Profession gesetzt. Dieser Zusammenhang war unter der strukturellen Perspektive, nach welcher der Sozialen Arbeit höchstens der Rang einer Semiprofession zukommt, insofern kritisch, als die Professionalisierbarkeit dieses Berufes, dem es an Autonomie und großen Entscheidungsspielräumen mangelt, als fraglich angesehen wurde (Heiner, 2004). Nach der handlungstheoretischen Perspektive von Schütze (1992) steht das kompetente, an berufsethischen Standards ausgerichtete Handeln der Professionellen im Sinne der zu erreichenden Wirkungen im Zentrum. Unter dieser Optik ist sehr wohl Professionalität denkbar und Professionalisierung eine mögliche anzustrebende Größe. Als professionelles Handeln wird dabei in der neueren Diskussion vor allem die Fähigkeit verstanden, wissenschaftlich fundiert in einer komplexen, von Heterogenität geprägten Praxis und unter Unsicherheit lösungsorientiert zu handeln (Heiner, 2004).
Die Anwendung wissenschaftlichen Wissens in der Praxis hat dabei im Laufe der Zeit eine Veränderung erfahren. Während zu Beginn von »Transfer« des wissenschaftlichen Wissens in die Praxis gesprochen wurde, ging die Fachwelt später dazu über, die »Transformation« von Wissen zur Nutzung in der Praxis zu betonen. Dies hat schließlich zum Begriff der »Relationierung« von unterschiedlichen Wissenstypen geführt (von Spiegel, 2008, S. 58). Unter Relationierung wird dabei verstanden, dass wissenschaftliches Wissen von in der Praxis Tätigen selektiv aufgenommen, auf die konkrete Problemstellung hin interpretiert wird und schließlich mit beruflichem Erfahrungswissen verschmilzt und sich so zu einem neuen Typ von Wissen wandelt, dem Professionswissen (Dewe, 2012).
Das Grundproblem bei der Relationierung von theoretischem und praktischem Wissen ist die Unterschiedlichkeit von Wissenschaft und Praxis, die je eigenen Gesetzmäßigkeiten und Logiken folgen und von daher inkompatibel sind. Während die Wissenschaft der Wahrheitsfindung dient und dabei einem Begründungszwang unterliegt, sind die Referenzkriterien der Praxis Wirksamkeit und Handlungszwang (von Spiegel, 2008). Vor diesem Hintergrund sind die regelmäßig konstatierten Enttäuschungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die Unfähigkeit der Praktikerinnen und Praktiker, sich an das in der Ausbildung vermittelte Wissen zu erinnern und es im Berufsalltag bewusst und nutzbringend anzuwenden, ein Resultat falscher Prämissen und Erwartungen. Andererseits entkräftet diese Diagnose nicht den Vorwurf von Staub-Bernasconi (1998, S. 47), wenn sie kritisiert:
»Ersetzt wird [Fachwissen] durch mehr oder weniger hilflose, voluntaristisch-moralische Kategorien, durch Fragen nach der richtigen Gesinnung und Hilfe-Moral oder nach bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, durch Gehorsam gegenüber Dienstvorschriften, Zweck und Strukturregeln der Organisation.«
Diese den beiden Systemen immanenten Widersprüche können durch Dialog und Koproduktion überschritten werden, indem durch Lernprozesse neue Einsichten und Wissen erworben werden und in gemeinsamen Diskursen ein geteiltes Verständnis entwickelt wird. Der Prozess der Koproduktion verändert alle daran Beteiligten und ist kein einseitiger Akt der Vermittlung von Wissen oder Know-how oder die Übernahme von Handlungsanleitungen. Eine Schwierigkeit, die es dabei anzugehen gilt, ist die, dass wissenschaftliches Wissen auf Abstrahierungen und Verallgemeinerung ausgerichtet ist, wobei einmalige Abweichungen vom generalisierten »Ideal« vernachlässigt werden. Die Praxis dagegen hat es ausschließlich mit individuellen, einmaligen Sachverhalten zu tun, die sich nicht unter die theoretisch »geglätteten« Ideale subsumieren lassen, ohne Komplexität zu reduzieren oder ihren Wesenskern zu verfremden. Ein Weg, mit dieser als Polarität erfahrbaren Realität umzugehen, besteht darin, sich auf die Position der Polarisierung zu versteifen und die Unvereinbarkeit der beiden Seiten zu proklamieren oder zu beklagen, dass »die anderen« nicht zur Lösung der Probleme im eigenen Terrain taugen. Relationierung dagegen bedeutet, sich annähernd, prüfend, suchend auf den Weg ins andere Feld zu machen, ohne das Eigene aufzugeben oder billig zu verkaufen. Es bedeutet, über Qualität, Preis und Nutzen zu verhandeln, ohne das Ziel aus dem Auge zu verlieren. Es beinhaltet das kontextsensible Wechseln der Perspektiven zwischen dem eigenen Standpunkt und dem des anderen. Es ist ein Auskalibrieren der jeweiligen Systeme hin zu einem neuen eigenen, das verbindend zwischen den Ursprungssystemen steht.
Was bedeutet dies aber konkret? Wie kann diese Relationierung gestaltet werden? Das von uns entwickelte Modell versucht, darauf theoretische und praktische Antworten zu geben. Das Grundanliegen des Buches ist es, einen konkreten Beitrag zur Beantwortung der Frage zu leisten, wie mannigfaltige Wissensformen aus Praxis und Wissenschaft in verschiedensten Situationen innerhalb der Sozialen Arbeit, bei denen eine Herausforderung professionell gestaltet werden soll, fruchtbar gemacht werden können. Es geht uns um eine ganzheitliche Sicht der Integration von Wissen und Kompetenzen hin zu einer professionellen Identität. Unser bescheidener Anteil auf diesem Weg ist die Entwicklung eines Modells, anhand dessen Studierende und Professionelle der Sozialen Arbeit in systematisch festgelegten Arbeitsschritten reflektieren. Studierende werden dabei von Dozierenden oder Ausbildenden in der Praxis begleitet. Sie tun dies in kleinen Gruppen, die als Communities of Practice (Lave & Wenger, 1991) konzipiert sind. Die Arbeitsschritte des Reflexionsprozesses sind aufgrund lerntheoretischer Erkenntnisse gestaltet. Wir zeigen, was wir unter professioneller Reflexion verstehen und wie Reflexionsprozesse durch ihren Fokus auf handelnde Subjekte die Entwicklung von professionellen Identitäten und somit von Professionalität fördern.
Dabei kann es vorkommen, dass eine Gruppe eine überraschende Lernerfahrung macht, indem sie entdeckt, dass ihre Handlung in der reflektierten Situation nicht dem Wissen und den Qualitätsansprüchen professioneller Praxis entspricht. Diese Offenheit ist ein wichtiger Grundsatz, den unsere Studierenden erfahren zu lassen wir bestrebt sind. Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist der, dass das Wesen der Sozialen Arbeit von Widersprüchen und Ambivalenzen geprägt ist. Früher wurden diese als nicht auflösbare Polaritäten, ja sogar als Paradoxien betrachtet, wie etwa das »doppelte Mandat« der Interessenvertretung der Klientinnen und Klienten einerseits und der Erfüllung eines gesellschaftlichen Auftrags andererseits (Böhnisch & Lösch, 1973, S. 27–29) Inzwischen spricht man eher von einer »doppelten Loyalität« (Heiner, 2004, S. 21), von Spannungsfeldern oder sogar vom »Spiel von Kontrolle und Akzeptanz«, vom »Spiel von Macht und Respekt« (Thiersch, 2004, S. 11).
Unser Reflexionsmodell wird zwar durch klar definierte Arbeitsschritte strukturiert, die inhaltliche Füllung aber ist flexibel, indem Deutungen reflexiv erschlossen und diskursiv ausgehandelt werden. Dieses »Aushandeln von Bedeutung« (»negotiation of meaning«), wie Lave und Wenger (1991) es nennen, das in der CoP stattfindet, stellt gleichzeitig ein Übungsfeld dessen dar, was von Professionellen erwartet wird und woran sich ihre Professionalität misst: gemeinsam mit ihren Klientinnen und Klienten Deutungen ihrer Situation, ihrer Problemlage zu finden und ein sinnhaftes Bild zu erzeugen, das die Professionellen befähigt, die Widersprüchlichkeiten, Begrenzungen und Nöte ihrer Klientinnen und Klienten anzuerkennen und gleichzeitig ihre Stärken und Ressourcen erschließen zu helfen. Es handelt sich dabei um einen kooperativen und ko-konstruktiven Prozess der Realitätsproduktion.
Orientierung in der Theorie-Praxis-Relationierung bietet neben den Arbeitsschritten des Reflexionsprozesses auch eine empirisch gewonnene Sammlung von relevanten Situationen der Sozialen Arbeit, eben Schlüsselsituationen. Sie erheben den Anspruch, das Berufsfeld der Sozialen Arbeit abzudecken, und bilden primär das Kerngeschäft der Sozialen Arbeit ab, nämlich die auf Klientensysteme bezogene Arbeit in den Feldern der Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Jugend- und Gemeinwesenarbeit. Sie schließen dabei Leitungsfunktionen und andere erweiterte Funktionen und Spezialisierungen aus, wie sie beispielsweise auf wissenschaftlicher oder planerischer Ebene vorkommen. Das kasuistische Wissen dieser Schlüsselsituationen veröffentlichen wir auf einer Plattform, um einen fachlichen Diskurs zu initiieren. Dieser soll uns ermöglichen, uns über die Grenzen von scientific und professional community hinweg über die Bedeutung von professionellem konkretem wissens- und wertebasiertem Handeln zu verständigen.
Entstehung und Ursprünge des Modells »Schlüsselsituationen«
Das vorliegende Buch ist in seinen Anfängen der leidvollen Erfahrung geschuldet, dass die Bologna-Reform, die 1999 begann und bis 2020 abgeschlossen sein soll (Europäische Union [EU], 2010), eine strukturelle und keine inhaltliche Studienreform darstellt. Den Architekten und Architektinnen dieser Reform ging es primär darum, europäisch vergleichbare Abschlüsse zu schaffen, die Mobilität der Studierenden und Lehrenden zu steigern und um ausweisbare, quantifizierbare Nachweise von im Studium erbrachten Leistungen zu erhalten. Die mit der Modularisierung einhergehende Kompetenzorientierung bildet zwar eine Bezugsgröße im Hinblick auf den »Outcome«, doch lassen sich auf der inhaltlich-fachlichen Ebene daraus keine eindeutigen Aussagen ableiten.
In einer Evaluation des neuen, Bologna-tauglichen Curriculums 2002/2003 an der Vorgängerinstitution der Hochschule für Soziale Arbeit in Basel klagten die Studierenden über einen mangelnden »roten Faden« im Studium sowie über Fragmentierung des Wissens einerseits und Überschneidungen von Inhalten und Redundanzen andererseits. Es wurde deshalb nach neuen Ansätzen gesucht, um trotz Modularisierung die Modulinhalte besser aufeinander zu beziehen und auch das Postulat der Kompetenzorientierung einzulösen. Gleichzeitig gab es aus der Praxis der Sozialen Arbeit Stimmen, wie beispielweise die der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS, 2006), welche die Berufsbefähigung der FH- Studienabgängerinnen und -abgänger bemängelten und das Kompetenzprofil oder zumindest dessen Umsetzung infrage stellten.
Es wurde nun nach einem Ansatz gesucht, um empirisch zu erfassen, was die Praxis bezüglich Berufsbefähigung erwartet, und mit dem die Probleme der Modularisierung gelöst werden können. Das aus den USA stammende, langjährig erprobte Verfahren DACUM (Developing A Curriculum) nach Norton (1997) schien ein nützliches Verfahren, um die Anforderungen an die Berufstätigen in der Praxis zu beschreiben. Dabei handelt es sich um einen innovativen Ansatz zur Analyse von Berufen mit dem Ziel, die Tätigkeiten herauszufinden, die in einem bestimmten Beruf auszuüben sind, beziehungsweise auf deren Erwerb hin im Laufe der Ausbildung innerhalb eines Curriculums ausgebildet werden soll. Hierzu werden die für einen Beruf spezifischen Verantwortungsbereiche sowie die dazugehörigen Tätigkeiten und erforderlichen Skills beschrieben. Das Verfahren selbst wird in Form eines strukturierten Fokusgruppenansatzes in mehreren Workshops durchgeführt (Tippelt & Edelmann, 2007).