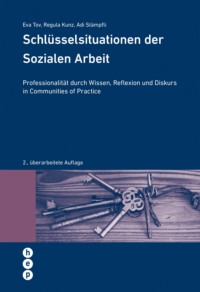Kitabı oku: «Schlüsselsituationen der Sozialen Arbeit», sayfa 3
2005 wurde in Basel ein an DACUM angelehntes modifiziertes Verfahren (Kaiser, 2005a und b) zur Erhebung der professionellen Situationen durchgeführt (vgl. Teil 6 des Buches). Das Ergebnis dieses Prozesses bestand in der Entwicklung von etwa 130 Situationsbeschreibungen, die das Berufsfeld der Sozialen Arbeit abbilden (Kunz & Tov, 2009). Im Rahmen einer hochschulinternen Weiterbildung mit externen Fachleuten wurden Grundfragen und die Weiterentwicklung vertieft diskutiert. Auf dieser Grundlage haben wir die Nutzbarmachung der Situationsbeschreibungen für die Lehre und Praxisausbildung sukzessive vorangetrieben.
Inzwischen können wir ein erprobtes Modell »Schlüsselsituationen« vorlegen. Es ist ein eigenständiger, neuartiger Ansatz zur Theorie-Praxis-Relationierung, der von den Studierenden in einer CoP weitgehend selbstständig umgesetzt wird und dessen Kernelemente Reflexion, Diskurs und Prozesshaftigkeit sind.
Wir haben das Buch geschrieben, um unser Modell der professional und scientific community innerhalb der Sozialen Arbeit zu erschließen. Es soll ermutigen, einen neuen Ansatz zu erproben, der die Situation im Fokus hat. Zentral dabei sind die Interaktionsdynamiken zwischen Professionellen und Klientinnen und Klienten während einer zeitlich eingegrenzten Handlungssituation, in der eine bestimmte Herausforderung zu meistern ist. In der Situation spielt auch der institutionelle Kontext, vor dessen Hintergrund der Professionelle agiert, eine maßgebliche Rolle.
Mithilfe des Buches soll es zum einen möglich sein, mit dem Modell im Lehr- und Ausbildungskontext zu arbeiten, wozu die Arbeitsschritte detailliert beschrieben werden (Teil 4). Zum andern werden die bearbeiteten Schlüsselsituationsbeispiele auf einer Plattform veröffentlicht, um einen Fachdiskurs über Professionalität auf der konkreten Handlungsebene zu initiieren.
Alle Arbeitsmaterialien, wie Veranstaltungsprogramme, Literatur zum Thema, PowerPoint-Präsentationen und Arbeitsanleitungen, sind ebenfalls auf der Plattform zu finden und können heruntergeladen werden. Als Zielpublikum sollen sich Dozierende, Praxisbildende, Studierende sowie alle, die als Professionelle in der Sozialen Arbeit oder in verwandten Bereichen engagiert sind, angesprochen fühlen.
Lesehinweise zu den Teilen des Buches
Das Buch besteht aus sieben Teilen. Nachdem in dieser Einleitung der Ursprung des Modells »Schlüsselsituationen« hergeleitet und im Zusammenhang mit dem Diskurs zur Relationierung von Theorie und Praxis verortet wurde, liefert der zweite Teil eine Definition des Begriffs Schlüsselsituationen im Kontext von Professionalität. Dazu werden die Elemente einer Schlüsselsituation vorgestellt und anhand eines Beispiels veranschaulicht. Die professionalitätsfördernden Aspekte des Modells werden diskutiert, und es wird aufgezeigt, wie die Arbeit mit und der Diskurs über Schlüsselsituationen professionelle Handlungsfähigkeit auf individueller und gemeinschaftlicher Ebene begünstigt. Im dritten Teil wird die theoretische Fundierung des Modells »Schlüsselsituationen« vorgestellt, ebenso die daraus abgeleiteten Grundsätze des Lernens. Diese bilden die Grundlage für Teil 4, in dem der Reflexionsprozess Arbeit mit Schlüsselsituationen ausführlich geschildert wird. Die einzelnen Prozessschritte werden genau beschrieben, und es wird erörtert, wie diese auf unterschiedliche Art methodisch-didaktisch umgesetzt werden können. Die Evaluationsergebnisse zur Umsetzung der Arbeit mit Schlüsselsituationen werden im fünften Teil dargelegt. Danach wird ein visionärer Blick in die Zukunft gewagt, indem die Grundidee eines Fachdiskurses und einer Wissenssystematik im sechsten Teil, Diskurs über Schlüsselsituationen, präsentiert werden. Grundlage hierfür ist die empirisch gewonnene Sammlung der Schlüsselsituationen. Schließlich werden im Fazit und Ausblick Fragen der Übertragbarkeit des Modells in andere Kontexte diskutiert. Der Epilog schließt den beim Prolog aufgespannten Bogen mit einer Reflexion unseres Prozesses in der CoP.
Wir hoffen, dass sich die Leserinnen und Leser sowohl von den praktischen als auch von den theoretischen Teilen des Buches packen lassen. Wer aber das Buch nicht von Anfang bis zum Ende durchgehen mag, kann sich auf einzelne Teile konzentrieren. Wer sich vor allem für die theoretischen Hintergründe interessiert, findet diese in den Teilen 2 und 3. Wer andererseits eine Übersicht über die praktische Umsetzung sucht, nimmt den vierten Teil, in dem die einzelnen Schritte der Arbeit mit Schlüsselsituationen ausführlich dargestellt werden, in den Blick und den sechsten Teil, in dem der Diskurs über Schlüsselsituationen erörtert wird. Wer hingegen die empirische Basis und Evaluation des Modells kennenlernen will, liest die Teile 5, wo die Umsetzungsevaluation vorgestellt wird, und 6, in dem die Entwicklung der Schlüsselsituationstitel nach einem empirischen Verfahren beschrieben wird. Die Autorenschaft hat die Entwicklung der Ideen des Modells und der eigenen CoP im Prolog und im Epilog aufgearbeitet.
Ein Intro jeweils zu Beginn der einzelnen Teile bietet eine kurze Übersicht über den Inhalt. Die Hauptaussagen werden in Kurzform jeweils am Ende jedes Teils unter dem Titel Key Points zusammengefasst.
In einzelnen Teilen wird auf Arbeitshilfen und weitere Materialien verwiesen, die zum Download bereitstehen (www.schluesselsituationen.ch).
Key Points
 Das Modell »Schlüsselsituationen« liefert Antworten auf die Frage, wie Theorie und Praxis relationiert werden können.
Das Modell »Schlüsselsituationen« liefert Antworten auf die Frage, wie Theorie und Praxis relationiert werden können.
 Das Modell besteht aus einem Reflexionsmodell »Arbeit mit Schlüsselsituationen« und ermöglicht den Austausch über die Grenzen von professional und scientific communities hinweg durch einen »Diskurs über Schlüsselsituationen«.
Das Modell besteht aus einem Reflexionsmodell »Arbeit mit Schlüsselsituationen« und ermöglicht den Austausch über die Grenzen von professional und scientific communities hinweg durch einen »Diskurs über Schlüsselsituationen«.
 Die Ursprünge des Modells liegen in der Hochschulentwicklung nach Bologna.
Die Ursprünge des Modells liegen in der Hochschulentwicklung nach Bologna.
 Das Buch liefert theoretische und praktische Erklärungen und Hinweise zum Modell »Schlüsselsituationen« und kann je nach Interesse auch punktuell gelesen und genutzt werden.
Das Buch liefert theoretische und praktische Erklärungen und Hinweise zum Modell »Schlüsselsituationen« und kann je nach Interesse auch punktuell gelesen und genutzt werden.
Menschen finden sich als Wesen »in einer Situation«, in zeitlich-räumlichen Bedingungen verwurzelt, die sie kennzeichnen und von denen sie auch gekennzeichnet werden. Sie neigen dazu, auf ihre eigene »Situationalität« in dem Maß zu reflektieren, in dem sie von ihr dazu herausgefordert sind, an ihr zu handeln. Menschen sind, weil sie in einer Situation sind.
Paulo Freire
2 Schlüsselsituationen im Kontext von Professionalität
2
Schlüsselsituationen im Kontext von Professionalität
Dieser Buchteil legt dar, was professionelle Kompetenz bedeutet und erklärt relevante Begriffe. Anschließend folgt die Definition von »Schlüsselsituation« sowie die Beschreibung der dazugehörigen Elemente. Das konkrete Beispiel einer beschriebenen Schlüsselsituation illustriert die genannten Elemente und Bearbeitungsschritte. Schließlich gehen wir der Frage nach, wie Schlüsselsituationen zur Professionalisierung beitragen können.
2.1 Professionalität durch Handeln, Reflexion und Diskurs
Dieser Teil des Buches legt den definitorischen Grundstein für das Modell »Schlüsselsituationen«. Zu diesem Zweck definieren wir zunächst grundlegende Begriffe wie »Professionalität« und »Kompetenz« und erläutern in der Folge den Begriff der Schlüsselsituation.
Das Modell »Schlüsselsituationen« soll zu einer weiteren Professionalisierung der Sozialen Arbeit beitragen. Zum einen wird diese durch die reflexive Arbeit mit Schlüsselsituationen gefördert. Dies indem Studierende zu professionell Handelnden werden und Fachkräfte ihre professionellen Kompetenzen weiterentwickeln können, wozu unser Reflexionsmodell beiträgt. Zum andern entwickelt sich eine Community von professionell Handelnden durch den Diskurs über Schlüsselsituationen, was durch unser Diskursmodell ermöglicht wird. Das Zusammenspiel dieser verschiedenen Aspekte zeigt die nachstehende Grafik.

Abbildung 1: Professionalität durch Handeln und Reflexion im Zusammenspiel von Person und Umwelt (von Autorinnen und Autor veränderte Grafik von Müller Fritschi, 2013, S. 13)
Professionelles Handeln ist immer durch persönliche Aspekte und Umweltfaktoren geprägt.
Zu den in der Person liegenden individuellen Anteilen gehören Wissen, Fähigkeiten und Haltungen. Die Umweltfaktoren beherbergen ebenfalls Wissen, beinhalten aber auch Erwartungen, Normen und Werte. Außerdem legen sie die Rahmenbedingungen des professionellen Handelns fest.
In unserem Verständnis von Kompetenz in Anlehnung an Hof (2002) und Müller Fritschi (2013) werden nun jeweils situativ die individuellen und sozialen Ressourcen miteinander in Beziehung gesetzt. Dabei findet ein Zusammenspiel von Handeln und Reflektieren statt (vgl. Kolb, 1993). Die Reflexion kann während oder auch nach der Handlung vollzogen werden (vgl. Schön, 1983 und 1987). Beim Handeln wie Reflektieren findet ein Aushandlungsprozess statt, in dem die Bedeutung und die Relevanz von Wissen, Haltungen, Normen und Werten, Erwartungen, Fähigkeiten und Rahmenbedingungen für die professionelle Gestaltung der Situation erwogen werden. Über diese sich in vielen Situationen und Kontexten wiederholenden Aushandlungsprozesse werden vielfältige Erfahrungen gemacht, welche die Entwicklung einer professionellen Handlungskompetenz fördern. Ob sich diese Handlungskompetenz tatsächlich als Performanz in der Situation manifestiert, ist eine Frage der Motivation und des Willens. Wir stimmen mit Erpenbeck und Heyse (1999, S. 162) überein, dass Kompetenzen »von Wissen fundiert, durch Werte konstituiert, als Fähigkeiten disponiert, durch Erfahrungen konsolidiert, aufgrund von Willen realisiert« werden. In unserem Verständnis ist Professionalität nur zu erreichen, wenn neben der individuellen professionellen Handlungskompetenz auch Diskurse in der Community gepflegt werden, welche die Entwicklung einer professionellen Identität fördern. Das bedeutet, Kompetenzen wie Identität entstehen und verändern sich nur im Austausch von Person und Umwelt.
Aus diesem Grund haben wir ein Reflexionsverfahren entwickelt, welches die verschiedenen Elemente von Person und Umwelt in Relation setzt. Unser Diskursmodell ermöglicht den fachlichen Austausch. Für Professionalität in unserem Sinn braucht es beides: wissens- und wertebasierte Reflexion und fachlichen Diskurs.
2.2 Definition und Elemente von Schlüsselsituationen
Den Begriff »Schlüsselsituation« haben wir assoziativ für unseren Ansatz entwickelt. Er setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: »Schlüssel« und »Situation«. »Schlüssel« bezeichnet eine bestimmte Form von Situationen, weshalb wir zunächst »Situation« allgemein definieren wollen.
Im wissenschaftlichen Kontext wird der Begriff »Situation« je nach Theorie und Erkenntnistradition unterschiedlich verwendet und hat im Laufe der Zeit einen großen Bedeutungswandel vollzogen. Interessant ist, dass der Begriff erst im 17./18. Jahrhundert aus dem gleichbedeutenden französischen Wort »situation« in die deutsche Sprache Eingang gefunden hat. »Das Wort ›Situation‹ wurde ursprünglich synonym mit ›Stellung‹, ›Lage‹, ›Zustand‹ verwendet« (Haupt, 1984, S. 13). Haupt (a. a. O.) zeichnet in seinem Buch nach, wie sich das Verständnis von Situation als Kategorie in den Sozialwissenschaften verändert hat. Stand zunächst die objektiv beobachtbare Situation im Vordergrund, verschob sich der Blick im Laufe der Zeit auf die Handelnden selbst und ihre subjektive Wahrnehmung der Situation. Über die Existenzphilosophie, die den Begriff erstmals thematisierte, die Verhaltenspsychologie mit ihrem Reiz-Reaktions-Schema, die Feldtheorie, welche die Situation in einzelne Kraftfelder mit ihren Kräften zerlegte, hin zu einer verstehenden Soziologie, welche »Situationen als durch Sinngrenzen ausgegrenzte und bestimmte Erlebniswelten definiert« (a. a. O., S. 107), weiterentwickelt durch die Intersubjektivität des symbolischen Interaktionismus und durch die auf die Lebenswelt verweisende Kommunikationstheorie von Habermas gelangt Haupt (a. a. O., S. 108) zum Schluss, dass »Situation immer nur das ist, was vom Subjekt als solche definiert wird«. Er definiert Situation folgendermaßen (a. a. O., S. 108f.):
»Sie hat neben den Gegebenheiten der Umwelt das Subjekt, einschließlich seiner biografischen Erfahrungen, seines Wissensbestandes und seiner Relevanzen, zum konstitutiven Bestandteil und lässt sich beschreiben als aktuelle Perspektive, die als solche weder nur der Welt als Ereignisabfolge noch nur dem Subjekt als dessen Befindlichkeit zugehört, sondern beide vermittelt und Sprache und Lebenswelt als quasi transzendentale Bedingungen hat. Sie ist ein thematisch bestimmter, perspektivischer Ausschnitt der Lebenswelt, ein symbolisch strukturierter Sinnzusammenhang, der gemäß subjektiven Interessen, Relevanzen, Selektionsmechanismen und Organisationsprinzipien eine relative Einheit der Erfahrung von Welt und Wirklichkeit bildet, die als solche schon immer sozial bestimmt und historisch bedingt ist, wie auch das Subjekt selbst. […] Wird Situation als subjektiv ausbuchstabierte Perspektive, als Interpretationsrahmen des Handelns und Erlebens begriffen, so kann die Untersuchung und Beschreibung von Situationen nur über deren Subjekt erfolgen. Sie ist identisch mit dem Versuch der Übernahme von dessen Perspektive, d. h. mit Empathie, die nicht als ein Versetzen in die Innerlichkeit des anderen Subjekts verstanden werden kann, sondern nur als eines in dessen Situation. Solche Versetzung, als Übernahme der Perspektive, bedeutet den Versuch der Identifizierung des Wissens, der Erwartungen, Relevanzen und Handlungspläne und setzt mithin ein geteiltes Symbolsystem und eine gemeinsame Praxis voraus.«
Diese Bestimmung von Situation trifft unser Verständnis sehr präzise. Wie wir mit unseren Erläuterungen des theoretischen Hintergrundes in Teil 3 des Buches zeigen werden, kann die Bedeutung einer Situation nur sozial ausgehandelt werden, wobei alles Wissen darin situativ verankert ist. Hingegen ist es möglich, auf der Grundlage geteilter Symbolsysteme – im Sinne von Grenzobjekten (vgl. Kapitel 3.6) – durch die empathische Versetzung in die Situation die generellen Merkmale einer Situation auch über die Grenzen von Communities of Practice hinweg zu identifizieren. Dies ermöglicht Verständigung über Situationen anhand von geteilten Symbolsystemen über Communities of Practice hinweg. Voraussetzung ist jedoch eine gemeinsame Praxis im Sinne des Praxisfeldes der Sozialen Arbeit.
In der Sozialen Arbeit sind Situationen schon lange Ausgangspunkt für Reflexionen und Gegenstand von Supervision und Fallwerkstätten in der Lehre. Man spricht jedoch in der Regel von »Fällen« und nicht von »Situationen«. Meist lässt sich aber ein weites Verständnis von »Fall« finden, das Handlungsproblematiken, Situationen wie auch zeitlich länger dauernde Fälle anhand von mündlichen Falldarstellungen oder von konkreten Dokumenten umfasst. Wir gehen von diesem umfassenden Fallverständnis aus. Situationen sind dann in Anlehnung an die oben zitierte Definition zeitlich eng gefasste (inter-)subjektive Sinneinheiten in einem konkreten Handlungsfluss.
In den letzten Jahren zeigt sich nun in der Sozialen Arbeit eine Tendenz, vermehrt auf Situationen zu fokussieren und sie für Theoriebildung und Praxisreflexion zu nutzen. So arbeitet Heiner (2010) anhand von Fall- und Situationsbeschreibungen die erforderlichen Handlungskompetenzen der Professionellen der Sozialen Arbeit heraus. Sie (a. a. O., S. 143) begreift Situationen als »räumlich-zeitliche Einheiten, die durch sinnhaftes Handeln mehrerer Personen unter bestimmten äußeren Bedingungen voneinander abgegrenzt, verstanden und gestaltet werden«.
Schönig (2012) setzt in seiner neu entwickelten dualen Rahmentheorie für die Soziale Arbeit die Situation als zentrale Bezugsgröße. »Der Situationsbegriff ist für die duale Rahmentheorie der Sozialen Arbeit von grundlegender Bedeutung. Er beschreibt das Verhältnis der Menschen zu ihrer Umwelt zu einem konkreten Zeitpunkt. An ihn knüpfen sich die Bewertung dieses Verhältnisses sowie mögliche Probleme, Alternativen und Handlungen. Aufgrund seines Bewertungs- und Handlungsbezugs ist der Situationsbegriff nur subjektiv-individuell oder intersubjektiv in Form einer Verständigungsgemeinschaft mit einem konkreten Sinn zu füllen« (a. a. O., S. 262).
Der Begriff »Schlüsselsituation« findet sich u.E. in der Sozialen Arbeit erstmalig in einer konzeptuellen Fassung bei von Spiegel (2000) und Sturzenhecker (2002) im Kontext von Qualitätsentwicklung und dann als Element von methodischem Handeln bei von Spiegel (2004), indem sie Arbeitshilfen für die Gestaltung von Situationen, die Hilfeplanung, die Konzeptionsentwicklung und die Selbstevaluation entwickelt. Als Schlüsselsituationen bezeichnet sie Einzelsituationen, die Diskrepanzerlebnisse erzeugen, absprachebedürftig sind und in ähnlicher Form wieder auftreten. »Solche Situationen haben neben ihrer Individualität viele vergleichbare Elemente, und man greift dabei unwillkürlich auf eigene Erfahrungen in früheren Situationen zurück« (a. a. O., S. 153). Wegen dieses Potenzials zur unhinterfragten Routine plädiert von Spiegel (2013) dafür, dass solche Situationen besonders besprochen und reflektiert werden müssten, um die reaktiven Handlungen in strategische zu überführen.
Wir greifen den Gedanken von Spiegels auf, dass wiederkehrende ähnliche Situationen in der Sozialen Arbeit vorkommen können und für Fachkräfte erkennbar sind. Wir gehen davon aus, dass – wenn die Definition einer Situation intersubjektiv herstellbar ist, wie oben dargestellt – über einen Prozess von intersubjektiver Verständigung auch ähnliche Situationen zusammengefasst werden. Wenn man die Fachkräfte nach typischen, in Variationen wiederkehrenden Situationen im beruflichen Geschehen befragt, die für eine gelingende Professionalität relevant sind, findet man eine bestimmte Anzahl von genannten Situationen. Um diese Situationen bezeichnen zu können, suchten wir nach einem Begriff. Wir ließen uns assoziativ von den Begriffen der Schlüsselqualifikationen, -kompetenzen, -prozesse und -personen leiten, die alle zum Ausdruck bringen, dass es um etwas Zentrales, Wesentliches geht, welches verspricht, weitere Bereiche zu erschließen. Uns ging es dabei nicht um ein mechanistisches Verständnis wie bei einem Türschloss, das nur mit dem passenden Schlüssel zu öffnen ist, sondern um die Metapher des Öffnens, des Ent-Schlüsselns von Information und des Erschließens von Unbekanntem. Schließlich erlaubt ein Blick durch das Schlüsselloch auch einen Blick in den Raum einer bestimmten Schlüsselsituation.
Wir verwenden deshalb den Begriff »Schlüsselsituation«, um solche Situationen zu beschreiben, die Fachkräfte der Sozialen Arbeit als zentrale, ähnlich wiederkehrende Situationen betrachten und deren Gestaltung sie für eine gelingende Professionalität als relevant erachten. Wir gehen davon aus, dass es zwar unzählige einzelne Situationen in der Sozialen Arbeit gibt, die jeweils sehr spezifisch sind. Dennoch lassen sich Ähnlichkeiten entdecken, gemeinsame Merkmale herausarbeiten, die vergleichbare Situationen zu einem Situationenkreis (vgl. Kaiser, 2005b, und die Abbildung 14 in Kapitel 6.2) verbinden lassen. Solch ähnliche Situationen lassen sich dann unter einem bestimmten Fokus zu einer Schlüsselsituation mit dem entsprechenden Titel zusammenfassen.
Aus den Ausführungen zu den Begriffen »Schlüssel« und »Situation« kommen wir nun zu folgender Definition von Schlüsselsituation:
Schlüsselsituationen der Sozialen Arbeit sind jene Situationen des professionellen Handelns, die durch Fachkräfte der Sozialen Arbeit als typisch und im professionellen Geschehen wiederkehrend beschrieben werden. Schlüsselsituationen zeichnen sich einerseits durch generalisierbare und verallgemeinerbare Merkmale aus, die für eine gelingende Professionalität als bedeutsam erachtet werden, andererseits werden die erlebten Situationen in ihrer spezifischen Ausprägung beschrieben. Die Anzahl solcher Situationen wie die Situationen selbst passen sich im Laufe der Zeit den sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen an. Situationen werden aus der Perspektive der Fachkraft als zeitlich nicht unterbrochener Handlungsfluss erlebt und als symbolisch strukturierter Sinnzusammenhang erfahren.
Eine Schlüsselsituation beschreiben wir in einer bestimmten Art und Weise, wie wir nun im nächsten Kapitel zu den Elementen einer Schlüsselsituation ausführen möchten.
Elemente einer Schlüsselsituation
•Jede Schlüsselsituation umfasst die folgenden acht Elemente, die das Gerüst der Arbeit mit Schlüsselsituationen darstellen.
•Titel der Schlüsselsituation
•Situationsmerkmale
•Situationsbeschreibung
•Reflection in Action in den Handlungssequenzen
•Ressourcen
•Qualitätsstandards
•Reflexion anhand der Qualitätsstandards
•Handlungsalternativen
Titel der Schlüsselsituation
Obwohl jede Situation spezifisch ist, geht der Ansatz der Schlüsselsituationen davon aus, dass es immer wieder ähnliche, eben typische Situationen gibt, aus denen das ihnen Gemeinsame auf einer abstrahierten Ebene generalisiert werden kann. Der Titel bestimmt, unter welchem Fokus die Situation betrachtet und beschrieben wird. Es kommen meist mehrere Titel infrage, darum ist die Setzung des Titels eine Entscheidung für eine bestimmte Perspektive.
Schlüsselsituationen finden in verschiedensten institutionellen Kontexten und mit unterschiedlicher Klientel statt. Ebenso variiert das Thema je nach Problem und Auftrag. Deshalb hilft es, wenn Titel mit Kürzestangaben zum Kontext ergänzt werden. Im nächsten Kapitel stellen wir beispielhaft die Situation »Positive Erfahrungen ermöglichen/Eltern-Kinder-Quartiertreff« vor. Dieser Titel umschreibt schon ziemlich treffend, um welche Situation es sich handelt.
Situationsmerkmale
Um das Typische und Verallgemeinerbare einer Situation herauszuarbeiten, wird nun für alle typischen, ähnlichen Situationen mit demselben Titel das ihnen Gemeinsame auf einer abstrahierten Ebene beschrieben. Diese Merkmale definieren alle Situationen, die im beruflichen Handeln den Titel »positive Erfahrungen ermöglichen« tragen können. Sie verallgemeinern z. B. also das typische Beispiel, das, was sich vergleichbar auch in anderen institutionellen Kontexten mit anderer Klientel ereignen kann. Die genannten Merkmale gelten also in jeder Situation, unabhängig vom jeweiligen Kontext.
Situationsbeschreibung
Eine Schlüsselsituation schildert konkret eine spezifische Situation in einem bestimmten Kontext mit einer entsprechenden Klientel. Sie wird möglichst nah am Geschehen beschrieben und führt so den Handlungsfluss vor Augen. Der spezifische institutionelle Kontext, die zu bewältigende professionelle Herausforderung sowie die gewählte Art des Vorgehens werden skizziert.
Reflection in Action in den Handlungssequenzen
Gemäß Schön (1983) findet in jeder Situation eine meist unbewusste Reflexion statt, welche die Handlung und das Verhalten steuert. Er nennt dies »reflection in action«. Solche Reflexion kann im Nachhinein herausgearbeitet und so dem Bewusstsein zugänglich gemacht werden. Durch diese Rekonstruktion der Reflection in Action können Wissen, Emotionen, Befindlichkeiten und Handlungsheuristiken herausgearbeitet werden, welche in der Situation handlungsleitend waren. Indem implizites Wissen bewusst gemacht und beschrieben wird, wird es einem fachlichen Diskurs zugänglich. Die Schlüsselsituation wird dazu in Sequenzen im Handlungsfluss unterteilt, um die Situation inhaltlich zu strukturieren. Die Strukturierung reduziert die sonst kaum fassbare Komplexität der Situation. Danach wird zu jeweils einer solchen Sequenz die Reflection in Action hinsichtlich Emotion und Kognition herausgearbeitet. Dabei wird die Perspektive der Professionellen der Sozialen Arbeit (PSA) eingenommen, für die Emotion auch noch die Perspektive der Klienten und Klientinnen (K). Dadurch wird ein umfassendes Bild der Situation beschrieben, das danach die Reflexion über die in der Situation herrschenden Gefühle, Gedanken und impliziten Wissensbestände ermöglicht und somit auf Wissen wie auf Praxis bezogen ist. Die Bündelung und das Aufeinanderbeziehen der verschiedenen Aspekte fördert die Integrationsleistung und die berufliche Identitätsentwicklung.
Ressourcen
Wollen wir Situationen professionell gestalten, so brauchen wir Wissen und Verfahren, setzen unsere Fähigkeiten ein und berücksichtigen die Rahmenbedingungen. Alle diese Hilfen auf dem Weg zu einer gelungenen Situationsgestaltung nennen wir im vorliegenden Modell »Ressourcen«. Der Begriff wird also anders verwendet als in der Sozialen Arbeit sonst üblich (Ressourcenerschließung, Ressourcen von Klientinnen und Klienten, Ressourcen des Umfeldes u. a. m.). Doch die Intention ist eine ähnliche: Wir wollen uns bewusst werden, was uns alles an Ressourcen zur Verfügung steht, wenn wir in einer Situation handeln. Vielleicht werden nicht alle Ressourcen zur Zielerreichung gebraucht, dennoch liegen sie bereit.
Die Ressourcen bestehen zum einen aus Wissensbeständen und Fähigkeiten und zum anderen aus materiellen und immateriellen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen (siehe Abbildung 1 in Kapitel 2.1). Konkret unterscheiden wir folgende Ressourcen:
| Erklärungswissen | Warum handeln die Personen in der Situation so? Erklärungen zu sozialen Problemen, Verhalten, Prozessen … |
|---|---|
| Interventionswissen | Wie kann ich als professionelle Fachperson handeln? Methoden, Verfahren, Planungshilfen, Gesprächsführung … |
| Erfahrungswissen | Woran erinnere ich mich, was kenne ich aus ähnlichen Situationen? Eigene Erfahrungen wie auch Erfahrungen von Mitarbeitenden |
| Organisations- und Kontextwissen | Welche Rahmenbedingungen beeinflussen mein Handeln? Auftrag der Organisation, sozialpolitische Zusammenhänge, rechtliche Grundlagen … |
| Fähigkeiten | Was muss ich als professionelle Fachperson können? Empathisch sein, wahrnehmen, kommunizieren, kooperieren, Prozesse gestalten, (sich selbst) reflektieren … |
| Organisationale, infrastrukturelle, zeitliche, materielle Voraussetzungen | Womit kann ich handeln? Materielle, zeitliche Möglichkeiten, infrastrukturelle Gegebenheiten, organisationale Setzungen … |
| Wertewissen | Woraufhin richte ich mein Handeln aus? Welches sind die zentralen Werte in dieser Situation, die ich als handelnde Fachperson berücksichtigen will? Haltung, Berufskodex, Menschenbild … |
Die Frage entscheidet, welches Wissen wozu genutzt wird. Zum Beispiel kann rechtliches Wissen als verinnerlichter Code eine Handlung erklären oder als Wert das Handeln leiten oder auf Verordnungsebene sogar ein Verfahren vorschreiben.
Um Wissensressourcen zu finden, gehen wir zunächst von der Reflection in Action aus. Darin findet sich das implizite Wissen der handelnden Person. Diese Spuren führen uns zum dahinterliegenden expliziten Wissen.[3] Darauf aufbauend, können weitere hilfreiche Ressourcen recherchiert werden.
Um nun wirklich Wissen und Handeln aufeinander zu beziehen, muss dieser Schritt sehr konkret vollzogen werden. Die Fragen müssen wissens- und situationsbezogen beantwortet werden. Eine reine Auflistung von Stichworten ist wenig hilfreich. Die Ressourcen sind so zu beschreiben, dass sie spezifisch und verständlich sind. Begriffe und Konzepte müssen zuerst mit ihren Prämissen, Inhalten und Erklärungswerten dargestellt und dann jeweils konkret auf die Situation bezogen werden. Die Leitfrage lautet: Wozu ist dieses Wissen nun genau in dieser Situation hilfreich?
Die Auswahl und Nutzung der genannten Ressourcen unterliegt in einem gewissen Maße der persönlichen Autonomie und Gestaltungsfreiheit. Die persönliche Haltung bildet die Basis, auf der letztendlich entschieden wird, wie welche Gewichtungen vor- und welche Perspektiven beim Handeln eingenommen werden. Diese Haltung fußt auf professioneller Ethik und Wertewissen, das auch benannt wird.
Alle die genannten Ressourcen können die gelingende Gestaltung der Situation unterstützen. Sie müssen aber nicht zwingend alle eingesetzt werden, um Professionalität zu gewährleisten. Ausschlaggebend für die Qualität einer Situationsgestaltung ist die Erfüllung von Qualitätskriterien, die als »Qualitätsstandards« bezeichnet werden (vgl. Kaiser, 2005b).
Qualitätsstandards
Professionalität verlangt danach, eine Situation nach bestimmten Qualitätsstandards zu gestalten. Die vorher beschriebenen Ressourcen unterstützen, dass die erforderliche Qualität erreicht wird, erst die Standards legen aber die zu erreichenden Gütekriterien fest.