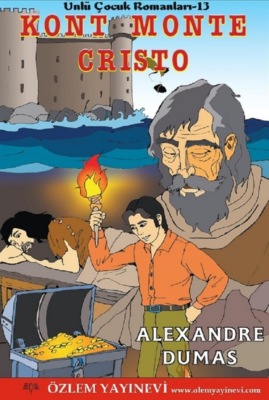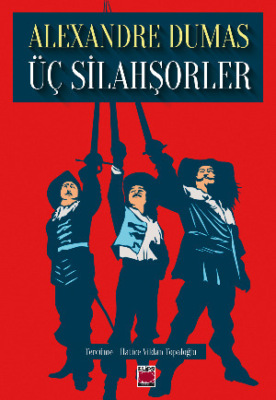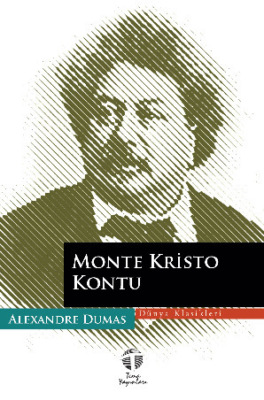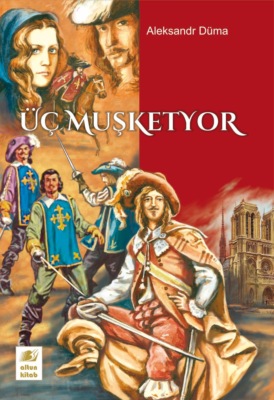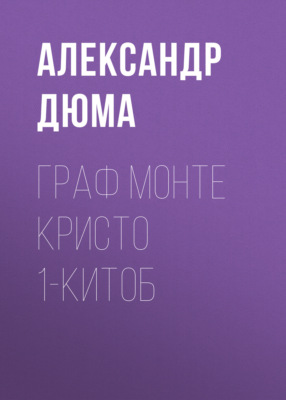Kitabı oku: «Der Graf von Moret», sayfa 65
Richelieu trat auf Chicot zu und flüsterte demselben sehr leise eine Frag,« deren Beantwortung ihn außerordentlich zu interessiren schien, ins Ohr.
Chicot erwiderte eben so rasch als bestimmt gleichfalls leise: .
»Es ist mir zwar ein Räthsel, zu welchem Zwecke Ihr gerade diese Frage stellt, aber als zuverlässig könnt Ihr es annehmen, daß das physische Vermögen, von welchem Ihr sprecht, unter seinem jetzigen Zustande, auch wenn derselbe der ärztlichen Kunst dauernd spotten sollte, nicht leidet, im Gegentheile – — —.«
»Dann ist Alles gut,« erwiderte Richelieu froh aufathmend und verließ elastischen Trittes die Zelle des wahnsinnigen Grafen von Moret, nachdem er Chicot, Dubois und de Lerida ebenso freundlich als huldvoll mit der Hand zum Abschiede zugewinkt hatte.
VII.
Ein Fischrecht und seine Folgen
Chicot hatte seinen großen und wohlverdienten Ruf als Arzt durch den gethanen Ausspruch, daß der Graf von Moret lange, lange Zeit zu seiner Herstellung bedürfen werde, wenn solche überhaupt möglich sei, neuerdings gerechtfertigt, denn beinahe sind sechs volle Jahre verstrichen, ohne daß der stille Wahnsinn, welcher seinen Geist umnachtete, seither auch nur auf eine Stunde gebannt werden konnte.
Er befand sich noch immer unter Dubois Obhut in Rouen und ein junger Arzt, in welchen Chicot besonderes Vertrauen setzte, leitete, seit der Kranke in seinem neuen Asyle sich befand, die Cur, welche insoferne nicht ganz resultatlos erschien, als der Wahnsinnige von den Anfällen der Tobsucht, welche im ersten Jahre ihn zeitweise überkommen halten, nicht wieder heimgesucht worden war. Seit dieser Zeit vegetirte der Kranke ruhig und harmlos fort wie ein Kind, ohne Erinnerung an die Vergangenheit, ohne alle Sorge für die Zukunft. – Er schien für alle geistigen Eindrücke, welch immer Art, ganz unempfänglich geworden zu sein, äußerte jedoch einen gewissen Sinn für physisches Wohlbehagen, ein Umstand, welcher mit Recht von Chicot als die Achillesferse seiner Krankheit bezeichnet wurde.
Der Cabalero de Lerida, welcher schon bei der Abreise von Toulouse die sich freiwillig auferlegte geistliche Buße für seinen von ihm im Duelle getödteten Wohlthäter für abgethan betrachtete und deshalb noch in jener Nacht die Mönchskutte von sich geworfen hatte, hielt sich seither nicht permanent in Moret's Nähe auf, sondern reiste wieder wie früher fleißig im Dienste des Cardinals zwischen Brüssel und Paris, wobei er jedoch nie unterließ, entweder auf der Hin- oder Rückreise, und wenn es nur irgendwie anging auch zu beiden Malen, den Umweg über Rouen zu wählen, und dann dort einige Tage zu verweilen.
Diese kurzen Aufenthalte de Lerida's Rouen hatten für den armen Wahnsinnigen immer Visionen sehr angenehmer Art im Gefolge, denn die Gräfin von Urbano erschien ihm dann in den nächtlichen Stunden nicht mehr als jenes drohende, mit den Wellen im verzweiflungsvollen Kampfe ringende Gespenst, sondern als eine lebenswarme, liebeglühende Gestalt, deren – Küsse auf seinen Lippen wie Feuer brannten, sein Blut und seine Begierden entflammend. – — —
Die Zufriedenheit, welche auch de Lerida über diese nächtlichen Visionen des Wahnsinnigen zu fühlen schien, scheint uns zu dem Schlusse zu berechtigen, Chicot habe in der That einen richtigen Ausspruch gethan, als er den Cardinal mit der Versicherung beruhigte, daß die Störung, welche des Grafen von Moret Geist erlitten, auf seine physischen Vermögen keinen abträglichen Einfluß äußern werde.
Bevor wir es unternehmen, ein höchst wichtiges Ereigniß, das aus den in Rede stehenden »Visionen« entsprang und die kühnen, rücksichtslosen Pläne des Cardinals für Frankreichs Zukunft endlich krönen sollte, müssen wir die hervorragendsten geschichtlichen Ereignisse, welche sich in der Zeit von Ende October 1632 bis zum Herbste 1638 in Frankreich zutrugen, in thunlichster Kürze dem Leser vorführen, um unserem Versprechen, ein getreues Bild der damaligen Verhältnisse zu liefern, gewissenhaft nachzukommen.
Wie wir schon in einem früheren Capitel und zwar bei der Schilderung von Montmorencys Ende erwähnten, durfte sich Monsieur von Beziers nach Tours zurückziehen.
Die Anhänger Gastons von Orleans, welche ihn dahin begleitet hatten, hielten sich aber in Tours nicht für sicher; sie fürchteten, es könnte Richelieu, sobald der Proceß in Toulouse sein Ende fand, über kurz oder lang das Verlangen anwandeln, in Tours ein kleines Nachspiel zu veranstalten.
Monsieur, der in Tours unter strenger Bewachung stand und sehr knapp gehalten wurde, so daß er weder Gelegenheit noch Geld besaß, seinen gewohnten lockeren Neigungen nachzuhängen, war unschwer von seinem Gefolge zur Flucht zu bewegen, welche auch am 6. November 1632, also merkwürdiger Weise gerade an dem Tage, an welchem der große Held Gustav Adolph von Schweden seinen Tod bei Lützen fand, ohne alle Hindernisse glücklich vor sich ging, denn die bisher so strengen Wächter waren plötzlich rein taub und blind geworden für Alles, was um sie her vorging. Ohne Paris zu berühren und unter Weges nirgends auch nur im geringsten incommodirt, erreichten die Flüchtlinge am 20. November Brüssel.
Monsieur und seine Begleiter, welche, wenigstens vorläufig, auf Geldrimessen ans Frankreich nicht rechnen durften, waren ehrlos genug, von den Feinden ihres Vaterlandes Apanagen anzunehmen, nach dem Beispiele der Maria von Medicis, welche eine solche schon lange genoß.
Betrachten wir nun etwas näher die politische Lage von Frankreich und Deutschland.
Der Tod Gustav Adolphs gab den deutschen Angelegenheiten eine neue Wendung und vermehrte den Spielraum des Cardinals. Bis zu diesem Zeitpuncte hatte Richelieu mehr die bloße Demüthigung und Schwächung des Hauses Oesterreich als die Vergrößerung Frankreichs im Auge behalten können. Das Ereigniß von Lützen jedoch erweckte in ihm lebhaft den Wunsch nach den sogenannten natürlichen Grenzen Frankreichs, d. h. nach dem Rhein. Ohne einen offenen Krieg mit Oesterreich war jedoch eine solche Gebietsvergrößerung nicht denkbar. Vor Allem wollte Richelieu die Schweden bewegen, ihre Eroberungen am linken Rheinufer, wozu der Elsaß gehörte, an Frankreich abzutreten. So lange Gustav Adolph lebte, durfte ein solches Ansinnen, ohne die guten Beziehungen Schwedens zu Frankreich zu gefährden, nicht einmal gestellt werden.
Jetzt aber, nach dem Tode des großen Schwedenkönigs, konnte und mußte es den Führern der Protestanten in Deutschland sehr erwünscht sein, wenn Frankreich sich offen gegen Oesterreich erklärte und dadurch Wallenstein's Siegeslaufbahn ein Ziel steckte.
Die Erschöpfung eines bereits volle vierzehn Jahre andauernden barbarischen Krieges machte sich an Oesterreich sehr bemerkbar und auch Spanien siechte an den Nachwehen des niederländischen Unabhängigkeitskampfes dahin.
Zudem standen Oesterreich und Spanien fast ohne alle namhaften Alliirten da, weil die religiöse Uuduldsamkeit, welche in beiden Staaten als oberste Regierungsmaxime galt, nicht nur ganz Europa, sondern auch die Mehrzahl der eigenen Unterthanen wider sie aufgebracht hatte.
Ungeachtet der Fehden, welche Maria von Medicis und Gaston von Orleons zeitweise im Innern Frankreichs anstifteten und zum Ausbruche brachten, stand dieses im Vergleiche zu dem gänzlich zerrütteten Oesterreich und Spanien als eine concentrirte große Macht da, welche durch einen Krieg im eigentlichen Sinne des Wortes noch gar nicht gelitten hatte.
Ludwig XIII., für Kriegsruhm sehr empfänglich, lieh willig sein Ohr den Rathschlägen Richelieus, vorläufig die Protestanten in Deutschland und die Holländer mit Geld zu unterstützen, inzwischen aber, im Geheimen zu rüsten, um im günstigsten Momente mit einer imposanten Macht als Vermittler aufzutreten. Der König gab zu den kühnen Plänen des Cardinals seine volle Zustimmung und dieser zögerte nicht, alle Einleitungen zu treffen.
Auf der Rückreise von Toulouse nach Paris wurde jedoch Richelieu plötzlich so krank, daß er in Bordeaux zurückbleiben mußte. Ludwig XIII., der sich nur in Paris und Umgebung wohl fühlte, und sehr häufig an das Kloster der Büßerinnen in der Rue des Postes dachte, reiste nach St. Germain weiter. Der Zustand des Cardinals verschlimmerte sich binnen wenigen Tagen derart, daß man stündlich seinem Ableben entgegensah. Hierzu mag sehr viel der Umstand beigetragen haben, daß er sich der Behandlung eines fremden Arztes anvertrauen mußte, denn Chicot, der ihn schon an fünfzehn Jahre behandelte, war, wie wir wissen, in des Bischofs Dubois Gefolge nach Rouen aufgebrochen.
Inzwischen wurde Richelieu von seinen Feinden bereits für todt ausgegeben. Was man wünscht, hält man eben gerne für wahr. – Das Gerücht von seinem Tode wurde sogar bis Brüssel verbreitet; die Königin-Mutter und ihr würdiger Sohn Gaston feierten auf solches hin Feste über Feste, aber – zu früh.
Selbst die Königin Anna war so unklug, daß sie an dem Tage, an welchem die Aerzte den Cardinal aufgaben einen Kammerball veranstaltete. – Diesem wohnte der Großsiegelbewahrer Châteauneuf bei, welchen die Königin bei dieser Gelegenheit den Anwesenden als Richelieus Nachfolger vorstellte. – Auch der Chevalier von Jars, dessen Proceß später eine so traurige Berühmtheit erlangte, war zugegen und äußerte laut seine Freude über des Cardinals Ableben.
Dieser aber machte den Ausspruch seiner Aerzte zu Schanden und überstand glücklich die schwere Krisis. Chicot welcher zwei Tage, nachdem der Cardinal wieder Aussicht auf Genesung hatte, in Bordeaux eingetroffen war, leitete nun ausschließlich die weitere Behandlung des Kranken, der sich auffallend schnell erholte.
Wie ein erzürnter Löwe trat jetzt Richelieu unter seine Feinde.
Der Großsiegelbewahrer Laubespine von Châteauneuf wurde seines Amtes entsetzt und in das Schloß von Angoulème eingesperrt. – Der Chevalier von Jars, aus der Familie Rochechouart, mußte in die Bastille wandern, wo er elf Monate in einem feuchten Kerker verblieb, bis ihm die Kleider herabfaulten. Dann wurde er nach Troyes abgeführt und über ihn ein Specialgericht eingesetzt, dessen Vorsitz ein gewisser La Feymas, Intendant der Champagne und Großjägermeister von Frankreich, führte.
Dieser Mensch verdiente den Beinamen, den ihm die öffentliche Meinung gab; er war nämlich allgemein unter dem Namen »der Henker des Cardinals« bekannt. – Um den Absichten Richelieus nachzukommen, stand ihm jedes Mittel zu Gesicht. Handelte es sich darum, ein Geständniß zu erlangen, wandte er Versprechungen, Drohungen, Lügen und verfängliche Fragen an. – Gelang dies nicht, so nahm er zu Bitten, Zusagen und Thränen seine Zuflucht; er zeigte sich tief betrübt über das Schicksal seines Angeklagten, umarmte denselben herzlich und schwor, daß kein Wort des Bekenntnisses über seine Lippen kommen solle. – Nützte auch dies nicht, so kehrte er den strengen, unerbittlichen Richter heraus, ließ die Folterwerkzeuge bringen, zwang den Gefangenen Stück für Stück zu besehen und zu betasten, erklärte den Gebrauch und Zweck eines jeden und schilderte mit Wollust die Qualen, die sie verursachten.
In die Hände eines solchen Scheusals legte man den Proceß des Chevaliers de Jars.
Nicht weniger als vierundzwanzig peinliche Fragen wurden an ihn in der Marterkammer gestellt. Man wollte aus ihm ein Geständniß erpressen, daß er mit Spanien und mit den Verbannten in Brüssel eine Correspondenz unterhalten habe.
Alle Künste von La Feymas scheiterten jedoch an de Jars Geistesgegenwart und Standhaftigkeit.
Ungeachtet er kein einziges Geständniß abgelegt hatte, wurde er dennoch zur Enthauptung auf dem Marktplatze von Troyes verurtheilt.
Man versprach ihm Gnade, wenn er bekenne. Er blieb unerschütterlich. Man ließ ihn das Schaffot besteigen, der Henker holte zum Todesstreiche aus. – Weiter zu gehen hatte der Cardinal verboten. – La Feymas zeigte ihm also nun in süßlichen Worten seine Begnadigung an. De Jars vernahm diese Kunde eben so ruhig wie früher sein Todesurtheil. – Die Begnadigung bestand aber darin, daß man ihn in seinen Kerker zurückführte und ihn dort noch mehrere Jahre vertrauern ließ. Endlich erhielt er die Erlaubniß, ins Ausland zu reisen.
De Jars und Châteauneuf hatten also ziemlich theuer die Freuden einer Ballnacht und ihren vorzeitigen Jubel über Richelieus Tod bezahlt.
Wir müssen hier noch eines Vorfalles erwähnen welcher uns beweist, wie weit es der Cardinal in der kurzen Zeit, seit er erster Minister geworden, in der Unterjochung des früher so stolzen und unbändigen Adels gebracht hatte.
Der alte Herzog von Epernon, welcher seit fast sechzig Jahren eine so große Rolle in der Geschichte Frankreichs gespielt hatte und bekannt durch seinen maßlosen Stolz, den er früher sogar dem Könige gegenüber nicht zu zügeln beliebte, war bereits einmal,und zwar nach der Flucht der Königin-Mutter, wie wir bereits bemerkten, gezwungen worden, dem Cardinal öffentlich Abbitte zu leisten, um einen Proceß, dessen Ausgang zu seinen Ungunsten nicht zweifelhaft sein konnte, von sich abzuwenden.
Diese Demüthigung und der Mißerfolg, welchen sein Kniefall vor dem Könige in Toulouse hatte, als er um Montmorencys Leben bat, bestimmten ihn, seit Kurzem wieder einmal seinen Aufenthalt in Bordeaux zu nehmen. Aus besonderer Gnade hatte ihm nämlich der König das Gouvernement der Provinz Guyenne belassen.
Während seines Aufenthaltes in Bordeaux hatte sich Epernon gegen Richelieu, den auch er bereits als einen todten Mann ansah, sehr wenig liebenswürdig benommen. Der Cardinal sehnte sich daher nach einer Gelegenheit, um den alten Epernon, den sein gewohnter Hochmuth wieder befallen, ordentlich zu kränken; die Gelegenheit bot sich nur zu bald dar, und Richelieu ließ sich solche nicht entschüpfen.
Epernon hatte mit Herrn Henri de Sourdes, Erzbischof von Bordeaux, nie im besonders guten Einvernehmen gelebt, denn de Sourdes war ein Hitzkopf und noch dazu ein eifriger Anhänger Richelieus.
Der offene Bruch zwischen Epernon und de Sourdes wurde durch eine etwas bizarre Ursache, welche uns jedoch die damalige Zeit und deren Sitten kennen lehrt, herbeigeführt.
Der Herzog von Epernon genoß nämlich bezüglich des Fischverkaufs in Bordeaux ein uraltes Feudalrecht, welches darin bestand, daß er den Zutritt auf den Fischmarkt den Bewohnern der Stadt nach Belieben verwehren durfte. Von diesem Privilegium machte er im Februar 1633 den Leuten des Erzbischofs gegenüber Gebrauch. Dieser versuchte es nun, seinen Fischbedarf von einem andern Orte zu decken, aber vergeblich, denn der Herzog hatte den erzbischöflichen Palast mit Wachen umstellen lassen, welche jeden Fischhändler, der die Küche des Herrn de Sourdes mit den Produkten des Flusses oder der See versorgen wollte, ohne viele Umstände fortjagten.
Es kam zu Schlägereien zwischen den Leuten des Erzbischofs und des Herzogs von Epernon, und da der letztere der Stärkere war, passirte es sogar, daß Herr von Sourdes sammt seinem ganzen Domcapitel an einigen Fasttagen wirklich fasten mußte. Dieses Leid verzieh der an seiner verwundbarsten Stelle hart getroffene Kirchenfürst dem übermüthigen Gouverneur nie und nimmer.
Der Erzbischof führte bei der Stadtbehörde Klage und drohte, wenn man seinen wohlbegründeten Beschwerden nicht gerecht würde, mit dem gesammten Clerus Bordeaux zu verlassen.
Epernon sandte seinen Gardelieutenant zu dem Erzbischofe und ließ diesen fordern.
Der Erzbischof machte von seinen geistlichen Rechten Gebrauch und excommunicirte den Gardelieutenant. In der Excommunications-Sentenz flehte er die göttliche Gnade um Belehrung der Sünder an.
Der Herzog von Epernon, hierdurch noch mehr gereizt, erließ eine Ordonnanz, in welcher er jedwede Versammlung im Palaste des Erzbischofs verbot, wovon nicht einmal jene kirchlichen und religiösen Zusammenkünfte ausgenommen waren, welche Herr de Sourdes mit den Geistlichen seiner Diöcese regelmäßig abzuhalten pflegte. Eine ganze Kette von Wachen umlagerte das erzbischöfliche Palais und hielt den Befehl des Gouverneurs strenge aufrecht.
Der Erzbischof, der sich auf eine unläugbar ganz widerrechtliche Weise in seinem eigenen Hause belagert sah, warf sich in sein kirchliches Gewand, setzte die Bischofsmütze auf, nahm den Krummstab zur Hand und gefolgt von seinem Clerus, schritt er durch die Straßen von Bordeaux.
Auf den Hauptplätzen hielt de Sourdes Ansprachen an das zusammenströmende Volk, welches, ohnehin den stolzen Epernon ingrimmig hassend, entschieden die Partei des Erzbischofs ergriff.
Epernon von der gefährlichen Bewegung benachrichtigt, eilte herbei. Bewaffnete Bürger begannen sich um de Sourdes und sein Gefolge zu schaaren.
Der Gouverneur fuhr den Erzbischof rauh an, schalt ihn einen Aufrührer und forderte barschen Tones, daß er sich sogleich in sein Palais zurückziehe. Dabei hob er gebieterisch seinen Marschallstab in die Höhe.
Der Erzbischof, letztere Pantomime irrig verstehend, schrie mit vor Zorn halb erstickter Stimme:
»Schlage zu, schlage zu, Tyrann! Du bist excommunicirt!«
Epernon, gleichfalls außer sich vor Wuth, schlug mit seinem Stabe dem Erzbischofs die Mitra vom Haupte und den Krummstab aus der Hand.4
Einige besonnene Edelleute und Bürger legten sich ins Mittel; Epernon und de Sourdes würden sonst handgemein geworden sein, gleich zweien Gassenjungen.
Der Erzbischof eilte in seine Cathedrale und schleuderte von der Kanzel eine neue Exkommunication herab, in welcher Epernon mit inbegriffen war. Alle Kirchen der Stadt und auch jene von Cadillac, wo das Schloß des Herzogs von Epernon lag, wurden mit dem Interdicte belegt.
Diese Maßregel ging jedenfalls etwas zu weit, denn dadurch wurde die Einwohnerschaft, welche doch für de Sourdes entschieden Partei genommen hatte, am härtesten betroffen.
Ein königlicher Befehl beschränkte auch alsbald diese Excommunication blos auf Epernon und seine Leute.
Gleichzeitig gelangte aber auch an das Parlament von Bordeaux der Befehl, wider Epernon den Proceß einzuleiten. Dieser Proceß endigte damit, daß der alte Hochmuthsteufel aller seiner Würden entkleidet und auf seine außerhalb der Guyenne gelegene Besitzung Plassac für Lebensdauer verbannt wurde; diese Verbannung und die Excommunication wurden indeß etwas später unter sehr erniedrigenden Bedingungen wieder aufgehoben. Epernon blieb seiner Ehrenstelle verlustig, mußte dem Erzbischofe de Sourdes einen höchst demüthigen Brief schreiben und vor der Kirche von Coutras auf den Knieen vor dem ganzen Volke eine scharfe Strafpredigt anhören, worauf er erst die Absolution erhielt.
Noch vor zehn Jahren würde ein Mann wie Epernon, bevor er sich zu einer solch furchtbaren Erniedrigung herbeiließ, eine Armee angeworben und offen gegen den König revoltirt haben, aber die blutigen Beispiele eines Marillac und Montmorency hatten eine tiefe Wirkung selbst auf einen Epernon hervorgebracht und wir können nach einem solchem Erfolge, den die rücksichtslose Strenge Richelieus zu Gunsten der königlichen Autorität aufweist, nur zugeben, daß diese mitunter scheinbar an Barbarei grenzende Strenge am Ende für die damaligen Zeiten und Verhältnisse eine traurige Notwendigkeit gewesen sei.
Denn wenn auch in den übrigen Staaten der Adel eine den Regenten mehr oder minder gefährliche Stellung einnahm, so war zuverlässig im 16. und l7. Jahrhunderte der französische Adel der unbändigste, verschwenderischste und ehrsüchtigste in ganz Europa, und mit diesen catilinarischen Existenzen ließ sich, sollte je das Gesetz und die königliche Autorität dauernd zur Geltung gelangen, in der That nicht anders rechten und auskommen als noch dem drakonischen Systeme Richelieus.
VIII.
Die Teufel von Loudun
Wenn durch die vorhergehenden Capitel der Leser in die heillose Adelswirthschaft, wie solche zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts in Frankreich mehrfache, mit der socialen Ordnung unverträgliche und der königlichen Autorität schroff gegenüberstehende Gegensätze bildete, einen Einblick bekam, so wird ihm der berühmte Process des unglücklichen Urbain Grandier, Pfarrer von Sainte-Pierre und Domherr des heiligen Kreuzes zu Loudun, einen wahrhaft überraschenden Beleg liefern, in welch' hohem Grade damals der dümmste Aberglaube und fanatische Grausamkeit tonangebend gewesen seien.
Grandier war von einer seltenen männlichen Schönheit, gelehrt, ein vortrefflicher Redner nicht blos von der Kanzel herab und verband mit einem bezaubernden Benehmen auch alle übrigen Talente, und in der Gesellschaft zu glänzen. Dabei besaß er aber einen unbezähmbaren Hang zur Satyre und eine eigene Gabe, jeden, der ihm nicht zu Gesichte stand, auf eine fast unmerkliche aber tödtliche Art zu verletzen und zu reizen. Seine Aufmerksamkeiten gegen das weibliche Geschlecht zogen ihm den Haß und Neid der Männerwelt in reichlichem Maße zu und überschritten jedenfalls die ihm in dieser Beziehung von seinem Stande vorgezeichneten Grenzen, denn in den vielen Processen, welche ihm seine Galanterien zuzogen, erschien er diesfalls immer mehr künstlich weißgewaschen als wirklich unschuldig.
Gegen Ende 1633 hatte Grandiers Ausführung und Benehmen in dem kleinen Loudun bereits eine gewaltige Agitation hervorgerufen, als eine satyrische Schrift, betitelt: »Die Schusterin von Loudun,« großes Aufsehen machte.
Die Heldin dieses Gedichtes war die berüchtigte Hammon, eine »allgemeine« Dame, welche etwa ein Jahr lang, und zwar zur Zeit des Krieges von Angers, unter dem Küchenpersonale der Königin-Mutter gedient und zu jener Zeit in umfassendster und zuvorkommendster Weise dem Amusement der Hofdienerschaft und mitunter auch von Höhergestellten sich gewidmet hatte.
Hammon war in die ganze überreiche Chronique scandaleuse, welche sich am Hofe der Maria von Medicis abspielte, tief eingeweiht, und es ist ein bis heute noch nicht näher aufgeklärter Umstand, warum die Königin-Mutter zuweilen das hübsche Küchenmädchen zu sich kommen ließ und dasselbe dann immer durch längere Zeit in ihren Gemächern behielt.
Diese Vertraulichkeit und ihre sonstigen Erlebnisse verliehen der Hammon, als sie in ihre Vaterstadt zurückgekehrt war, in den Augen der guten Louduner eine große Wichtigkeit und Jedermann geizte, ohne Rücksicht auf das »vielerfahrene« Vorleben dieser Dame, nach der Ehre, aus ihrem eigenen Munde ein Histörchen vom Hofe zu vernehmen. Auch Pater Grandier machte hiervon keine Ausnahme und beliebte die Erzählungen der Hammon noch weiter nach seiner Art, nämlich mit höchst beißenden satyrischen Bemerkungen auszuschmücken und im Kreise seiner Bekannten, das heißt von ganz Loudun weiter zu verbreiten.
Für Solche, welche die von Grandier redigirten und verbesserten Erzählungen der Hammon auch nur einmal aus dem Munde des witzigen Pfarrers von Sainte-Pierre angehört hatten, erforderte es in der That sehr wenig Scharfsinn, um nicht denselben mit vollster Ueberzeugung für den Verfasser: »Der Schusterin von Loudun« zu halten.
Höchst unkluger Weise hatte es sich Grandier beikommen lassen, dabei auch auf den Cardinal Richelieu einen ganzen Köcher vergifteter Pfeile abzuschießen.
Richelieu, welcher durch seine allwissende Polizei sowohl von der Satyre, als deren Verfasser unverzüglich Kenntniß erhielt, schwur sich zu rächen.
Zum Unglücke für Grandier waren wider ihn in Loudun neuerdings mehrere Ehemänner, welche sich durch ihn an der Ehre gekränkt glaubten, in eine große Erbitterung gerathen und schlossen sich denselben einige Damen an, zu denen Grandier früher in freundschaftlichster Beziehung gestanden, deren Umgang er aber in Folge neuerer und anziehenderer Bekanntschaften schon seit längerer Zeit vernachlässigt hatte.
Um diese Zeit dumpfer Gährung kam ganz unvermuthet der berüchtigte Staatsrath Laubardemont in Loudun an. Richelieu hatte ihm den Auftrag ertheilt, die Befestigungen der kleinen Städte, welche die Protestanten vor ihrer allgemeinen Niederlage innegehabt, zu schleifen. Dazu gehörte Loudun und Laubardemont hielt sich deshalb dort einige Tage auf.
Laubardemont kann mit Niemanden verglichen werden, als mit dem Scheusale La Feymas, denn auch er war ein Mensch ohne alles Mitleiden, gierig ein Verbrechen aufzustöbern, grausam zu seinem Vergnügen und den Tod eines Missethäters für nichts zählend, wenn derselbe nicht von den gräßlichsten Martern begleitet war.
Ganz Loudun gerieth durch die Ankunft dieses Mannes in Bewegung; man beeilte sich ihm den Hof zu machen und zu seinen Ehren Feste zu veranstalten. Bei dieser Gelegenheit zog Laubardemont, wie unabsichtlich, nähere Erkundigungen über den allzuweltlich gesinnten Grandier ein und notirte sich insgeheim die hunderterlei Klagen und Beschwerden, die ihm zugetragen wurden.
Ein Zufall begünstigte Laubardemont's heimliches Verlangen, wider Grandier einen Vorwand zu einem gewichtigen Criminalprocesse zu erlangen.
In Loudun befand sich ein kleines Ursulinerkloster, welches bis dahin sehr wenig von sich reden machte. – Auf einmal verbreitete sich das Gerücht von außerordentlichen Dingen, die in dem gedachten Nonnenkloster vorgehen sollten. Man sprach von nächtlichem Klagegeschrei, von einem dumpfen Sausen und Brausen und von Gespenstern, welche die Ruhe der Jungfrauen der heiligen Ursula störten. – Binnen Kurzem sprach man in Loudun von Früh bis Abends von nichts mehr als von dem Teufel, der in dem Kloster spuke. Unter den Nonnen selbst herrschte Angst und Schrecken. Verschärfte Bußübungen wurden angestellt, Processionen abgehalten, öffentliche Gebete angeordnet und förmliche Teufelsbeschwörungen fanden statt. Alles umsonst; Monsieur Belzebub war aus den heiligen Räumen nicht zu vertreiben.
Als diese Teufelswirthschaft längere Zeit angedauert hatte, wurden eines schönen Morgens mehrere Nonnen von somnambulen Zuständen befallen; statt dies einem überspannten Nervenreize zuzuschreiben, erklärte man die armen Geschöpfe rundweg für vom Teufel besessen und unterzog sie deshalb, ohne Erbarmen allen geistigen und physischen Qualen, welche der Ritus des Teufelsbannes mit sich brachte.
Einige der besessenen Nonnen verfielen bei der Annäherung des hochwürdigsten Sakramentes in convulsivische Zuckungen und stießen in ihrem extatischen Zustande Aeußerungen von sich, welche den Domherrn Grandier schwer anzuklagen schienen; wir sagen schienen, denn diese rapsodischen Phrasen, welche auf sehr verfängliche und zweideutige Fragen von allbekannten Feinden Grandier's erfolgten, können billiger Weise nicht als klar formulirte Anklagen oder rechtliche Ansichten gelten.
Grandier lachte und spottete anfangs über den ganzen Vorgang, da er, wenigstens was die Nonnen betraf, sich keines Vergehens schuldig wußte. – Eine große Unruhe befiel ihn jedoch als einer der Exorcisten, den er als einen seiner größten Feinde kannte, öffentlich und feierlich erklärte, daß das Ereigniß in Loudun eine auffallende Aehnlichkeit mit jenem habe, dessentwillen vor einigen Jahren der Geistliche Gauffredi in der Provence als Hexenmeister verbrannt worden sei. – Jetzt hörte der Spaß für Grandier auf, denn die Sache begann ein fürchterlich ernstes Gesicht anzunehmen. – Einige Freunde riethen ihm dringend, sich durch die Flucht zu retten, aber, seiner Unschuld sich bewußt, stellte er sich selbst dem geistlichen Inquisitionstribunale, das ihm einige strenge geistliche Corrertionsstrafen auferlegte.
Grandier appellirte jedoch dagegen und forderte, daß sein Fall dem gewöhnlichen Gerichte überwiesen werde.
Statt dessen wurde jedoch der Proceß Grandier einer Specialcommission zugewiesen und – Laubardemont zu deren Präsidenten ernannt. Der Ausgang konnte jetzt nicht zweifelhaft sein, denn diese Specialcommissionen bestanden immer nur aus Creaturen des Cardinals, welche nicht von dem Gesetze, sondern von dem Willen und den geheimen Instructionen ihres Herrn und Meisters bei ihren Aussprüchen geleitet wurden.
Um den Aussagen der angeblich besessenen Nonnen ein juridisches Gewicht beilegen zu können, stellte Laubardemont, unterstützt von willfährigen geistlichen Rathgebern des heiligen Officiums, den Grundsatz auf: »Daß der gehörig beschworene Teufel gezwungen sei, die lautere Wahrheit zu sagen.«
Zur Ehre der Menschheit muß hier erwähnt werden, daß sich mehrere aufgeklärte und unparteiische Männer fanden, welche freiwillig und, unter den damaligen Verhältnissen, nicht ohne evidente Gefahr für ihre eigene persönliche Sicherheit, gegen den von der Specialcommission zur Maxime erhabenen Aberglauben und überhaupt gegen die Möglichkeit, vom Teufel besessen zu werden, mannhaft auftraten.
Ein Arzt erklärte die extatischen Verzückungen der Nonnen auf eine ganz einfache und überzeugende Weise und bewies außerdem höchst schlagend, daß den Besessenen ihre Antworten zumeist eingelernt worden seien.
Die blöde Menge, welche anfangs an den ganzen Geisterspuk steif und fest geglaubt hatte, wurde stutzig und öffnete Augen und Ohr den Eingebungen der gesunden Vernunft.
Laubardemont und seine Helfer, nicht im Stande ihre Widersacher mit Vernunftgründen zu bekämpfen, griffen zur Gewalt.
Man bedeutete im geheim den Verfechtern der Wahrheit, daß Leute, welche so sprechen, sich als heimliche Mitschuldige der von ihnen beschönigten Verbrechen selbst anklagen und daß eine weitere Opposition zu strengeren Maßregeln führen müßte. Diese Sprache war deutlich genug und der Schrecken stopfte auch diesmal der Wahrheit und dem Rechte den Mund.
Grandiers Proceß nahm nun einen raschen Verlauf. Die besessenen Nonnen fungieren mit ihren confusen Aussagen als Anklägerinnen und die Teufelsbanner zogen daraus nach Belieben die ihnen passenden Schlüsse.
Der Beweis, daß Grandier mit dem Teufel persönlich Umgang pflege, wurde z.B. auf folgende Weise hergestellt. Einer der Aerzte der Inquisition setzte an verschiedene Theile des Körpers des Angeklagten eine Sonde, welche derart eingerichtet war, daß, wenn man daran an ein Knöpfchen drückte, die Spitze in den Schaft zurückkehrte; wenn nicht, blieb selbe außen, drang also in das Fleisch ein. Hierdurch geschah es, daß Grandier an einigen Stellen bei Berührung mit der Sonde kein Zeichen des Schmerzes von sich gab, während er an anderen Stellen laut aufschrie.
Der erlauchte und erleuchtete Gerichtshof schloß hieraus, das Grandier an seinem Körper unempfindliche Stellen besitze, was nur in Folge eines Pactes mit dem Teufel statthaben könne.
Pater Lactance, ein überfanatischer Priester der Inquisition, ließ ein eisernes Crucifix heiß machen und brachte den Christus beinahe noch rothglühend den Lippen Grandiers nahe, mit der Aufforderung, das Bild des Gekreuzigten zu küssen. Der Angeklagte fuhr natürlich mit dem Kopfe hastig zurück, Pater Lactance rief nun die Anwesenden zu Zeugen an, daß Grandier vor dem Bilde des Heilandes mit Abscheu zurückgewichen sei.