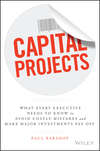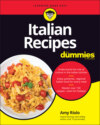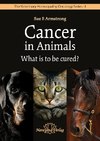Kitabı oku: «Zwangsvollstreckungsrecht, eBook», sayfa 3
IV. Das Prioritätsprinzip 27.17, 27.18
1. Unterkapitel Die Zwangsvollstreckung in bewegliche Sachen
§ 28 Die Pfändung beweglicher Sachen
I. Der Gegenstand der Fahrniszwangsvollstreckung 28.1 – 28.6
1. Früchte 28.2
2. Zubehör 28.3
3. Wertpapiere 28.4 – 28.6
a) Grundsatz 28.5
b) Legitimationspapiere 28.6
II. Gewahrsam an beweglichen Sachen 28.7 – 28.14
1. Gewahrsamsbegriff 28.8 – 28.10
2. Grundsätzliches Verbot einer Prüfung der Vermögenszugehörigkeit 28.11
3. Prüfung der Zugehörigkeit zum verwaltungsunterworfenen Vermögen bei Schuldnern kraft Amtes 28.12
4. Gewahrsam Dritter 28.13, 28.14
III. Die Bewirkung der Pfändung 28.15 – 28.30
1. Pfändung durch Inbesitznahme 28.16
2. Inbesitznahme durch Siegelung oder Wegnahme 28.17
a) Siegelung und Pfandanzeige 28.18 – 28.20
b) Wegnahme durch den Gerichtsvollzieher 28.21 – 28.24
aa) Geld, Kostbarkeiten und Wertpapiere 28.22
bb) Gefährdung des Vollstreckungserfolges 28.23
cc) Obhutspflicht des Gerichtsvollziehers 28.24
3. Benachrichtigung des Schuldners 28.25
4. Schätzung des Werts der Pfandstücke 28.26
5. Besitzverhältnisse nach Pfändung 28.27 – 28.29
a) Bei Schuldnergewahrsam 28.28
b) Bei Wegnahme durch den Gerichtsvollzieher 28.29
6. Aufhebung der Pfändung 28.30
IV. Die Anschlusspfändung 28.31 – 28.35
1. Voraussetzungen 28.32
2. Bewirkung der Anschlusspfändung 28.33
3. Rechtsstellung des Gläubigers 28.34
4. Verwertung 28.35
§ 29 Die Verwertung der gepfändeten Sachen
I. Verwertungspraxis – Aufschub und Aussetzung der Verwertung 29.1, 29.2
1. Verwertungspraxis 29.1
2. Der zeitweilige Vollstreckungsaufschub 29.2
II. Die Verwertung gepfändeten Geldes durch Ablieferung 29.3, 29.4
1. Verfahren 29.3
2. Rechtswirkungen von Wegnahme und Ablieferung 29.4
III. Die Verwertung anderer Sachen 29.5 – 29.20
1. Öffentliche Versteigerung als Regelform 29.6 – 29.13
a) Formalien, Zuschlag, Mindestgebot 29.7
b) Rechtliche Wertung der Versteigerung 29.8 – 29.13
aa) Rechtsnatur von Gebot und Zuschlag 29.9
bb) Eigentumserwerb des Erstehers 29.10
cc) Gefahrübergang hinsichtlich des Erlöses 29.11
dd) Erlös als Surrogat des Pfandgegenstandes 29.12
ee) Ersteigerung eigener Sachen 29.13
2. Freihändiger Verkauf seitens des Gerichtsvollziehers 29.14
3. Modifikation der Verwertung durch den Gerichtsvollzieher oder auf Grund einer Anordnung des Vollstreckungsgerichts 29.15 – 29.18
a) Verwertung auf andere Art oder an einem anderen Ort 29.16, 29.17
aa) Bedeutung und Voraussetzungen 29.16
bb) Freihändiger Verkauf und Zwangsüberweisung 29.17
b) Versteigerung durch andere Person 29.18
4. Verwertung mehrfach gepfändeter Sachen – Konkurrenz mit Vertragspfandrecht 29.19, 29.20
IV. Verwertung ohne Pfändungspfandrecht – Eigentumserwerb am Gelderlös und Ausgleich nach Schadensersatz- und Bereicherungsrecht 29.21 – 29.25
1. Schadensersatz- und Bereicherungsansprüche nach Verwertung fremder Sachen 29.22, 29.23
2. Ausgleich bei fehlendem vollstreckbarem Anspruch 29.24
3. Ausgleich bei Verstoß gegen Verfahrensvorschriften 29.25
2. Unterkapitel Die Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte
§ 30 Die Zwangsvollstreckung in Forderungen
I. Grundsätze 30.1
II. Pfändbare Forderungen und Rechte 30.2 – 30.8
1. Geldforderungen 30.3 – 30.5
2. Unpfändbare Forderungen 30.6
3. Forderungen aus einem Kontokorrent bzw. Girokonto 30.7
4. Bankguthaben 30.8
III. Das zuständige Vollstreckungsgericht 30.9
IV. Das Pfändungsverfahren 30.10 – 30.18
1. Das Gesuch des Gläubigers 30.11
2. Grundsatz des fehlenden rechtlichen Gehörs 30.12
3. Der Pfändungsbeschluss und sein Inhalt 30.13 – 30.16
a) Notwendige Angaben 30.14
b) Bestimmtheit der zu pfändenden Forderung 30.15
c) arrestatorium und inhibitorium 30.16
4. Zustellung an Drittschuldner und Schuldner 30.17
5. Rechtsbehelfe bei fehlerhafter Pfändung 30.18
V. Wirkung und Umfang der Pfändung 30.19 – 30.29
1. Wirkung der Verstrickung und des Pfändungspfandrechts 30.20 – 30.24
a) Befugnis des Gläubigers zur Vorbereitung und Sicherung der Einziehung 30.21
b) Rechtsstellung des Vollstreckungsschuldners 30.22
c) Rechtsstellung des Drittschuldners 30.23, 30.24
2. Umfang der Pfändung 30.25 – 30.27
a) Teilpfändung und Vollpfändung 30.26
b) Besonderheiten der Pfändung von Arbeitseinkommen 30.27
3. Mitpfändung von Zinsen und Nebenrechten 30.28
4. Hilfspfändung 30.29
VI. Verwertung und Überweisung 30.30 – 30.40
1. Überweisung zur Einziehung 30.31 – 30.35
a) Das Rechtsverhältnis Gläubiger – Vollstreckungsschuldner 30.32
b) Das Verhältnis Gläubiger – Drittschuldner 30.33
c) Forderung als Bestandteil des Schuldnervermögens 30.34
d) Akzessorietät des Pfändungspfandrechts bei Pfändung der Vollstreckungsforderung 30.35
2. Überweisung an Zahlungs statt 30.36
3. Anordnung einer anderen Art der Verwertung 30.37
4. Die Stellung des Drittschuldners nach Pfändung und Überweisung 30.38 – 30.40
a) Schutz des gutgläubigen Drittschuldners 30.39
b) Einwendungen des Drittschuldners gegen die Klage des Gläubigers 30.40
VII. Pfändung für mehrere Gläubiger 30.41
VIII. Die Vorpfändung 30.42
§ 31 Besondere Formen der Forderungspfändung
I. Pfändung und Verwertung hypothekarisch gesicherter Forderungen 31.1 – 31.7
1. Pfändungsbeschluss 31.2
2. Briefübergabe oder Eintragung 31.3 – 31.5
a) Briefübergabe (einschließlich Hilfspfändung) 31.4
b) Grundbucheintragung bei Buchhypotheken 31.5
3. Verwertung der Hypothekenforderung 31.6
4. Pfändung des Rechts auf Befriedigung aus dem Versteigerungserlös nach Zwangsversteigerung 31.7
II. Pfändung von Ansprüchen auf Herausgabe oder Leistung körperlicher Sachen 31.8 – 31.16
1. Anspruch hinsichtlich beweglicher Sachen 31.9 – 31.11
2. Anspruch hinsichtlich unbeweglicher Sachen 31.12 – 31.16
a) Pfändung des Anspruchs auf Übertragung des Eigentums 31.13, 31.14
b) Pfändung der Auflassungsanwartschaft 31.15
c) Anspruch auf Herausgabe eingetragener Schiffe 31.16
§ 32 Die Zwangsvollstreckung in andere Vermögensrechte
I. Grundlagen 32.1 – 32.7
1. „Andere Vermögensrechte“ 32.1 – 32.4
a) Die Kasuistik 32.2
b) Bruchteilseigentum 32.3
c) Selbstständigkeit und Übertragbarkeit der Rechte 32.4
2. Art und Weise der Zwangsvollstreckung 32.5 – 32.7
a) Pfändung 32.6
b) Verwertung 32.7
II. Gesellschafts- und Gemeinschaftsanteile 32.8 – 32.16
1. BGB-Gesellschaft und OHG 32.9 – 32.12
a) Zwangsvollstreckung in den Anteil am Gesellschaftsvermögen 32.10
b) Zwangsvollstreckung in das Auseinandersetzungsguthaben 32.11, 32.12
2. GmbH 32.13
3. Aktiengesellschaft 32.14
4. Miterbengemeinschaft 32.15
5. Eheliche Gütergemeinschaft 32.16
III. Anwartschaftsrechte 32.17 – 32.20
1. Doppelpfändungs-Theorie 32.18
2. Sachpfändungs-Theorie 32.19
3. Rechtspfändungs-Theorie 32.20
IV. Grund-, Rentenschulden und Reallasten 32.21 – 32.29
1. Allgemeines 32.22
2. Eigentümergrundschuld 32.23 – 32.28
a) Analogie zur Pfändung von hypothekarisch gesicherten Forderungen 32.24
b) Pfändung nach § 857 Abs. 2 32.25
c) „Künftige“ Eigentümergrundschulden 32.26
d) Verwertung der Eigentümergrundschuld 32.27
e) Pfändung des Versteigerungserlöses 32.28
3. Rückübertragungsanspruch bei Sicherungsgrundschulden 32.29
V. Immaterialgüterrechte 32.30 – 32.45
1. Urheberrecht 32.31 – 32.35
a) Zwangsvollstreckung gegen den Urheber 32.32, 32.33
b) Zwangsvollstreckung gegen den Rechtsnachfolger 32.34
c) Die Zwangsvollstreckung in Nutzungsrechte 32.35
2. Verlagsrecht 32.36
3. Gewerbliche Schutzrechte 32.37 – 32.44
a) Begriffe 32.37, 32.38
b) Abgestufter Schutz gewerblicher Immaterialgüterrechte 32.39 – 32.43
c) Verwertung 32.44
4. Lizenzen 32.45
VI. Computersoftware 32.46 – 32.48
1. Sachpfändung und Rechtspfändung 32.47
2. Pfändbarkeit von Software 32.48
VII. Internet-Domains 32.49
§ 33 Das Verteilungsverfahren
I. Zweck und Anwendungsbereich 33.1
II. Verfahrensgrundsätze 33.2 – 33.6
1. Verfahren von Amts wegen 33.3
2. Zuständigkeit 33.4
3. Anfertigung des Teilungsplans 33.5
4. Feststellung des Teilungsplans im Verteilungstermin 33.6
III. Rechtsbehelfe gegen den Teilungsplan 33.7 – 33.15
1. Die Widerspruchsklage 33.8 – 33.13
a) Mögliche Widerspruchsgründe 33.9
b) Widerspruch vor oder im Verteilungstermin als Klagevoraussetzung 33.10
c) Bedeutung der Monatsfrist nach § 878 Abs. 1 33.11
d) Zuständigkeit 33.12
e) Urteil 33.13
2. Die sofortige Beschwerde 33.14
3. Abgrenzung zu anderen Rechtsbehelfen 33.15
2. Unterabschnitt Die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in das unbewegliche Vermögen
§ 34 Die allgemeinen Grundzüge der Immobiliarvollstreckung
I. Begriff und systematische Stellung der Immobiliarzwangsvollstreckung 34.1 – 34.11
1. Begriff 34.1, 34.2
2. Systematische Stellung des Immobiliarvollstreckungsrechts 34.3 – 34.11
a) Die gesetzliche Regelung der Immobiliarvollstreckung 34.3, 34.4
b) Die Systematik des ZVG 34.5
c) Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung in besonderen Fällen 34.6 – 34.11
aa) Auseinandersetzungsversteigerung 34.7 – 34.9
bb) Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung auf Antrag des Insolvenzverwalters 34.10
cc) Zwangsversteigerung eines Nachlassgrundstücks auf Antrag eines Erben 34.11
II. Gegenstand der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen 34.12 – 34.18
1. Grundstücke 34.12
2. Grundstücksgleiche Rechte 34.13
3. Miteigentumsanteil an Immobilien 34.14, 34.15
4. Wohnungseigentum und Schiffseigentum 34.16, 34.17
a) Wohnungseigentum 34.16
b) Schiffseigentum 34.17
5. Immobiliarrechte in den neuen Bundesländern 34.18
III. Der Umfang der Immobiliarvollstreckung 34.19 – 34.30
1. Unterschiedlicher Umfang bei Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung 34.20 – 34.24
a) Haftungsumfang in der Zwangsversteigerung 34.21 – 34.23
b) Umfang der Zwangsverwaltung 34.24
2. Freiwerden mithaftender Gegenstände 34.25
3. Maßgeblicher Zeitpunkt für Mithaftung bei persönlichen Gläubigern – Rangordnung 34.26, 34.27
a) Maßgeblicher Zeitpunkt für Mithaftung bei persönlichen Gläubigern 34.26
b) Rangordnung 34.27
4. Verhältnis zur vorausgehenden Mobiliarvollstreckung 34.28
5. Unzulässigkeit der Mobiliarvollstreckung nach Beschlagnahme 34.29
6. Rechtsbehelfe 34.30
IV. Vollstreckungsorgan, Verfahren und Beteiligte 34.31 – 34.36
1. Das Vollstreckungsorgan 34.31
2. Antragsverfahren 34.32
3. Die Beteiligten 34.33 – 34.36
a) Parteien 34.34
b) Realberechtigte 34.35
c) Inhaber anderer angemeldeter Rechte 34.36
V. Die Befriedigungsrechte und ihre Rangordnung 34.37 – 34.39
1. Vorzugsrechte und Realgläubiger 34.38
2. Persönliche Gläubiger 34.39
VI. Verfassungsrecht und Zwangsversteigerung 34.40 – 34.44
1. Das faire, rechtsstaatliche Versteigerungsverfahren 34.41
2. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 34.42
3. Gehörsrüge bei Verletzung rechtlichen Gehörs vor Zuschlag 34.43
4. Zwangsversteigerung wegen Bagatellforderungen als Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz? 34.44
§ 35 Der Gang des Zwangsversteigerungsverfahrens zur Vorbereitung der Versteigerung
I. Überblick über den Verfahrensverlauf 35.1
II. Der Antrag und seine Voraussetzungen 35.2 – 35.4
III. Die Versteigerungsanordnung und ihre Umsetzung 35.5 – 35.8
1. Der Erlass des Versteigerungsbeschlusses 35.5
2. Die Eintragung des Versteigerungsvermerks 35.6
3. Beitritt und Rechtsnachfolge 35.7, 35.8
IV. Die Beschlagnahme und ihre Wirkungen 35.9 – 35.13
1. Veräußerungsverbot zu Gunsten des betreibenden Gläubigers 35.10 – 35.12
a) Umfang der Beschlagnahme 35.11
b) Relatives Veräußerungsverbot 35.12
2. Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück 35.13
V. Aufhebung und einstweilige Einstellung des Verfahrens 35.14 – 35.22
1. Aufhebungsgründe 35.15 – 35.17
a) Entgegenstehendes dingliches Recht 35.15
b) Antragsrücknahme, fehlender Fortsetzungsantrag und ergebnisloser Termin 35.16
c) Fälle des § 776 und des § 766 35.17
2. Einstweilige Einstellung 35.18 – 35.21
a) Gläubigerantrag 35.18
b) Gerichtliche Anordnung 35.19
c) Einstellung nach §§ 75, 77 ZVG 35.20
d) Schuldnerschutz 35.21
3. Rechtsbehelfe 35.22
§ 36 Der Versteigerungstermin, der Zuschlag und die Verteilung des Erlöses
I. Der Versteigerungstermin 36.1 – 36.17
1. Die Bestimmung des Versteigerungstermins 36.1
2. Die Versteigerungsbedingungen und ihre Grundlagen 36.2 – 36.12
a) Das Übernahmeprinzip 36.3, 36.4
b) Das Deckungsprinzip 36.5 – 36.8
aa) Geringstes Gebot und Bargebot 36.5, 36.6
bb) Mindestgebot 36.7
cc) Ausbietungs- und Ausfallgarantie 36.8
c) Die Versteigerungsbedingungen 36.9 – 36.12
aa) Gesetzliche Versteigerungsbedingungen 36.9, 36.10
bb) Besondere Versteigerungsbedingungen 36.11, 36.12
3. Die drei Abschnitte des Versteigerungstermins 36.13 – 36.17
a) Bekanntmachungen zum Verfahren 36.14
b) Die eigentliche Versteigerung 36.15, 36.16
c) Anhörung über den Zuschlag 36.17
II. Der Zuschlagsbeschluss und seine Rechtswirkungen 36.18 – 36.31
1. Die Versagung des Zuschlags 36.19 – 36.21
2. Der Zuschlag an den Meistbietenden und die Zuschlagsbeschwerde 36.22, 36.23
a) Das Recht auf den Zuschlag 36.22
b) Die Zuschlagsbeschwerde 36.23
3. Die Wirkungen des Zuschlags 36.24 – 36.31
a) Eigentumserwerb des Erstehers 36.24
b) Erlöschen von Rechten und Surrogation am Erlös 36.25, 36.26
c) Bereicherungsausgleich 36.27
d) Bestehenbleiben von Rechten kraft Vereinbarung 36.28, 36.29
e) Räumungs- und Herausgabevollstreckung aus dem Zuschlagsbeschluss 36.30
f) Rechtsstellung des Mieters 36.31
III. Die Verteilung des Erlöses 36.32 – 36.43
1. Die Feststellung der Verteilungsmasse 36.33
2. Der Teilungsplan 36.34 – 36.43
a) Rechtsnatur 36.35
b) Der Inhalt des Teilungsplans 36.36 – 36.39
aa) Die zu berücksichtigenden Rechte 36.37
bb) Die Berücksichtigung von Sicherungsgrundschulden 36.38, 36.39
c) Rechtsbehelfe gegen den Teilungsplan 36.40
d) Die Ausführung des Plans 36.41, 36.42
e) Bereicherungsausgleich nach Planausführung 36.43
§ 37 Die Zwangsverwaltung
I. Zweck 37.1
II. Zulässigkeitsvoraussetzungen 37.2
III. Antrag, Anordnung und Umfang der Beschlagnahme 37.3
IV. Bestellung und Funktion des Zwangsverwalters 37.4 – 37.11
1. Bestellung des Zwangsverwalters 37.4 – 37.6
a) Institutsverwalter 37.5
b) Landwirtschaftliche Grundstücke 37.6
2. Funktion des Zwangsverwalters 37.7 – 37.10
a) Verwaltung und Grundstücksnutzung 37.7
b) Prozessführung 37.8
c) Gewerbebetrieb 37.9
d) Gerichtliche Aufsicht – Haftung 37.10
3. Handeln des Zwangsverwalters kraft Amtes 37.11
V. Verteilung der Nutzungen 37.12 – 37.14
VI. Aufhebung der Zwangsverwaltung 37.15, 37.16
§ 38 Die Zwangshypothek
I. Funktion 38.1
II. Eintragung und Eintragungsvoraussetzungen 38.2 – 38.7
1. Titel und Sicherungsbedürfnis 38.2
2. Zuständigkeit und Verfahren des Grundbuchamtes 38.3
3. Wertgrenze und Verbot der Gesamthypothek, fehlende Vollstreckungsvoraussetzungen 38.4 – 38.6
4. Rechtsbehelfe 38.7
III. Sachenrechtliche Behandlung der Zwangshypothek 38.8, 38.9
IV. Schiffszwangshypothek 38.10
Zweiter Abschnitt Die Zwangsvollstreckung wegen anderer Ansprüche als Geldforderungen
§ 39 Grundgedanken – Die Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen
I. Überblick 39.1
II. Verhältnis zum Schadensersatzanspruch 39.2
III. Herausgabe von Sachen 39.3 – 39.17
1. Bewegliche Sachen 39.4 – 39.9
a) Bestimmte bewegliche Sachen 39.4 – 39.8
aa) Quantität bestimmter beweglicher Sachen 39.5
bb) Vorlage zur Einsicht 39.6
cc) Vorgeschaltete Handlungspflicht 39.7
dd) Herausgabe eines Kindes 39.8
b) Vertretbare Sachen 39.9
2. Unbewegliche Sachen und Räumungsvollstreckung 39.10 – 39.14
a) Ehewohnung, Wohngemeinschaften, Hausbesetzungen 39.11
b) Untermiete 39.12
c) Vollstreckungsschutz 39.13
d) Vorsorge für bewegliche Sachen 39.14
3. Gewahrsam eines Dritten 39.15, 39.16
a) Pfändung und Überweisung des Herausgabeanspruchs 39.15
b) Vermieterpfandrecht 39.16
4. Herausgabe beim Titel auf Übereignung 39.17
§ 40 Die Zwangsvollstreckung zur Erwirkung von Handlungen und Unterlassungen
I. Handlungsvollstreckung: vertretbare Handlung 40.2 – 40.16
1. Vertretbare Handlung 40.3 – 40.14
a) Werk-, Dienst- und Arbeitsleistungen 40.4
b) Erklärungen und Willenserklärungen 40.5 – 40.8
aa) Abgabe einer bestimmten Willenserklärung, § 894 40.6
bb) Vertretbare Handlung, § 887 40.7
cc) Unvertretbare Handlung, § 888 40.8
c) Herausgabe- und Räumungsvollstreckung, §§ 883 ff. 40.9
d) Anspruch auf Schuldbefreiung 40.10
e) Dauerverpflichtungen 40.11
f) Mitwirkung eines Dritten 40.12
g) Vornahme im Ausland 40.13
h) Einzelfälle 40.14
2. Vornahme auf Kosten des Schuldners 40.15
3. Widerstand des Schuldners 40.16
II. Handlungsvollstreckung: unvertretbare Handlung 40.17 – 40.29
1. Begriff der unvertretbaren Handlung 40.18 – 40.23
a) Beispiele 40.19
b) Mitwirkung eines Dritten 40.20
c) Einsicht in die Geschäftsbücher 40.21
d) Kreditaufnahmepflicht 40.22
e) Vornahme im Ausland 40.23
2. Nicht vollstreckbare Titel über unvertretbare Handlungen 40.24 – 40.26
a) Titel über unvertretbare Dienste 40.25
b) Arbeitsleistung als vertretbare Handlung 40.26
3. Zwangsgeld und Zwangshaft – Anordnungsverfahren 40.27 – 40.29
III. Unterlassungsvollstreckung 40.30 – 40.48
1. Die Unterlassungs- oder Duldungspflicht 40.30 – 40.33
a) Bestimmtheit und Kerntheorie 40.31
b) Handlungspflichten als Folge von Unterlassungsgeboten 40.32
c) Konkurrenz zur Vertragsstrafe 40.33
2. Voraussetzungen für die Festsetzung der Ordnungsmittel 40.34 – 40.36
a) Androhung 40.35
b) Zuwiderhandlung des Schuldners 40.36
3. Festsetzung von Ordnungsgeld und Ordnungshaft 40.37 – 40.39
4. Rechtsnatur der Ordnungsmaßnahmen 40.40 – 40.47
a) Erfordernis eines Verschuldens seitens des Schuldners 40.42
b) Folgen des Titelfortfalls 40.43 – 40.46
aa) Ablauf der im Titel bestimmten Frist 40.44
bb) Wegfall des Titels ex tunc 40.45
cc) Wegfall des Titels ex nunc 40.46
c) Fortsetzungszusammenhang zwischen mehreren Verstößen 40.47
5. Festsetzungsverfahren – Rechtsbehelfe 40.48
§ 41 Die Vollziehung der Urteile auf Abgabe einer Willenserklärung
I. Grundsatz der Fiktion 41.1
II. Voraussetzungen der Fiktion 41.2 – 41.9
1. Verurteilung zur Abgabe einer Willenserklärung 41.3 – 41.5
2. Abgrenzung zur Handlungsvollstreckung 41.6 – 41.8
a) Anwendungsbereich von § 894 41.7
b) Anwendungsbereich der §§ 887, 888 41.8
3. Erforderlichkeit eines Urteils 41.9
III. Zeitpunkt des Fiktionseintritts 41.10 – 41.12
1. Eintritt der Fiktion nach formeller Rechtskraft 41.11
2. Sicherungswirkung vor formeller Rechtskraft 41.12
IV. Umfang und Grenzen der Fiktionswirkung 41.13 – 41.17
1. Form der Willenserklärung und andere Wirksamkeitsvoraussetzungen 41.14, 41.15
2. Weitere Voraussetzungen für das Zustandekommen des Rechtsgeschäfts 41.16
3. Die Möglichkeit gutgläubigen Erwerbs 41.17
Sechstes Kapitel Die Rechtsbehelfe in der Zwangsvollstreckung
§ 42 Allgemeines
I. Überblick 42.1 – 42.4
1. Rechtsbehelfe bei formellen Mängeln 42.1
2. Rechtsbehelfe bei materiellen Mängeln 42.2 – 42.4
II. Gefahr der Vollstreckungsverschleppung 42.5
III. Materielle Rechtskraft der Entscheidungen 42.6
IV. Reform der Rechtsbehelfe 42.7
§ 43 Die Vollstreckungserinnerung
I. Verfahrensfehler eines Vollstreckungsorgans 43.2 – 43.6
1. Fehler des Gerichtsvollziehers 43.3
2. Fehler des Vollstreckungsgerichts bzw. des Rechtspflegers 43.4
3. Fehler des Prozessgerichts als Vollstreckungsorgan 43.5
4. Fehler des Grundbuchamts 43.6
II. Der Erinnerungsberechtigte und seine Rüge 43.7 – 43.13
1. Erinnerungsberechtigter 43.8
2. Zulässige Rügen 43.9 – 43.13
III. Zuständigkeit und Verfahren 43.14 – 43.22
1. Zuständigkeit 43.14
2. Zulässigkeit – zeitliche Grenzen 43.15
3. Formlosigkeit 43.16
4. Die Entscheidung über die Erinnerung 43.17 – 43.20
5. Sofortige Beschwerde als Rechtsbehelf 43.21
6. Rechtskraft der Entscheidung 43.22
IV. Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen 43.23 – 43.26
1. Vollstreckungsabwehrklage, Klauselerinnerung 43.23
2. Drittwiderspruchsklage 43.24
3. Dienstaufsichtsbeschwerde 43.25
4. §§ 23 ff. EGGVG 43.26
§ 44 Die sofortige Beschwerde im Vollstreckungsverfahren
I. Vollstreckungsmaßnahmen und Entscheidungen 44.2
II. Entscheidungen im Vollstreckungsverfahren mit fakultativer mündlicher Verhandlung 44.3
III. Beschwerdebefugnis, Beschwerdefrist, Umfang der Prüfung 44.4
IV. Rechtsbeschwerde 44.5
§ 45 Die Vollstreckungsgegenklage
I. Funktion und Rechtsnatur 45.1 – 45.3
1. Funktion 45.2
2. Rechtsnatur 45.3
II. Zulässigkeit 45.4 – 45.8
1. Titel mit vollstreckbarem Inhalt 45.5 – 45.7
a) Leistungsurteile und ähnliche Titel 45.6
b) Weitere Titel 45.7
2. Drohende Vollstreckung – fortdauernde Vollstreckung 45.8
III. Begründete Einwendungen gegen den zu vollstreckenden Anspruch 45.9 – 45.26
1. Endurteile 45.10 – 45.17
a) Maßgebliche letzte Tatsachenverhandlung 45.11 – 45.13
b) Einwendungsarten und maßgeblicher Entstehungszeitpunkt 45.14 – 45.16
c) Besonderheiten bei Versäumnisurteilen 45.17
2. Andere gerichtliche Entscheidungen 45.18 – 45.23
a) Schiedssprüche 45.19
b) Ausländische Urteile 45.20
c) Vollstreckungsbescheide 45.21
d) Kostenfestsetzungsbeschlüsse 45.22
e) Adhäsionsverfahren 45.23
3. Vollstreckungstitel ohne vorausgehendes Erkenntnisverfahren 45.24 – 45.26
a) Gerichtliche und notarielle Urkunden 45.25
b) Gerichtliche Vergleiche 45.26
IV. Besonderheiten des Verfahrens 45.27 – 45.35
1. Zuständigkeit 45.28, 45.29
2. Parteien 45.30
3. Klagantrag 45.31
4. Konzentrationsgrundsatz und Eventualmaxime 45.32
5. Umfang der Prüfung – Kosten 45.33
6. Einstweilige Anordnungen bezüglich der Vollstreckung 45.34, 45.35
V. Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen 45.36 – 45.42
1. Erinnerung 45.36
2. Feststellungsklage und prozessuale Gestaltungsklage analog § 767 45.37
3. Parallelstreitigkeiten mit identischen Vorfragen 45.38
4. Schadensersatz und Bereicherungsausgleich 45.39
5. Klage auf Herausgabe des Schuldtitels 45.40
6. Abänderungsklage 45.41
7. Berufung und Einspruch 45.42
§ 46 Die Drittwiderspruchsklage und die Klage auf vorzugsweise Befriedigung
I. Die Drittwiderspruchsklage 46.1 – 46.30
1. Funktion, Rechtsnatur, Anwendungsbereich 46.1 – 46.3
2. Das die Veräußerung hindernde Recht 46.4 – 46.15
a) Eigentum und Rechtsinhaberschaft 46.5 – 46.9
aa) Eigentumsvorbehalt 46.6
bb) Treuhandverhältnisse 46.7, 46.8
cc) Oder-Konto 46.9
b) Andere dingliche Rechte 46.10
c) Besitz 46.11
d) Obligatorische Rechte 46.12
e) Anfechtungsrecht 46.13
f) Veräußerungsverbot 46.14
g) Sondervermögen 46.15
3. Parteien der Klage – Einwendungen 46.16 – 46.20
a) Aktivlegitimation 46.16
b) Passivlegitimation 46.17
c) Einwendungen des Vollstreckungsgläubigers 46.18 – 46.20
4. Verfahren 46.21 – 46.26
a) Zuständigkeit 46.22
b) Antrag und Tenor 46.23
c) Vorläufige Anordnung bezüglich der Vollstreckung 46.24
d) Vorläufige Vollstreckbarkeit, Kostenentscheidung 46.25
e) Schadensersatz aus verspäteter „Freigabe“ 46.26
5. Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen 46.27 – 46.30
a) Schadensersatz- und Bereicherungsklage 46.27
b) Erinnerung 46.28
c) Unterlassungs- und Feststellungsklage 46.29
d) Aussonderung 46.30
II. Die Klage auf vorzugsweise Befriedigung 46.31 – 46.37
1. Normzweck und Anwendungsbereich 46.31
2. Rechtsnatur 46.32
3. Rechtsschutzbedürfnis 46.33
4. Klageantrag 46.34
5. Parteien 46.35
6. Gesetzliche Pfandrechte 46.36
7. Verfahren; einstweilige Anordnung 46.37
§ 47 Die Erinnerung auf Grund der schuldnerschützenden Generalklausel
I. Die speziellen Schuldnerschutzvorschriften und die Grundsätze der Zwangsvollstreckung 47.1
II. Die Generalklausel und ihr Anwendungsbereich 47.2, 47.3
1. Grundsätzlicher Inhalt 47.2
2. Anwendungsbereich und Kasuistik 47.3
III. Dogmatische Einordnung der Generalklausel 47.4 – 47.8
1. Grundsätzliche Berechtigung und rechtskraftbedingte Schranken 47.4
2. Die Funktionen der Generalklausel 47.5 – 47.8
a) Ergänzungsfunktion 47.6
b) Ermächtigungsfunktion 47.7
c) Schrankenfunktion 47.8
IV. Verfahren 47.9, 47.10
1. Entscheidung durch das Vollstreckungsgericht 47.9
2. Aufschub durch den Gerichtsvollzieher 47.10
Siebtes Kapitel Die Sachaufklärung der Zwangsvollstreckung
§ 48 Eidesstattliche Versicherung, Haft und Schuldnerbefragung
I. Zweck und Mittel der vollstreckungsrechtlichen Sachaufklärung 48.1 – 48.4
1. Die eidesstattliche Versicherung 48.2
2. Unförmliche Befragung des Schuldners 48.3
3. Stand und Reform vollstreckungsrechtlicher Sachverhaltsaufklärung 48.4
II. Die Voraussetzungen der Vermögensauskunft mit eidesstattlicher Versicherung 48.5 – 48.8