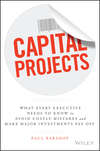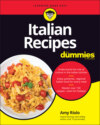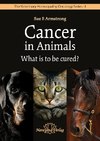Kitabı oku: «Zwangsvollstreckungsrecht, eBook», sayfa 35
I. Überblick
19.1
Gesetzlicher Güterstand ist die so genannte Zugewinngemeinschaft. Diese Bezeichnung ist irreführend: denn ein gemeinschaftliches Vermögen der Ehegatten am Zugewinn wird nicht gebildet, es gilt vielmehr der Grundsatz der Vermögenstrennung. Dies bedeutet vollstreckungsrechtlich, dass – beim gesetzlichen Güterstand wie selbstverständlich beim Güterstand der Gütertrennung – der Gläubiger eines Ehegatten nur in dessen Vermögen vollstrecken kann. Es lässt sich indessen nicht übersehen, dass für den Gläubiger wie für das Vollstreckungsorgan die Zugehörigkeit eines Gegenstandes zum Vermögen des einen oder des anderen Ehegatten häufig nur sehr schwierig festzustellen ist; die Lebensgemeinschaft der Ehegatten verdunkelt die rechtliche Zuordnung. Daher trifft das Gesetz Vorkehrungen, um die Vollstreckung zu erleichtern; sie gelten im Prinzip[1] für alle Güterstände (II., Rn. 19.2 ff.). Im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft sucht das Gesetz die vermögensrechtliche Grundlage der Ehe gegen einseitige Verfügungen eines Ehegatten zu sichern und schafft damit faktisch eine Art Gesamthandsbindung, die auch vollstreckungsrechtliche Auswirkungen hat. Auch für die Ausgleichsforderung nach Beendigung des Güterstandes gelten vollstreckungsrechtliche Besonderheiten (III., Rn. 19.13 f.). Ein echtes Sondervermögen wird schließlich beim Güterstand der Gütergemeinschaft gebildet; die Vollstreckung in dieses Sondervermögen (das Gesamtgut) bedurfte einer gesetzlichen Regelung (IV., Rn. 19.16 ff.). Das Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft[2] brachte für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften eine weitgehende Gleichstellung mit der Ehe (V., Rn. 19.24 f.). Seit 1. Oktober 2017 können neue Lebenspartnerschaften nicht mehr begründet, wohl aber auf Antrag in eine gleichgeschlechtliche Ehe umgewandelt werden.
II. Die Zwangsvollstreckung gegen Ehegatten
1. Drittwiderspruchsklage des anderen Ehegatten
19.2
Der Gläubiger bedarf eines Vollstreckungstitels gegen den Ehegatten, in dessen Vermögen er vollstrecken will. Erfasst die Vollstreckung Gegenstände, die dem anderen Ehegatten gehören, so kann dieser die Drittwiderspruchsklage (Interventionsklage) erheben und damit die Beseitigung der Vollstreckung erreichen (§ 771).
2. Eigentumsvermutung und Gewahrsamsfiktion
19.3
§ 739 Abs. 1 erleichtert die Situation des Gläubigers, indem er die Eigentumsvermutung des § 1362 BGB mit einer Parallelfiktion bezüglich der Besitz- und Gewahrsamsverhältnisse koppelt.
a) Bedeutung
19.4
§ 1362 Abs. 1 S. 1 BGB schafft zu Gunsten der Gläubiger eines Ehegatten die Vermutung, dass die im Besitz eines Ehegatten oder beider Ehegatten befindlichen beweglichen Sachen dem Schuldner gehören und setzt damit für den besitzenden, nicht schuldenden Ehegatten § 1006 Abs. 1 BGB außer Kraft. Daran knüpft § 739 Abs. 1 für die Zwangsvollstreckung an, indem er auf Grund der Eigentumsvermutung für die Besitz- und Gewahrsamsfrage eine – unwiderlegbare – Fiktion begründet[3]. Das Vollstreckungsorgan, das gegen einen Ehegatten vollstreckt, braucht sich also bei der Pfändung beweglicher Sachen nicht darum zu kümmern, ob der Schuldner den Alleingewahrsam an der Sache hat; stellt es fest, dass ein Ehegatte (auch der Nichtschuldner!) oder beide Ehegatten Besitzer der Sache sind, so ist zu pfänden[4]. Denn es wird fingiert, dass der Ehegatte, der Schuldner im Sinne des Vollstreckungsrechts ist, auch Besitz und Gewahrsam an der Sache hat. Es bleibt dann dem Ehegatten, der nicht Schuldner ist, überlassen, sein Eigentum an der gepfändeten Sache nachzuweisen, wobei es genügt, dass er den Eigentumserwerb beweist[5].
Diese Grundregelung und auch ihre Durchbrechung sollen an einigen Beispielen demonstriert werden:
Im Auftrag des Gläubigers G des Ehemannes M pfändet der Gerichtsvollzieher einen Vitrinenschrank, den er in der Ehewohnung vorfindet. Die Pfändung ist wirksam.
Behauptet die Ehefrau F, sie sei Eigentümerin, so muss sie die Eigentumsvermutung des § 1362 BGB im Verfahren der Erinnerung nach § 766[6] bzw. nach h.M.[7] durch Erhebung der Drittwiderspruchsklage (§ 771) widerlegen. Stützt sie ihr Eigentum etwa auf eine Schenkung des Mannes, so kann G die Einrede der Gläubigeranfechtung erheben, wenn die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 AnfG vorliegen[8]. Dies hätte zur Folge, dass F die Zwangsvollstreckung dulden muss, obwohl sie Eigentümerin ist und ihr Eigentum auch nachgewiesen hat[9]. Führt der nichtschuldende Ehegatte den Nachweis, dass er die gepfändete Sache schon vor der Ehe besaß, greift zu seinen Gunsten die Vermutung des § 1006 Abs. 2 BGB ein[10]. Die (Allein-) Eigentumsvermutung des § 1362 BGB kann nach h.M. nicht mithilfe des § 1357 Abs. 1 BGB widerlegt werden, weil diese Norm unmittelbar keine dinglichen, sondern nur schuldrechtliche Wirkungen entfaltet[11]. Im Regelfall soll sich freilich das Miteigentum des Ehepartners an den zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs angeschafften Sachen aus allgemeinen Grundsätzen ergeben[12]. Vom Standpunkt der h.M. aus berechtigt auch der Einwand des Miteigentums nur zur Drittwiderspruchsklage, nicht zur Erinnerung.
Der Gerichtsvollzieher hätte den Vitrinenschrank nicht pfänden dürfen, wenn die Ehegatten getrennt leben[13] und die F allein in der bisherigen Ehewohnung lebt (§ 1362 Abs. 1 S. 2 BGB).
19.5
Angenommen der Gerichtsvollzieher hätte – bei sonst gleich bleibendem Sachverhalt (M ist Schuldner, die Ehegatten leben nicht getrennt) – einen von der F allein benutzten Flügel gepfändet, so hätte er gegen § 739 Abs. 1 verstoßen, weil § 1362 Abs. 2 BGB hier für das Eigentum der F spricht und daher auch nach § 739 Abs. 1 ihr Alleingewahrsam fingiert wird[14]. Die F kann Erinnerung nach § 766 einlegen und die Aufhebung der Pfändung erreichen. Für einen Gläubiger der F spricht dagegen die Vermutung des § 1362 Abs. 2 BGB und die Gewahrsamsfiktion des § 739 Abs. 1!
19.6
§ 739 Abs. 1 gilt auch, wenn ein Gläubiger des M und ein Gläubiger der F zugleich in dieselbe Sache vollstrecken: jeder Ehegatte gilt für seinen Gläubiger als alleiniger Gewahrsamsinhaber. Unstreitig (aber wohl unpraktisch) dürfte sein, dass jeder Ehegatte auch hier versuchen kann, sein Eigentum geltend zu machen, sei es im Wege der Erinnerung oder – so die h.M. – der Drittwiderspruchsklage. Streitig ist hingegen, ob und wie ein Gläubiger die zu Gunsten des anderen Ehegatten sprechende Eigentumsvermutung widerlegen darf[15]. Kann keine Eigentumsvermutung ausgeräumt werden, gilt § 804 Abs. 3 analog; bei gleichzeitigen Pfändungen kommt es also zur verhältnismäßigen Aufteilung des Erlöses (vgl. Rn. 27.17, 29.19).
Die Gewahrsamsfiktion des § 739 Abs. 1 geht dem wirklichen Gewahrsam vor; der Gerichtsvollzieher darf also z.B. nicht zu Gunsten eines Mannesgläubigers einen Damenbrillantring pfänden, der sich im Panzerschrank des M befindet (arg. ex § 1362 Abs. 2 BGB), auch wenn nur der M den Schlüssel zu diesem Schrank hat (§ 1362 Abs. 2 BGB, § 739 Abs. 1)[16].
19.7
Eine Besonderheit kann sich aus den Wirkungen der „beiderseitigen Schlüsselgewalt“ des § 1357 BGB ergeben[17]: M hat bei G einen Staubsauger gekauft. G vollstreckt aus einem gegen M erwirkten Urteil in einen Teppich, der F gehört. Kann G gegen die Widerspruchsklage (§ 771) der F einwenden, sie sei nach § 1357 BGB ebenfalls Schuldnerin des Kaufpreises? Sicher zu bejahen, wenn G auch gegen F einen Titel erwirkt hat; fragwürdig aber dann, wenn dies nicht der Fall ist; im Interventionsprozess müsste dann inzidenter geprüft werden, ob die Voraussetzungen des § 1357 BGB für eine gesamtschuldnerische Haftung der F bestehen[18].
| Übersicht 8: Zwangsvollstreckung gegen Ehegatten und Lebenspartner | ||
| I. Erleichterung der Zwv. zugunsten des Gläubigers bei beweglichen Sachen: § 739 mit § 1362 BGB bzw. § 8 Abs. 1 LPartG Rechtsbehelf des anderen Ehegatten bzw. Lebenspartners: § 771 (Beweislast!) – u.U. § 766 | ||
| II. Verfügungen des einen Ehegatten bzw. Lebenspartners | ||
| 1. über Vermögen insgesamt (§ 1365 BGB, § 8 Abs. 2 LPartG) 2. über Hausrat (§ 1369 BGB, § 8 Abs. 2 LPartG) |  [Bild vergrößern] [Bild vergrößern] | Drittwiderspruchsklage (§ 771) des anderen Ehegatten bzw. Lebenspartners, der nicht zugestimmt hat. |
b) Geltungsbereich
19.8
§ 739 gilt immer dann, wenn eine bewegliche Sache Gegenstand der Zwangsvollstreckung ist, also auch bei einer Herausgabevollstreckung nach § 883[19], es sei denn, der Vollstreckungsgläubiger macht sein Eigentum geltend. Dagegen ist § 739 nicht anwendbar bei der Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen, und zwar auch dann nicht, wenn diese bewegliches Vermögen (z.B. Zubehör bei einer Zwangsversteigerung, § 55 ZVG) mitumfasst[20]. § 739 kann ferner nicht herangezogen werden bei der Räumungsvollstreckung gegen Ehegatten (z.B. nach Kündigung des Mietverhältnisses). Hier genügt ein Titel gegen den Ehegatten, der nach außen als Mieter, „Wohnungsinhaber“ auftritt[21]. Ein Rechtsschutzbedürfnis für einen Titel gegen beide Ehegatten ist aber angesichts der zweifelhaften Rechtslage zu bejahen[22].
c) Verfassungsmäßigkeit der Regelung
19.9
Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Regelung (Rn. 7.38 f.) lassen sich schwer unterdrücken[23] (Rn. 7.39). An die eheliche Lebensgemeinschaft knüpfen sich Nachteile, obwohl sie weniger denn je – man mag dies bewerten wie man will – die einzige Form des Zusammenlebens der Geschlechter ist. Die analoge Anwendung der §§ 1362 BGB, 739 auf eheähnliche Lebensgemeinschaften würde zwar die unbillige Ungleichbehandlung beseitigen, wäre aber ein Eingriff in die Rechtssphäre der Betroffenen ohne gesetzliche Grundlage; sie entspricht nicht der h.M.[24].
Lebenspartner in eingetragener Lebenspartnerschaft sind Ehegatten zwangsvollstreckungsrechtlich in puncto Gewahrsamsfiktion gleichgestellt. Eine gesetzliche Grundlage für die Gleichstellung von Ehepaaren und Lebenspartnern in eingetragener Lebenspartnerschaft mit nicht ehelichen Lebensgemeinschaften ist weiterhin nicht in Sicht. Ein Vorschlag der Arbeitsgruppe zur Überarbeitung des Zwangsvollstreckungsrechts (Rn. 4.11), nicht eheliche Lebensgemeinschaften vollstreckungsrechtlich hinsichtlich der Gewahrsamsfiktion mit Ehepaaren gleichzustellen, war seinerzeit aus dem Schlussbericht nicht in die Zweite Zwangsvollstreckungsnovelle übernommen worden[25].
III. Besonderheiten beim Güterstand der Zugewinngemeinschaft
1. Drittwiderspruchsklage auf Grund § 1368 BGB
19.10
Nach §§ 1365 ff. BGB bedarf ein Ehegatte bei Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäften über sein Vermögen im Ganzen und über ihm gehörende Gegenstände des ehelichen Haushalts der Zustimmung des anderen Ehegatten; fehlt sie endgültig, so sind die Verträge unwirksam (§§ 1366 Abs. 4; 1369 Abs. 3 BGB). Auch der an dem Rechtsgeschäft nicht beteiligte Ehegatte kann die aus der Unwirksamkeit sich ergebenden Rechte gerichtlich geltend machen (§ 1368 BGB), also z.B. die veräußerte Sache vindizieren (sog. Revokationsrecht). Diese Regelung gilt für Lebenspartner in eingetragener Lebenspartnerschaft entsprechend (§ 6 LPartG).
Die Verfügungsbeschränkung hat auch vollstreckungsrechtliche Folgen; denn wenn dem nicht zustimmenden Ehegatten in § 1368 BGB eine selbstständige Initiative eingeräumt ist, so bedeutet dies, dass er sich einer Zwangsvollstreckung zur Durchsetzung des Gläubigerrechts mit der Interventionsklage des § 771 widersetzen kann.
Beispiel: Der Ehemann M hat ohne Wissen seiner Frau F dem G die „Musiktruhe“ zur Sicherung eines Darlehens übereignet. Als M das Darlehen nicht zurückbezahlt, erwirkt G gegen M einen Herausgabetitel (wobei das Gericht § 1369 BGB nicht beachtet hat. Leicht möglich, weil es nicht weiß, dass M verheiratet ist und im gesetzlichen Güterstand lebt!). Der Gerichtsvollzieher holt die Truhe ab, wozu er nach § 739 Abs. 1 mit § 1362 Abs. 1 BGB befugt ist. Die Ehefrau kann aber intervenieren (§ 771); denn sie hat ein sich aus der „Vinkulierung“ des Hausrates ergebendes „die Veräußerung hinderndes Recht“! Will G dieser Konsequenz entgehen, so muss er in erster Linie Gewicht darauf legen, dass die Ehefrau der Sicherungsübereignung zustimmt. Hat er dies übersehen, glaubt er aber nachweisen zu können, dass F dem M gegenüber zugestimmt hat, so kann er die Interventionsklage der F in Ruhe abwarten oder aber Feststellungsklage erheben, dass der F die Rechte aus § 1368 BGB nicht zustehen[26].
Die Verfügungsbeschränkungen behalten im Übrigen ihre Bedeutung, soweit ein Ehegatte (entgegen §§ 1365,1369 BGB) zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt wird. Denn die gemäß § 894 fingierte Erklärung ersetzt nicht eine nach §§ 1365, 1369 BGB erforderliche Zustimmung des anderen Ehegatten[27].
19.11
Zu beachten ist, dass §§ 1365, 1369 BGB nicht Platz greifen, wenn ein Gläubiger wegen einer Geldforderung in Vermögensgegenstände des Ehegatten vollstreckt[28]: bereits der Wortlaut der Vorschriften erfasst nicht die sog. Verfügungen im Wege der Zwangsvollstreckung (und es fehlt eine gesetzliche Gleichstellung wie in § 135 Abs. 1 S. 2, 161 Abs. 1 S. 2, 184 Abs. 2 BGB), außerdem verfolgen die Beschränkungen nicht den Zweck, die den Gläubigern haftende Vermögensmasse zu schmälern.
2. Vollstreckungsrechtliche Besonderheiten der Ausgleichsforderung
19.12
Einige vollstreckungsrechtliche Besonderheiten gelten für die Ausgleichsforderung nach Beendigung des gesetzlichen Güterstandes.
a) Die Ausgleichsforderung als Pfändungsobjekt
19.13
Die Ausgleichsforderung ist von ihrem Entstehen ab vererblich und übertragbar (§ 1378 Abs. 3 BGB); sie kann aber von einem Gläubiger des ausgleichsberechtigten Ehegatten erst gepfändet werden, wenn sie durch Vertrag anerkannt oder rechtshängig geworden ist (§ 852 Abs. 2). Eine Pfändung der künftigen Ausgleichsforderung hielt die früher ganz h.M. für unmöglich. Ratio: Es soll dem Ehegatten freistehen, ob er den Ausgleichsanspruch wirklich geltend macht. Allerdings bejaht der BGH jetzt die Pfändbarkeit des Pflichtteilsanspruchs vor vertraglicher Anerkennung oder Rechtshängigkeit (vgl. § 852 Abs. 1), da dieser Anspruch in seiner zwangsweisen Verwertbarkeit aufschiebend bedingt sei[29]. Die Dispositionsmöglichkeit des ausgleichsberechtigten Ehegatten bleibt auf diesem Wege gewahrt[30]. Legt man diese Grundsätze auch bei der Pfändung des Anspruchs auf Zugewinnausgleich zu Grunde, so führt dies zur Pfändbarkeit als aufschiebend bedingte Forderung[31].
b) Vollstreckung im Falle des § 1383 BGB
19.14
Die Zwangsvollstreckung im Falle der Übertragung eines Vermögensgegenstands vom Ausgleichsschuldner an den Ausgleichsgläubiger nach § 1383 BGB erfolgt gemäß § 95 Abs. 1 Nr. 2, 5 FamFG nach den Vorschriften der ZPO[32].
IV. Besonderheiten beim Güterstand der Gütergemeinschaft
19.15
Haben Eheleute den Güterstand der Gütergemeinschaft vereinbart (§ 1415 BGB), sind folgende Vermögensmassen zu unterscheiden: Gesamtgut (§ 1416 BGB), Sondergut (§ 1417 BGB) und Vorbehaltsgut (§ 1418 BGB).
1. Vollstreckung in das Sonder- und Vorbehaltsgut
19.16
Für die Zwangsvollstreckung in das Sondergut (soweit es überhaupt pfändbar ist, s. § 1417 BGB mit §§ 851, 857) und in das Vorbehaltsgut gelten keine Besonderheiten. Der Gläubiger eines jeden Ehegatten kann also in das seinem Schuldner gehörige Sonder- und Vorbehaltsgut vollstrecken, ohne durch den anderen Ehegatten behindert zu sein. § 739 Abs. 1 mit § 1362 BGB ist auch hier anwendbar.
2. Vollstreckung in das Gesamtgut
19.17
Bei Gütergemeinschaften spricht eine Vermutung dafür, dass die Vermögensgegenstände der Ehegatten zum Gesamtgut gehören[33]. Für die Zwangsvollstreckung in das Gesamtgut hat man den Fall der Alleinverwaltung durch einen der Ehegatten von dem der Gesamtverwaltung beider Ehegatten zu unterscheiden und die Ausnahmeregelung des § 741 zu beachten. Pfändet ein Gläubiger vor Begründung der Gütergemeinschaft den Forderungsanteil eines Ehegatten, so erstreckt sich sein Pfändungspfandrecht danach auf die ganze Gesamtgutsforderung, in der beide Anteile im Wege der Gesamtrechtsnachfolge aufgegangen sind[34]. Besondere Vorschriften betreffen die beendete bzw. fortgesetzte Gütergemeinschaft. Der durch den Einigungsvertrag eingeführte § 744a trägt dem Umstand Rechnung, dass sich Ehegatten aus dem Gebiet der ehemaligen DDR gemäß Art. 234 § 4 Abs. 2 EGBGB innerhalb von zwei Jahren (d.h. bis zum 2.10.1992) für die Fortgeltung ihres früheren gesetzlichen Güterstandes der Eigentums- und Vermögensgemeinschaft entscheiden konnten; für den Fall einer solchen Option gelten die Regelungen für die Vollstreckung ins Gesamtgut entsprechend[35].
a) Alleinverwaltung
19.18
Bei Alleinverwaltung ist ein Vollstreckungstitel (ggf. auch Duldungstitel[36]) gegen den alleinverwaltenden Ehegatten erforderlich und genügend (§ 740 Abs. 1), und zwar auch dann, wenn die Gesamtgutsverbindlichkeit durch den anderen Ehegatten – z.B. durch unerlaubte Handlung – begründet worden war! Hintergrund dieser Regelung ist zunächst die Alleinprozessführungsbefugnis des verwaltungsberechtigten Ehegatten für die das Gesamtgut betreffenden Rechtsstreitigkeiten (§ 1422 S. 1 HS. 2 BGB), ferner der Umstand, dass das Gesamtgut für Verbindlichkeiten des alleinverwaltenden Ehegatten stets haftet (§ 1437 Abs. 1 HS. 1 BGB). Der Titel berechtigt auch zur Pfändung von Sachen, die sich im Mit- oder Alleingewahrsam des nichtverwaltungsberechtigten Ehegatten befinden. Dies wird gelegentlich unmittelbar § 740 Abs. 1 entnommen[37], meist zieht man jedoch die ratio des § 739 Abs. 1 heran: zwar ist § 739 Abs. 1 auf die Vollstreckung in Sachen, die im Gesamthandseigentum stehen, nicht direkt anwendbar, weil er an das durch § 1362 BGB vermutete Alleineigentum anknüpft. Ermöglicht § 739 Abs. 1 jedoch eine Vollstreckung ins Vorbehalts- oder Sondergut entgegen der tatsächlichen Gewahrsamslage (s.o. Rn. 19.16), müsse diese Befugnis erst recht bei der Vollstreckung ins Gesamtgut bestehen[38].
b) Gesamtverwaltung
19.19
Bei Gesamtverwaltung ist ein Vollstreckungstitel gegen beide Ehegatten erforderlich (§ 740 Abs. 2); beide Ehegatten müssen zur Leistung, nicht nur zur Duldung der Zwangsvollstreckung verurteilt sein[39]. Die gesetzliche Regelung korrespondiert mit der gemeinschaftlichen Prozessführungsbefugnis der Ehegatten für Rechtsstreitigkeiten, die sich auf das Gesamtgut beziehen, § 1450 Abs. 1 S. 1 BGB (z.B. Anspruch auf Lieferung einer zum Gesamtgut gehörenden Sache). Die Titel können jedoch auch aus getrennten Prozessen stammen[40]. Hat etwa der Gläubiger zuerst den Ehemann als Gesamtschuldner (§ 1459 Abs. 2 S. 1 BGB) auf Zahlung verklagt und anschließend die Ehefrau[41], ermöglichen beide Titel zusammen auch die Vollstreckung in das Gesamtgut[42]. Welcher der Ehegatten Gewahrsam an der zu pfändenden Sache hat, ist unerheblich, weil beide Vollstreckungsschuldner sind[43]. § 740 Abs. 2 gilt nach überwiegender Auffassung auch dann, wenn die Gütergemeinschaft nicht im Güterrechtsregister eingetragen ist; denn § 1412 BGB soll im Rahmen der Zwangsvollstreckung keine Anwendung finden[44].
Eine gesetzlich nicht ausdrücklich vorgesehene Vollstreckungserleichterung kann man bei Kostentiteln annehmen: Die Erstreckung oder „Umschreibung“ eines Kostentitels auf den anderen Ehegatten analog § 742 dürfte zulässig sein, weil Prozesskosten stets Gesamtgutsverbindlichkeiten sind (§ 1460 Abs. 2 BGB) und somit auch beide Ehegatten persönlich haften (§ 1459 Abs. 2 S. 1 BGB)[45]. Die Erwirkung eines zweiten Titels wird so überflüssig.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.