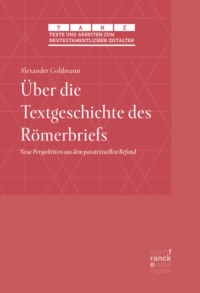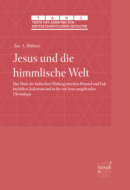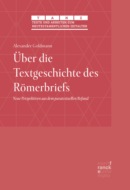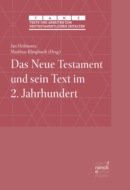Kitabı oku: «Über die Textgeschichte des Römerbriefs», sayfa 3
2.3. Methodisches Vorgehen
Aus den beschriebenen Überlegungen ergibt sich folgende methodische Herangehensweise: Untersucht werden die drei umfangreichsten, zusammenhängenden Textdifferenzen zwischen der 10-Briefe-Sammlung (bezeugt durch Marcions Apostolos) und der 14-Briefe-Sammlung innerhalb des Römerbriefes.1 Dabei handelt es sich um Rm 4, Rm 9–11 und Rm 15–16. Letzterer Textabschnitt spielt hier deswegen eine Rolle, da das damit verbundene Problem des Römerbriefschlusses unter der heuristischen Grundannahme der vorliegenden Arbeit eine neue Lösung verspricht. Darüber hinaus ist es das zentrale textkritische Problem des Römerbriefes und darf daher an dieser Stelle nicht ignoriert werden. Dagegen wird auf die Untersuchung von Rm 2,3–11 verzichtet, da die Evidenz, auf der SCHMID sein Urteil gründet, dass die besagten Verse im von Marcion verwendeten Römerbrief fehlten, nach meinem Dafürhalten nicht plausibel genug sind.2
Im Detail gestaltet sich die Vorgehensweise wie folgt: Zunächst wird der Text der 10-Briefe-Sammung für den untersuchten Textabschnitt genau erfasst. Dazu ist es geboten, den Text des Römerbriefes in Marcions Apostolos (10Rm) anhand der häresiologischen Bezeugung zu rekonstruieren, genau genommen die Differenz zwischen der 10- und der 14-Briefe-Sammlung so genau wie möglich zu erfassen. Anschließend ist anhand der genannten Kriterien zu prüfen, ob es sich tatsächlich (wie immer behauptet) um marcionitische Sonderlesarten (also durch Marcion erzeugte Varianten) handelt oder ob sie doch nur als durch Marcion bezeugt gelten dürfen. In diesem Fall müsste man die Entstehung der jeweiligen Lesart also auf mindestens eines der bekannten Kriterien zurückführen können. Das Zustandekommen der Lesart wäre also (1) aufgrund des Zitierverhaltens des jeweiligen Häresiologen zu erklären, oder geht (2) auf einen üblichen Fehler im Überlieferungsprozess zurück oder ist (3) auch anderweitig bezeugt.
Da die Entstehung der besagten Textdifferenzen zwischen dem durch Marcion bezeugten Römerbrief und dem katholischen Text (also zwischen 10Rm und 14Rm) aufgrund ihres großen Umfangs kaum durch die Zitiergewohnheiten der Häresiologen (citation habits) zu erklären sind, bleibt das zweite (failures in tradition) und v. a. das dritte methodische Kriterium (attestation elsewhere) zu überprüfen. Dabei trägt Letzteres zweifelsohne das meiste argumentative Gewicht.3 Es wird also in erster Linie darum gehen, zu überprüfen, ob nicht auch andere Teile der handschriftlichen Überlieferung des Neuen Testaments das Fehlen von Rm 4 bzw. Rm 9–11 nahe legen. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, so würden auch die letzten Textabschnitte entfallen, die bisher als Beleg der Annahme einer theologisch motivierten marcionitischen Textrevision angeführt wurden.4 Folglich wäre es dann auch absolut legitim, ja sogar methodisch geboten, von der Annahme einer redaktionellen Bearbeitung Marcions und damit auch der Posteriorität der 10-Briefe-Sammlung gegenüber der 14-Briefe-Sammlung (A1) abzusehen.5 Stattdessen müsste man das redaktionelle Gefälle zwischen den beiden Briefsammlungen umkehren (A2) und prüfen, ob so die vielschichtigen textkritischen und überlieferungsgeschichtlichen Phänomene nicht besser erklärt werden können, als es die herkömmliche Hypothese zu tun im Stande ist.
SCHMIDs Annahme einer vormarcionitischen Paulusbriefedition, die sowohl von Marcion redaktionell bearbeitet wurde, die gleichzeitig aber auch die Überlieferung der 14-Briefe-Sammlung beeinflusst hat (A3), ist nur dann sinnvollerweise aufrecht zu erhalten, sollten Marcion tatsächlich redaktionelle Eingriffe nachgewiesen werden können. Konkret also nur dann, wenn es sich bei den „größeren Auslassungen“ tatsächlich um Streichungen handelt, für die Marcion verantwortlich zu machen ist, die also gleichsam durch alle drei beschriebenen methodischen Raster fallen.
Die vorliegende Studie liefert somit einen indirekten Beweis, d.h. einen Beweis durch Kontraposition der herkömmlichen Annahme, Marcion als Textfälscher zu verstehen. Im Schema stellt sich der Argumentationsgang wie folgt dar:
 Übersicht 3:
Übersicht 3:
10Pls → 14Pls
In diesem Fall handelt es sich bei den Textdifferenzen zwischen den beiden Editionen also nicht um Streichungen, sondern um Interpolationen. Den Ausgangspunkt der Überlieferung stellt demnach die 10-Briefe-Sammlung dar, wie sie durch Marcions Apostolos bezeugt ist. D.h. hier geschieht methodisch also eine Gleichsetzung: Die Hinweise, die die Häresiologen für die Textgestalt von Marcions Apostolos liefern, werden ebenso für die Texte der 10-Briefe-Sammlung geltend gemacht. Dies ist dann methodisch statthaft, insofern aus den Quellen nichts Gegenteiliges herauszulesen ist bzw. die Aussagen der Häresiologen mit Textbesonderheiten korrelieren, die sich wahrscheinlich als Überreste der 10-Briefe-Sammlung erklären lassen. Sollte dies für eine große Anzahl bisher als marcionitisch gelabelter Lesarten bzw. Textmerkmale der Fall sein, ist es für die vorliegende Studie legitim, ja sogar geboten, den marcionitischen Römerbrief (McnRm) mit dem Römerbrief der 10-Briefe-Sammlung (10Rm) gleichzusetzen.
Um bisher unentdeckte Spuren der marcionitischen Paulusbriefausgabe in der handschriftlichen Überlieferung des Neuen Testaments zu finden, wird bewusst nicht in erster Linie nur auf die griechische Handschriftentradition zurückgegriffen. Stattdessen werden Bereiche der Textüberlieferung betrachtet, die bisher nahezu ignoriert wurden. So wird die altlateinische Überlieferung eine große Rolle spielen.6 Konkret sind es v. a. die Paratexte, die ein umfangreiches Reservoir darstellen, das bislang in dieser Hinsicht kaum bzw. gar nicht ausgewertet wurde, da sie in den Apparaten der kritischen Textausgaben aus Gründen der methodischen Beschränkung gar nicht auftauchen. Zunächst ist deshalb zu klären, was überhaupt Paratexte sind und welche konkreten Paratexte für die textgeschichtliche Erforschung des Römerbriefes in der vorliegenden Studie von Relevanz sind.
III. Paratextuelle Beigaben als textkritisch relevante Zeugnisse
Paratexte sind ein zentraler Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie. Dass sie für die Fragestellung so bedeutsam werden konnten, liegt grundsätzlich darin begründet, dass Paratexte Textzustände repräsentieren können, die sehr viel älter sind als die Handschriften, in denen sie heute zu finden sind. Weil sie so viel älter sind, erlauben sie einen Blick in die frühe HSS-Überlieferung, deren Analyse unverzichtbar ist, will man das Verhältnis der 10-Briefe-Sammlung und der 14-Briefe-Sammlung bestimmen. Zunächst allerdings ist zu klären, was überhaupt ein Paratext ist.
3.1. Begriffsklärung – was sind Paratexte?
Der Begriff Paratext geht auf den französischen Literaturwissenschaftler Gérard GENETTE zurück. GENETTE bezeichnet damit all „jenes Beiwerk, durch das ein Text zum Buch wird und als solches vor die Leser und, allgemeiner, vor die Öffentlichkeit tritt.“1 Konkret nennt und analysiert er unter diesem Oberbegriff „Titel, Untertitel, Zwischentitel; Vorworte, Nachworte, Hinweise an den Leser, Einleitungen, usw.; Marginalien, Fußnoten, Anmerkungen; Motti, Illustrationen; Waschzettel, Schleifen, Umschlag und viele andere Arten zusätzlicher auto- oder allographer Signale.“2 Dabei beschäftigte sich GENETTE vornehmlich (allerdings nicht ausschließlich) mit der Literatur der Moderne. Für die antiken und mittelalterlichen Texte konstatiert er, dass diese „häufig beinahe im Rohzustand, in Form von Handschriften ohne jegliche Präsentationsformen, zirkulierten.“3
Doch hier irrt der moderne Literaturwissenschaftler. Denn sowohl die antike Literatur im Allgemeinen4 als auch die biblische Texttradition im Speziellen bieten überaus reichhaltiges paratextuelles Material. Das aktuelle Forschungsprojekt „Paratexts of the Bible“ (ParaTexBib) der Universität Basel hat sich die Erfassung und Untersuchung sämtlicher paratextueller Elemente der griechischen Bibelhandschriften zur Aufgabe gemacht und in diesem Zuge festgestellt, dass fast alle der zahlreichen Handschriften und Handschriftenfragmente der Bibel einiges mehr als nur den eigentlichen Text beinhalten. Entgegen der Einschätzung GENETTEs existiert darin eine Fülle von zusätzlichem Material wie Einleitungen, Vorworte, Gedichte, Gebete, Illustrationen, aber auch strukturelle Elemente wie z.B. Kapitelverzeichnisse.5
Die Ergebnisse des Projekts unter der Leitung von Martin WALLRAFF und Patrick ANDRIST versprechen wichtige Einsichten und schärfen den Blick auf das Überlieferungsgeschehen der biblischen Texte als einen komplexen, kulturellen Prozess.6 Zu Recht weisen die Projektleiter auf ein Forschungsdesiderat hin, denn eine systematische Erfassung und Aufarbeitung der zahlreichen und diversen paratextuellen Elemente seitens der Biblischen Theologie steht bisher noch immer aus. Insbesondere die vom INTF beeinflusste Textkritik hätte demnach alles außerhalb des (eigentlichen) biblischen Textes bisher größtenteils als irrelevant verstanden, da es nicht dazu beitrage, den entfernten Urtext zu rekonstruieren.7
Die vorliegende Arbeit versteht sich u. a. auch als Beitrag, diese Lücke zu füllen bzw. dieses Missverständnis zu entkräften. So soll deutlich gemacht werden, dass die in der Folge untersuchten Paratexte gleichsam als Beschreibungen von Handschriften verstanden werden müssen. Sie liefern wichtige Informationen, die auf den Umfang und den Inhalt der ihnen zugrunde liegenden HSS schließen lassen. Sie sind also textgeschichtlich alles andere als irrelevant. Dass diese Einsicht nicht gänzlich neu ist, zeigt ein Blick auf die neutestamentliche Forschung des 19. Jahrhunderts. So bewertet der französische Theologe Samuel BERGER die Bedeutung der paratextuellen Beigaben (genauer gesagt der Kapitellisten) hinsichtlich der Erforschung der Textgeschichte der biblischen Bücher überaus hoch, ja sogar als unerlässlich.8
Im vergangenen Jahrhundert allerdings scheint diese Einsicht in Vergessenheit geraten zu sein. Möglicherweise trug der immense Zuwachs an auswertbaren biblischen Handschriften dazu bei, dass sich das Forschungsinteresse mehrheitlich auf die Texte selbst konzentrierte. Zusätzliche Textelemente werden als bloßes Beiwerk verstanden.9 Erst in der jüngeren Zeit scheint hier wieder ein Paradigmenwechsel wahrnehmbar: Die Etablierung des o.g. Forschungsprojektes (ParaTexBib), die Neuauflage von Donatien de BRUYNEs wegweisender Ausgabe der lateinischen Kapitellisten,10 aber auch einzelne Studien zu den paratextuellen Beigaben der biblischen Handschriften (z.B. SCHERBENSKE) – diese Aufzählung will nur einige Beispiele nennen, die allerdings verdeutlichen, dass das Interesse an den Paratexten wieder deutlich ansteigt. Nun ist es an der Zeit, dass auch die gegenwärtige textkritische Forschung dies wahrnimmt. Aus diesem Grund sollen die Paratexte zum Römerbrief für die Lösung der schwerwiegenden textkritischen Probleme nutzbar gemacht werden.
Neben der griechischen Handschriftentradition (auf welcher der ausschließliche Fokus von ParaTexBib liegt) bietet die lateinische Überlieferung des Neuen Testaments sogar noch einen reichhaltigeren Fundus an paratextuellen Beigaben zu den tatsächlichen Texten.11 Für die aktuelle Studie sind v. a. Prolog- und Kapitelreihen in den Fokus der Untersuchung gerückt. Grundsätzlich sind die beiden Elemente deswegen interessant, weil sie wichtige Hinweise auf die Existenz sowie das Aussehen von Texten, Textformen bzw. Textcorpora liefern, für die sich – wie noch gezeigt wird – ein sehr früher Ursprung nahelegt. Man kann davon ausgehen, dass die Überlieferung der paratextuellen Beigaben in vielen Fällen gänzlich losgelöst von ihren eigentlichen Bezugstexten geschieht, d.h. die Paratexte sind oftmals zeitlich und geographisch „weit gewandert“12. So taucht eine Vielzahl von ihnen heute nur noch in Vulgatahandschriften auf, weist tatsächlich aber auf altlateinische Vorlagen, also prä-Vulgata-HSS zurück. Dies wird in den nachfolgenden Ausführungen eingehend dargelegt. Unter bestimmten Bedingungen können Paratexte also Textzustände überliefern, die um einiges älter sind als die Handschriften, in denen sie auftauchen. Moderne textkritische Studien sollten daher nicht darauf verzichten, die paratextuellen Beigaben in ihre Untersuchungen mit einzubeziehen.13Auch HOUGHTON weist ausdrücklich darauf hin, dass z.B. die Auswertung der Kapitelverzeichnisse unumgänglich für die Erforschung der Geschichte der biblischen Texte bzw. der Textcorpora ist.14
3.2. Die altlateinischen Kapitelverzeichnisse
Während die Prologe an späterer Stelle der vorliegenden Arbeit noch ausführlicher thematisiert werden,1 sei hier zunächst der Fokus auf die Kapitelverzeichnisse gelegt. Diese treten in der griechischen Handschriftentradition als κεφάλαια bzw. τίτλοι auf.2 In den lateinischen Manuskripten werden sie zumeist als tituli, breves bzw. capitula bezeichnet.3 Die ältesten Kapitelverzeichnisse gehen auf das dritte Jahrhundert zurück.4 Tatsächlich wird die vorliegende Studie den Nachweis erbringen, dass einige dieser Kapitellisten sogar auf Texteditionen hinweisen, die noch um einiges älter sind.5
Die Entstehung eines solchen Kapitelverzeichnisses stellt sich wie folgt dar: Zunächst wird der Bezugstext in einzelne Sinnabschnitte (Sektionen) gegliedert, deren Inhalt knapp zusammengefasst wird.6 Diese Zusammenfassungen werden durchnummeriert und in einer Liste zusammengestellt. Die Nummern der Sektionen werden dann an den betreffenden Stellen in den Bezugstext – in der Regel marginal – eingefügt. Die kompletten Kapitelreihen tauchen in den lateinischen Kodizes des Corpus Paulinum meist zwischen den Prologen und dem tatsächlichen Brieftext auf.7 In einigen Fällen orientieren sich die altlateinischen breves stark an griechischen Bibelhandschriften, „deren τίτλοι manchmal nur übersetzt wurden.“8
Der übergeordnete Zweck dieser Kapitelverzeichnisse ist es, dem Leser eine schnelle Orientierung über den gesamten Text zu ermöglichen, gleichsam eine Gliederung bzw. eine Art Inhaltsverzeichnis zu liefern. Mit Hilfe einer dem Text vorangestellten Kapitelliste kann der Leser des Kodex deutlich schneller und gezielter auf den von ihm gesuchten Abschnitt bzw. die konkrete Textstelle zugreifen.9
Neben der genannten Orientierungs- und Gliederungsfunktion fungieren die Kapitelverzeichnisse auch als Interpretationshilfe. Denn in der Art und Weise, wie die einzelnen Textabschnitte zusammengefasst und überschrieben werden, beeinflussen die breves auch das Textverständnis der Leser.10 Diese hermeneutische Funktion der Leserlenkung tritt in einigen Kapitelreihen deutlicher, in anderen weniger deutlich zutage. Für die vorliegende Studie sind v. a. zwei Kapitelverzeichnisse von Bedeutung. Beide werden nachfolgend ausführlich vorgestellt.
3.2.1. Die Capitula Amiatina
Die Capitula Amiatina sind ein lateinisches Kapitelverzeichnis, das bisher v. a. hinsichtlich der Frage nach dem Schluss des Römerbriefes in den Fokus der textkritischen Untersuchungen gerückt ist. Das Verzeichnis zum Römerbrief (in der Folge mit KA Rm A bezeichnet)1 unterteilt den Text desselben in 51 Sektionen, die relativ ausführliche und teilweise sehr umfangreiche Zusammenfassungen der jeweiligen Textabschnitte bieten. Keine andere bekannte lateinische Kapitelreihe weist für den Römerbrief eine annähernd große Zahl an Sektionen auf. Der Textumfang im Bezugstext, den die einzelnen Sektionen beschrieben, ist uneinheitlich, d.h. die Zusammenfassungen der Textabschnitte geschieht unterschiedlich ausführlich.2
Seine Bezeichnung verdankt sich das Verzeichnis der ältesten Handschrift, in der es auftaucht – dem Codex Amiatinus (Vg A),3 der ältesten erhaltenen Vollbibel der lateinischen Vulgata. Darüber hinaus findet sich die besagte Kapitelreihe auch noch in weiteren lateinischen Handschriften, z.B. dem Codex Carolinus4 (K → VgO bzw. ΦG → VgS), dem Codex Frisingensis5 (Vg M), dem Codex Laudianus6 (O → VgO), dem Codex Vallicellianus7 (V → VgO bzw. ΦV → VgS) und dem Codex Harleianus8 (Z → VgO = VL 65).9 Das Verzeichnis war also sehr weit verbreitet – vergleichbar mit den altlateinischen Paulusprologen, die oftmals in denselben Manuskripten auftauchen. Es wird also deutlich, dass Prologe und Capitula nicht für die jeweilige HS einzeln angefertigt, sondern meist als Teil des zu reproduzierenden Textes mit überliefert wurden. Daher konnte es auch vorkommen, dass Kodizes für verschiedene biblische Bücher jeweils unterschiedliche Kapitelreihen bieten.10
Der Codex Amiatinus selbst entstand zu Beginn des 8. Jahrhunderts im Kloster Wearmouth/Jarrow,11 die darin enthaltenen Kapitellisten werden allerdings als wesentlich älter eingeschätzt. Grund hierfür ist in erster Linie der altlateinische Wortschatz des Textes einzelner Kapitel. So machte LIGHTFOOT bereits im 19. Jh. darauf aufmerksam, dass die Formulierung de tempore serviendo in Sektion XLII auf die altlateinische Wendung τῷ καιρῳ δουλεύοντες statt τῷ κυρίῳ δουλεύοντες (Rm 12,11) zurückgeht.12 Er urteilte folgerichtig: „[T]he Amiatinian capitulation […] belonged originally to the Old Latin and was later adapted to the Vulgate.“13 Bedeutsam ist, dass auch in Teilen der griechischen Handschriftentradition die ältere Lesart bezeugt ist, namentlich in den Handschriften D* F und G. In der Folge konnte RIGGENBACH auch andere solcher altlateinischer Wendungen im Text der KA Rm A nachweisen. Er bestätigte LIGHTFOOTs Urteil und erweiterte es dahingehend, dass er die Capitula Amiatina in ausdrückliche Nähe zu d und g setzte, also den lateinischen Texten der Bilinguen D und G (Codex Claromontanus und Codex Augiensis).14 Auch CORSSEN identifizierte zahlreiche weitere Lesarten der altlateinischen Paulustexte im Text der Kapitelliste.15 Die Forschung schätzte ihre Textgrundlage daher einvernehmlich als sehr alt ein und datierte ihren Ursprung mindestens ins 4. Jahrhundert16 oder sogar in noch weitaus frühere Zeiten.17
Ein weiteres, bisher unentdecktes Beispiel für dieses für die Datierung wichtige Phänomen des altlateinischen Wortschatzes der Kapitelliste, findet sich in Sektion XI:
| Über das Rühmen der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes (5,2) und in gleicher Weise das Rühmen der Bedrängnis (5,3).18 |
| De gloriatione spei gloriae dei pariter gloriatione tribulationis. |
KA Rm A: Sektion XI
Der erste Teil der Sektion bezieht sich auf Rm 5,2. Darin erklärt Paulus, dass seine Gemeinden und er sich der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit Gottes rühmt. Im Römerbrieftext des Codex Amiatinus ist dagegen davon die Rede, dass man sich der Herrlichkeit der Söhne Gottes rühmen könne (gloriae filiorum dei). Der Text des Capitulum und der Bezugstext stimmen also nicht überein. Die Wendung gloriae filiorum dei, die der Codex Amiatinus hier bezeugt, ist die Lesart der Vulgata (Abb. 1):19
 Abb. 1:
Abb. 1:
Codex Amiatinus (A) – Rm 5,2 → „gloriae filiorum dei“
Dagegen bieten einige altlateinische Handschriften an dieser Stelle die kürzere Formulierung gloriae dei.20 Exemplarisch sei der Blick auf den ältesten bekannten altlateinischen Text für die Paulusbriefe, den Codex Claromontanus (d = VL 75), geworfen, der die kürzere Variante liest (Abb. 2):21
 Abb. 2:
Abb. 2:
Codex Claromontanus (d) – Rm 5,2 → „gloriae dei“
Diese altlateinische Variante wird auch durch den Text der besagten Sektion XI der KA Rm A bezeugt. Dass ein Kapitelverzeichnis Textelemente ganz unterschiedlichen Alters enthalten kann und diese unbedingt unabhängig von dem konkreten Text der Handschrift, in der es auftaucht, ausgewertet werden muss, ergibt sich auch aus der Entstehungssituation das Codex Amiatinus. Die Untersuchungen sind sich einig, dass der Amiatinus in seiner äußeren Gestaltung und seinem Aufbau auf eine Bibelausgabe des Cassiodor – einem Gelehrten des 6. Jahrhunderts aus Kalabrien – zurückgeht: den sog. Codex grandior. Der Text der einzelnen Bücher geht dagegen auf ganz andere (verschiedene) Vorlagen zurück. So fasst FISCHER wie folgt zusammen:
„Der Amiatinus ist ein Pandekt [scil. eine Vollbibel], der im Ganzen bewußt nach dem Vorbild des Codex grandior des Cassiodor gestaltet worden ist. […] Um den Ansprüchen der Zeit gerecht zu werden, wählte man als Text durchgängig die Vulgata.“22
Dieses Vorgehen bei der Herstellung solcher Vollbibeln setzt eine gewisse wissenschaftliche Redaktions- und Editionstätigkeit voraus. Cassiodor selbst liefert in seinen Institutiones eine Art Anleitung für das Kopieren antiker Bücher. Er weist hierin dezidiert darauf hin, dass dabei mehrere Handschriften als Vorlagen herangezogen werden sollen. Durch den Vergleich dieser Vorlagen sollen Mängel beseitigt werden mit dem Ziel, den bestmöglichen Text zu bieten, auf den man aufgrund der vorhandenen Vorlagen Zugriff hat.23 Auf diese Weise wird auch das Phänomen erklärbar, dass Lesarten einer Handschrift in eine andere eindringen, ohne dass alle Besonderheiten der Vorlagehandschrift „mitkopiert“ werden.
Als Zwischenfazit bleibt zu sagen: Paratextuelle Beigaben müssen unabhängig von der Handschrift ausgewertet werden, in der sie auftauchen. Die hier beschriebenen Kapitelverzeichnisse bezeugen z.B. sowohl Textvarianten als auch Textzustände, die weitaus älter zu datieren sind als ihre tatsächlichen Bezugstexte.
Methodologischer Exkurs:
An dieser Stelle ist es geboten, eine terminologische Unterscheidung einzuführen. Das beschriebene Beispiel macht die Notwendigkeit einer klaren Trennung zwischen dem ursprünglichen Bezugstext und dem tatsächlichen Bezugstext eines Paratextes deutlich.24 Während der tatsächliche Bezugstext die konkrete Handschrift meint, in der der Paratext zu lesen ist (im Falle der KA Rm A also der Codex Amiatinus), ist der ursprüngliche Bezugstext derjenige Text, für den der jeweilige Paratext ursprünglich angefertigt wurde (quasi der „Muttertext“).
Diese Unterscheidung lässt sich strukturell auch in den Ausführungen von Gerd MINK, dem Begründer der kohärenzbasierten genealogischen Methode (CBGM)25, wiederfinden. So erklärt MINK:
„Elemente einer genealogischen Hypothese sind nicht die Handschriften, sondern der Textzustand, den sie überliefern und der viel älter sein kann als die jeweilige Handschrift. Der Text in seinem jeweiligen Zustand wird hier als Zeuge bezeichnet, nicht die Handschrift.“26
Hierin wird deutlich gemacht, dass es tatsächlich der Textzustand ist, der im Fokus der textkritischen Arbeit steht, nicht die Handschrift selbst, die ihn bezeugt. Mit dem Begriff Textzustand bezeichnet MINK „die Summe aller Lesarten, die innerhalb eines Manuskriptes […] gemeinsam überliefert werden.“27 Übertragen auf die eben gemachte terminologische Unterscheidung lässt sich somit für die Auswertung der Paratexte sagen: der tatsächliche Bezugstext einer Kapitelliste – also die Handschrift, in der der Paratext auftaucht – tritt vollständig in den Hintergrund.28 Der eigentliche Gegenstand der Untersuchung ist demnach der Textzustand, der durch den Paratext bezeugt wird und der erheblich älter sein kann als die Handschrift, von der er repräsentiert wird.29 Die Analyse des Paratextes erlaubt es also, Rückschlüsse auf den Textzustand seines ursprünglichen Bezugstextes zu ziehen und bietet zahlreiche Hinweise, wie dieser tatsächlich ausgesehen haben könnte. Natürlich bleibt der „Muttertext“ eines Kapitelverzeichnisses in letzter Instanz nicht konkret greifbar, ist als Handschrift also nicht identifizierbar. Betrachtet man die verschwindend geringe Anzahl uns bekannter biblischer Handschriften aus den ersten Jahrhunderten, so kann man mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass die ursprünglichen Bezugstexte der uns bekannten Paratexte in der Mehrzahl der Fälle gar nicht „überlebt“ haben. Umso wichtiger ist es für die Erforschung der frühen Textgeschichte des NT, die paratextuellen Beigaben ernst zu nehmen und sie als Beschreibungen von Handschriften auch textkritisch auszuwerten. Denn sie liefern einen reichhaltigen Fundus an textgeschichtlichen Besonderheiten, die in einigen Fällen bis in die frühesten Stadien der handschriftlichen Bezeugung der biblischen Texte zurückreichen, für die unsere Kenntnisse teilweise sehr überschaubar sind.
Sowohl die in der vorliegenden Studie untersuchten Kapitellisten als auch die Prologe bezeugen textgeschichtlich besonders alte Textzustände. Denn wie an späterer Stelle ausführlich gezeigt wird, weist beispielsweise der ursprüngliche Bezugstext der amiatinischen Kapitellisten textuelle Besonderheiten auf, die ihn in unmittelbare Nähe zu Marcions Apostolos setzen. Damit deuten sie auf einen Textzustand hin, der bereits im frühen zweiten Jahrhundert nachweisbar ist.
Um in der Terminologie des Instituts für neutestamentliche Textforschung (INTF) in Münster zu sprechen, müsste man also konstatieren: Der Textzustand, den die KA Rm A für den Römerbrief bezeugen, weist eine hohe prägenealogische Kohärenz30 zum von Marcion verwendeten Römerbrief auf, also dem Römerbrief der 10-Briefe-Sammlung. Diese Einsicht sei an dieser Stelle bereits vorweggenommen. Sie wird in den nachfolgenden Kapiteln der vorliegenden Studie ausführlich begründet.