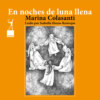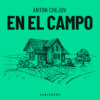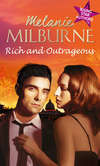Kitabı oku: «Jugendgerichtsgesetz», sayfa 35
§ 18 Dauer der Jugendstrafe
(1) 1Das Mindestmaß der Jugendstrafe beträgt sechs Monate, das Höchstmaß fünf Jahre. 2Handelt es sich bei der Tat um ein Verbrechen, für das nach dem allgemeinen Strafrecht eine Höchststrafe von mehr als zehn Jahren Freiheitsstrafe angedroht ist, so ist das Höchstmaß zehn Jahre. 3Die Strafrahmen des allgemeinen Strafrechts gelten nicht.
(2) Die Jugendstrafe ist so zu bemessen, dass die erforderliche erzieherische Einwirkung möglich ist.
Kommentierung
I.Reichweite der Vorschrift und praktische Bedeutung1 – 3
II.Mindest- und Höchstmaß der Jugendstrafe4 – 8
III.Bemessung der Jugendstrafe9 – 30
1.Mittelbare Bedeutung der Strafrahmen des allgemeinen Strafrechts11, 12
2.Begrenzungen13 – 18
a)Jugendspezifische Strafzumessung13
b)Schuldüberschreitungsverbot14, 15
c)Strafzwecke16, 17
d)Dreieckssystem wechselseitiger Kontrolle und Begrenzung18
3.Einzelne Strafzumessungsschritte19 – 30
a)Schädliche Neigungen19 – 27
b)Schwere der Schuld28 – 30
Literatur:
Bottke Generalprävention und Jugendstrafrecht, 1984; Brunner Nichtanrechnung von U-Haft auf Jugendstrafe, NStZ 1999, 35–36; Detter Zum Strafzumessungs- und Maßregelrecht, NStZ 2007, 206–211; Dünkel Freiheitsentzug für junge Rechtsbrecher, 1990; ders. Keine Verschärfungen des Jugendstrafrechts, sondern konsequenter Ausbau sozialintegrativer Maßnahmen des geltenden JGG!, NK 2010, 2; Göppinger Angewandte Kriminologie, 1985; Karranedialkova-Krohn/Fegert Prognoseverfahren und Prognosepraxis im Jugendstrafverfahren, ZJJ 2007, 285–294; Kurzberg Jugendstrafe aufgrund schwerer Kriminalität, 2009; Loos Der Schuldgrundsatz als Sanktionierungslimitierung im Jugendstrafrecht, in: Wolff/Marek (Hrsg.), Erziehung und Strafe. Jugendstrafrecht in der Bundesrepublik Deutschland und Polen, 1990, S. 83–91; Miehe Die Bedeutung der Tat im Jugendstrafrecht, 1964; Mollenhauer Zur Problematik langer Freiheitsstrafen vollzogen an jungen Gefangenen, MSchrKrim 1961, 162–177; Nothacker Verhängung, Bemessung und Aussetzung zur Bewährung von Jugendstrafe (Rechtsprechungsübersicht), ZfJ 1985, 334–341; Ostendorf Das Jugendstrafrecht als Vorreiter für die Verknüpfung von Zurechnung und Prävention: für ein einheitliches Maß bei Strafen und Maßregeln, StV 2015, 766–772; Pfeiffer Unser Jugendstrafrecht – Eine Strafe für die Jugend, DVJJ-J 1991, 114–130; Schaffstein Schädliche Neigungen und Schwere der Schuld als Voraussetzungen der Jugendstrafe, in: Lüttger (Hrsg.) FS Ernst Heinitz zum 70. Geburtstag, 1972, S. 461–476; ders. Die Dauer der Freiheitsstrafe bei jungen Straffälligen, in: Herren (Hrsg.), Kultur-Kriminalität-Strafrecht – FS Thomas Würtenberger zum 70. Geburtstag, 1977, S. 449–463; Seiser Die Untergrenze der Einheitsjugendstrafe nach Einbeziehung eines früheren Urteils, NStZ 1997, 374–376; Sonnen Strafbarkeit, Verfolgbarkeit und Bestrafbarkeit im Jugendstrafrecht, in: FS Wolter, 2013, 1223-1233; Stenger in: DVJJ (Hrsg.) Jugendgerichtsverfahren und Kriminalprävention – 19. Deutscher Jugendgerichtstag in Mannheim, 1984, S. 463 ff.); Streng Die Jugendstrafe wegen „schädlicher Neigungen“ (§ 17 II 1. Alt JGG), GA 1984, 149–166; ders. Erziehungsstrafe von mehr als fünf Jahren?, StV 1998, 336–340; Walter/Wilms Künftige Voraussetzungen für die Verhängung der Jugendstrafe: Was kommt nach einem Wegfall der schädlichen Neigungen?, NStZ 2007, 1–8.
I. Reichweite der Vorschrift und praktische Bedeutung
1
§ 18 gilt bei Jugendstrafe gegenüber Jugendlichen und – wenn die Voraussetzungen des § 105 Abs. 1 gegeben sind – Heranwachsenden, und zwar sowohl vor den Jugendgerichten als auch vor den für allgemeine Strafsachen zuständigen Gerichten (§§ 104 Abs. 1 Nr. 1 und 112). Der Jugendrichter darf allerdings nach § 39 Abs. 2 nicht auf Jugendstrafe von mehr als einem Jahr erkennen. Entgegen § 18 Abs. 1 beträgt bei Heranwachsenden die Höchststrafe zehn Jahre, bei Mord und Vorliegen der besonderen Schwere der Schuld 15 Jahre (§ 105 Abs. 3).
2
In der Praxis werden zu mehr als der Hälfte Jugendstrafen bis zu einem Jahr verhängt (1990 = 62,4 %, 1995 = 56,8 %, 2000 = 54,8 %, 2005 = 54 %, 2008 = 53,1 %, 2012 = 48,9 %, 2017 = 48,5 %), von denen in den meisten Fällen die Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird (Zahlenangaben für 2017 bei § 21 Rn. 2). Durch Anrechnung der Untersuchungshaft nach § 52a und der Möglichkeit der Aussetzung des Restes zur Bewährung gem. § 88 verringert sich die tatsächliche Vollzugsdauer in den verbleibenden Fällen. Häufig liegt sie dann unter dem Mindestmaß von sechs Monaten, auch wenn die §§ 52a Abs. 1 S. 3 und 88 Abs. 2 dieses Ergebnis zu verhindern suchen. Beide Vorschriften beruhen auf Annahmen zur erzieherischen Notwendigkeit eines Mindestzeitraums, die von der kriminologischen Sanktionsforschung jedoch nicht hinreichend bestätigt werden konnten (Dünkel 1990, S. 435 und Eisenberg § 18 Rn. 4).
3
Dauer der Jugendstrafe 2012 (insgesamt: 14 803) und 2017 (insgesamt: 9 685)
Quelle: Statistisches Bundesamt Strafverfolgung 2012, 281; 2017, 293.
| Absolute Zahlen | Anteil in % | Aussetzungsquote in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | |
| 6 Monate | 2 020 | 1 142 | 13,7 | 11,8 | 86,7 | 84,8 |
| 6–9 Monate | 2 307 | 1 560 | 15,6 | 16,1 | 83,5 | 81,6 |
| 9–12 Monate | 2 904 | 2 000 | 19,6 | 20,6 | 74,5 | 75,2 |
| 1–2 Jahre | 5 409 | 3 527 | 36,5 | 36,4 | 55,9 | 58,4 |
| 2–3 Jahre | 1 405 | 935 | 9,5 | 9,6 | – | |
| 3–5 Jahre | 662 | 474 | 4,5 | 4,7 | – | |
| 5–10 Jahre | 96 | 47 | 0,7 | 0,5 | – | |
II. Mindest- und Höchstmaß der Jugendstrafe
4
An die Stelle der auf die einzelnen Delikte zugeschnittenen speziellen Strafrahmen des allgemeinen Strafrechts tritt im Jugendstrafrecht ein genereller Strafrahmen, der durch Mindest- und Höchstmaß bestimmt wird. Er beträgt bei Jugendlichen sechs Monate bis zu fünf Jahren, bei Verbrechen, für die nach dem allgemeinen Strafrecht wie z.B. bei Raub, schwerer Brandstiftung, Meineid, Vergewaltigung, Mord und Totschlag eine Höchststrafe von mehr als 10 Jahren Freiheitsstrafe angedroht ist, zehn Jahre. Bei Heranwachsenden ist das Höchstmaß der Jugendstrafe nach § 105 Abs. 3 zehn Jahre, bei Mord und Vorliegen der besonderen Schwere der Schuld 15 Jahre. Da die Strafrahmen des allgemeinen Strafrechts nicht gelten, können auch die gesetzlichen Strafänderungsgründe (seien sie obligatorisch oder fakultativ, seien sie benannt oder unbenannt) nicht zu einer Strafrahmenverschiebung im Jugendstrafrecht führen. Insoweit hat z.B. § 243 StGB („Besonders schwerer Fall des Diebstahls“) keine Bedeutung und gehört von daher auch nicht in den Urteilstenor, BGH NStZ 1999, 205. Die obligatorischen Strafmilderungsgründe wie die §§ 27 Abs. 2, 28 Abs. 1, 30 Abs. 1 und 35 Abs. 2 StGB erlauben keine Unterschreitung des Mindestmaßes von sechs Monaten Jugendstrafe. Die Grenze gilt absolut. Auch im Rechtsmittelverfahren darf deswegen eine z.B. viermonatige Freiheitsstrafe gegenüber einem Heranwachsenden, auf den zu Unrecht allgemeines statt Jugendstrafrecht angewendet worden ist, nicht durch eine Jugendstrafe von vier (oder gar sechs) Monaten ersetzt werden (vgl. § 55 Rn. 46; Ostendorf § 18 Rn. 3). Eisenberg (§ 18 Rn. 7 u. § 55 Rn. 89) geht davon aus, dass das Verschlechterungsverbot das in § 18 Abs. 1 verankerte Mindestmaß der Jugendstrafe bricht. Dem Grundsatz der reformatio in peius ist in diesen Fällen jedoch dadurch Rechnung zu tragen, dass eine andere jugendstrafrechtliche Sanktion unterhalb der Schwelle der Jugendstrafe gewählt wird. Der generelle Strafrahmen wird auch hinsichtlich des Höchstmaßes absolut begrenzt, so dass auch bei Anwendung von § 31 eine Überschreitung unzulässig ist (Einzelheiten bei § 31 Rn. 14, 40, 65; zur Untergrenze der Einheitsjugendstrafe nach Einbeziehung eines früheren Urteils einerseits LG Mannheim NStZ 1997, 388 (nicht notwendig höher) und andererseits führe nach Seiser NStZ 1997, 374 neues Tatunrecht zu höherer Einheitsjugendstrafe; dazu Brunner NStZ 1999, 36, wonach diese aufgrund besserer Erkenntnis der Täterpersönlichkeit milder ausfallen kann).
5
Mindest- und Höchstmaß der Jugendstrafe sind umstritten. Nach Nr. 1 RiJGG a.F. zu § 18 beruht das gesetzliche Mindestmaß auf der Erkenntnis, dass in einem Zeitraum von weniger als sechs Monaten eine wirksame erzieherische Einwirkung grundsätzlich nicht möglich ist. Kriminologisch ist diese Erkenntnis höchst zweifelhaft. Das erhöhte Mindestmaß widerspricht auch der internationalen Entwicklung, die zu einem kurzfristigen Freiheitsentzug tendiert, wenn ein solcher schon nicht zu vermeiden ist (besonders deutlich in den Niederlanden, der Schweiz und Skandinavien; zusammenfassender Überblick bei Dünkel 1990, S. 625 und bei Dünkel/Grzywa/Horsfield/Pruin Juvenile Justice Systems in Europe 2010 – 4 Bände). Im Spektrum der freiheitsentziehenden Sanktionen des Jugendstrafrechts ergibt sich zwischen dem Dauerarrest von höchstens vier Wochen und der Jugendstrafe von mindestens sechs Monaten eine Lücke, die signalisieren soll, wie hoch die Hürde zur Jugendstrafe als ultima ratio ist. Eine „Hochstufung“ der kurzfristigen Freiheitsstrafe ist im JGG gerade zu vermeiden (Schaffstein/Beulke/Swoboda S. 177). Die erhöhte Mindeststrafe des § 18 Abs. 1 führt zu einer weit höheren Durchschnittsdauer bei Jugendlichen und Heranwachsenden als bei Erwachsenen. Mit wachsender Zahl früherer Verurteilungen steigt sie zudem überproportional an (Pfeiffer DVJJ-J 1991, 117). Bei Mord ist durch das Gesetz zur Erweiterung der jugendgerichtlichen Handlungsmöglichkeiten die bisherige Höchststrafe (bei Heranwachsenden) von bisher 10 Jahren auf 15 Jahre angehoben worden (kritisch hierzu Dünkel NK 2010, 2; Pfeiffer ZRP 2012, 157).
6
Bei Heranwachsenden führt die Höchststrafe von fünfzehn Jahren ebenfalls zu einem durchschnittlich längeren Freiheitsentzug und damit bei Anwendung des JGG zu einer Schlechterstellung (Dünkel 1990, S. 625), obwohl der Gesetzgeber, wie u.a. § 106 Abs. 1 beweist, das Gegenteil erreichen wollte. Sowohl bei Jugendlichen, bei denen sich nach § 18 Abs. 1 S. 2 nach abstrakter Betrachtungsweise (BGHSt 8, 79) der Rahmen der Jugendstrafe nach oben hin verschärft, als auch bei Heranwachsenden mit der ausnahmsweise bis zu fünfzehn Jahren möglichen Jugendstrafe ergeben sich Spannungen zu der zwingenden Strafzumessungsregel des § 18 Abs. 2. Eine Jugendstrafe zwischen fünf und zehn Jahren lässt sich allein erzieherisch nicht begründen (BGH NStZ-RR 2020, 32; BGH StV 1996, 269 = NStZ 1996, 232 = NK 3/96, 55 m. Anm. Sonnen; Böhm StV 1986, 71; Mollenhauer MSchrKrim 1961, 162 ff.; Schaffstein/Beulke/Swoboda S. 178; Stenger in: DVJJ (Hrsg.), 1984, S. 463 ff.). Maßgebend sind hier Aspekte des Schuldausgleichs (Vergeltung und Sühne und allgemeine Sicherungsinteressen). Zutreffend merkt Albrecht 2000, S. 254 an, dass haftbedingte Entwicklungsschäden junger Menschen für die Allgemeinheit wesentlich gefährlicher sein können als die vorübergehende Sicherheit in der Zeit der Inhaftierung. Inzwischen begründet der 4. Senat auch Jugendstrafen von 6 Jahren und 6 Monaten (BGH NStZ-RR 1998, 285), von 8 Jahren (BGH StV 1998, 333) und von 10 Jahren (BGH StV 1998, 336) mit Argumenten erforderlicher Erziehung. Diese Rechtsprechung widerspricht der Entstehungsgeschichte (BT-Drucks. I/3264, S. 41), der Gesetzessystematik (enge Anbindung des erhöhten Strafrahmens an besonders schwere Taten, § 18 Abs. 1 S. 2) und der Zielsetzung des JGG. Streng StV 1998, 336, 339 wendet sich zu Recht gegen den „Versuchsballon“, über den Erziehungsaspekt Vergeltungsbedürfnisse der Allgemeinheit sowie Sicherheitsinteressen zu transportieren und auf diesem Weg zur getarnten Einführung einer Jugendsicherungsverwahrung zu gelangen.
7
Kriminalpolitische Forderungen gehen dahin, das Mindestmaß der Jugendstrafe auf einen Monat herabzusetzen und damit dem allgemeinen Strafrecht anzugleichen, Jugendstrafen zwischen einem Monat und sechs Monaten auf besonders gelagerte Ausnahmefälle zu begrenzen und die bisherigen Höchstgrenzen der Jugendstrafe von fünf auf zwei bzw. von zehn auf fünf Jahre zu reduzieren (Dünkel 1990, S. 625 und Pfeiffer DVJJ-J 1991, 127). In einem so veränderten Sanktionsspektrum bliebe dann für den Jugendarrest kein Raum mehr. Auf dem Regensburger Jugendgerichtstag 1992 wurde dagegen für die Beibehaltung des Dauerarrestes und der Strafrahmenuntergrenze von 6 Monaten plädiert, während die Strafrahmenobergrenze bei Jugendlichen auf 4 bzw. 8 Jahre und bei Heranwachsenden auf 5 bzw. 10 Jahre abgesenkt werden soll (DVJJ-J 1992, 290). Genau in die entgegengesetzte Richtung zielt das Gesetz zur Erweiterung der jugendgerichtlichen Handlungsmöglichkeiten vom 4.9.2012, das für Mord durch Heranwachsende bei besonders schwerer Schuld die Höchststrafe auf 15 Jahre festgesetzt hat.
8
Geht das Gericht fälschlicherweise vom Strafrahmen des § 18 Abs. 1 S. 1 (sechs Monate bis fünf Jahre) statt von § 18 Abs. 1 S. 2 (sechs Monate bis zehn Jahre) aus, so soll die Bemessung der Jugendstrafe regelmäßig fehlerhaft sein (BGH NStZ 1984, 446 [Böhm], bei Anwendung von § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG statt von § 30 Abs. 1 Nr. 4 BtMG). Im Hinblick darauf, dass die Strafrahmen des allgemeinen Strafrechts nicht gelten, und bei konsequenter Anwendung des Erziehungsgedankens zur Bemessung der Jugendstrafe ist diese Entscheidung nicht zwingend. Sie belegt nur, dass die Praxis außer dem Erziehungsaspekt weitere Zumessungskriterien berücksichtigt. Im umgekehrten Fall (höherer Strafrahmen) ist die Bemessung der Jugendstrafe fehlerhaft, BGH Beschl. v. 24.7.1997 – 4 StR 259/97 – NStZ-RR 1998, 290 [Böhm].
III. Bemessung der Jugendstrafe
9
Nach § 18 Abs. 2 ist die Dauer der Jugendstrafe nach der erforderlichen erzieherischen Einwirkung zu bemessen. Empirische Untersuchungen bestätigen, dass dieses Kriterium zu deutlich längeren Jugendstrafen als bei einer Orientierung am Schuldprinzip führt (Pfeiffer DVJJ-J 1991, 117; Kurzberg 2009; Streng Rn. 455). Der Gesetzgeber möchte das Spannungsfeld zwischen Erziehung und Verhältnismäßigkeit aber erst in einem späteren JGGÄndG im Zusammenhang mit dem Problembereich des Straftaxendenkens und der Aufschaukelungstendenzen in der Sanktionspraxis der Jugendgerichtsbarkeit behandeln (BT-Drucks. 11/5829, S. 14).
10
§ 18 Abs. 2 steht im Kontrast zum Zumessungsprogramm des allgemeinen Strafrechts in § 46 StGB und bildet die Grundlage für eine eigenständige jugendstrafrechtliche Zumessungslehre. Die Orientierung an der erforderlichen erzieherischen Einwirkung ist bei der Jugendstrafe wegen schädlicher Neigungen zwingend und gilt grundsätzlich auch bei der Jugendstrafe wegen Schwere der Schuld (BGH NStZ-RR 2019, 159; BGHSt 10, 233; 15, 224; 16, 261; BGH NStZ-RR 2017, 231 = StV 2017, 713; BGH NStZ 2016, 683 und auch BGH NStZ 2018, 728 m. Anm. Eisenberg = JR 2019, 38 m. Anm. Kölbel und dazu Beulke NK 2019, 269-281 mit dem Hinweis auf das wegweisende Urteil des AG Rudolstadt ZJJ 2018, 67: Das Jugendstrafrecht als normativer Schonraum zur Vermeidung von Entwicklungsschädigungen steht mit den Mechanismen prinzipieller Strafverschärfung im deutlichen Widerspruch). Der BGH NStZ 2018, 662, misst dem Erziehungsgedanken mit zunehmenden Alter des Täters ein geringeres Gewicht bei („mit jedem Lebensalter sinkt das Gewicht der Berücksichtigungsfähigkeit von erzieherischen Belangen“). Da Jugendstrafe wegen Schwere der Schuld aber keine Erziehungsdefizite voraussetzt, können sich erhebliche Diskrepanzen zwischen dem Erziehungs- und Schuldprinzip ergeben. Um diese deutlich zu verringern, vertreten sowohl die Rechtsprechung als auch die Lehre die Auffassung, dass neben dem vorrangigen Erziehungsgedanken auch der Schuldgehalt der Tat von Bedeutung bleibt (BGH NStZ-RR 2018, 358; BGH StV 1994, 599; OLG Zweibrücken StV 1994, 600; NStZ-RR 2005, 291 [Böhm]; Böhm/Feuerhelm 228 f.; Schaffstein/Beulke/Swoboda S. 178 f.; Walter/Wilms fordern, einen „realistischen und spezifisch kriminalrechtlichen Erziehungsgedanken“ zugrunde zu legen, NStZ 2007, 150; kritisch: Albrecht S. 258, der das Erziehungsprinzip als „wenig rationales Kriterium“ und als „verschleiernde Legitimationskategorie“ bezeichnet, ohnehin weitgehend als „Synonym für Repression und Generalprävention“ missbraucht). Durch die Berücksichtigung des Schuldaspektes erlangen die Strafrahmen des allgemeinen Strafrechts mittelbar auch im Jugendstrafrecht praktische Bedeutung, ebenso wie andere Strafzwecke als nur die positive Spezialprävention i.S.v. Erziehung.
1. Mittelbare Bedeutung der Strafrahmen des allgemeinen Strafrechts
11
Die Strafrahmen des allgemeinen Strafrechts sowie die gesetzlich vorgesehenen Strafschärfungen und Strafmilderungen enthalten grundsätzliche Bewertungen durch den Gesetzgeber. Auch wenn sie nach § 18 Abs. 1 S. 3 nicht unmittelbar gelten, bleiben sie jedoch insoweit mittelbar von Bedeutung für die Bemessung der Jugendstrafe. Obwohl eine Strafrahmenverschiebung nicht stattfindet, sind sie als Zumessungskriterien zu erörtern (BGH NStZ 1990, 174 [Detter]; BGH StV 1989, 545). Freilich darf sich die Höhe der zu verhängenden Jugendstrafe nicht „an der Strafdrohung des verletzten Gesetzes orientieren, um auf diese Weise eine grobe Unverhältnismäßigkeit zwischen Tat und jugendstrafrechtlicher Reaktion zu vermeiden“. Eine solche Argumentation macht die Strafzumessungserwägung rechtsfehlerhaft, weil dadurch die Geltung des generellen jugendstrafrechtlichen Rahmens „in unzulässiger Weise relativiert“ wird (BGHR JGG § 18 Abs. 1 S. 3 minder schwerer Fall 1). Bei der Bemessung der Jugendstrafe gibt es also keine Bindung an die Strafrahmen des allgemeinen Strafrechts, sie dürfen andererseits als Ausdruck gesetzlicher Bewertung des Tatunrechts aber auch nicht ganz außer Betracht bleiben (BGHR JGG § 18 Abs. 1 S. 3; BGH StV 1986, 304; st. Rspr.). Allein der Bezug auf die Strafdrohung des allgemeinen Strafrechts macht die Zumessungserwägung noch nicht unzulässig, wenn nur die erzieherische Orientierung vorrangig deutlich bleibt (BGH NStZ-RR 1997, 281 = StV 1998, 333; a.A. MK-StGB-Radtke JGG § 18 Rn. 19). Möglich ist also die Berücksichtigung von Art und Erfolg eines Verbrechens z.B. in der Form, dass betont wird, dass der zwar nicht unmittelbar geltende aber doch zu berücksichtigende Strafrahmen von § 213 StGB voll auszuschöpfen sei (BGH NStZ 1989, 119).
12
Mittelbare Bedeutung erlangen z.B.:
| – | Unterlassen: BGH NJW 1982, 393 = JR 1982, 464 m. Anm. Bruns; |
| – | verminderte Schuldfähigkeit: BGH Urt. v. 30.5.1996 – 4 StR 109/96; OLG Düsseldorf NStZ-RR 1998, 86; BGH StV 1994, 599; OLG Zweibrücken StV 1994, 600; BGH NStZ 1988, 491 (Böhm); BGH StV 1984, 30; BGH StV 1982, 27; zum Zusammentreffen mit § 27 StGB: BGH NStZ 1984, 75; zum Zusammentreffen mit § 213 StGB: BGH NStZ 1984, 446 (Böhm); BGH NJW 2003, 2394 [allg. StrafR]:Verneinung bei selbstverschuldeter Trunkenheit, Eisenberg sieht dies aber wegen der Reifeentwicklung eher nicht für das Jugendstrafrecht gegeben, § 17 Rn. 15c. |
| – | Versuch: BGH NStZ-RR 2019, 159 – Versuchsmilderung, verminderte Schuldfähigkeit, und minderschwerer Fall; BGHR JGG § 18 Abs. 1 S. 3 minder schwerer Fall 1; BGH NStZ 1984, 446 (Böhm); BGH St 61, 188=ZJJ 2016, 299: einseitig schulderhöhende Berücksichtigung des Vollendungsvorsatzes ohne Berücksichtigung des strafbefreienden Rücktritts ist fehlerhaft. |
| – | Beihilfe: BGH StV 1984, 254; BGH MDR 1977, 63; |
| – | § 125a StGB: BGH MDR 1978, 280 (Holtz) und NStZ-RR 2000, 322 (Böhm); |
| – | § 177 Abs. 2 StGB: BGH StV 1982, 338; |
| – | § 177 Abs. 9 StGB: BGH NStZ-RR 2019, 59; |
| – | § 178 Var. 2 StGB: BGH NStZ 1990, 529 (Böhm); BGH GA 1986, 177; OLG Hamm NStZ 1985, 447 (Böhm); |
| – | § 213 StGB: BGH NStZ 1988, 491 (Böhm); BGHR JGG § 18 Abs. 1 S. 3 minder schwerer Fall 1 und 2; BGH StV 1982, 473; |
| – | § 243 StGB: BGH MDR 1976, 769; |
| – | § 249 Abs. 2 StGB: BGH NStZ 1988, 491 (Böhm) = BGHR JGG § 18 Abs. 1 S. 3 minder schwerer Fall 3; |
| – | § 316a Abs. 2 StGB: BGH StV 1996 270; |
| – | BtMG: OLG Hamm StV 2001, 178; vgl. aber BGH NStZ 2001, 381. |
| – | Die Tatsache, dass der Tatbestand der Kindestötung (§ 217 StGB) zum 1.4.1998 entfallen ist, hat keinen Einfluss auf den Bestand der Jugendstrafe, weil der Strafrahmen des § 217 Abs. 2 StGB milder als der des § 213 StGB n.F. ist, BGH Beschl. v. 27.11.1998 – 3 StR 332/98; |
| – | § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB n.F. ist beim Einsatz einer Schreckschusspistole als Drohmittel nur erfüllt, wenn die Waffe geladen war und in einer das Opfer gefährdenden Weise eingesetzt wurde. Sonst findet § 250 Abs. 1 Nr. 1 Bst. b) StGB Anwendung, der möglicherweise zu einer milderen Jugendstrafe geführt hätte, BGH Beschl. v. 1.12.1998 – 4 StR 566/98. |