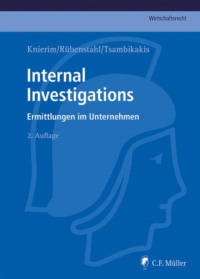Kitabı oku: «Internal Investigations», sayfa 36
41
Ob kumulativ oder als Alternative zu einem Beschlagnahmeverbot analog § 97 Abs. 1 S. 3 InsO ein Verwertungsverbot für solche Erkenntnisse besteht, die die internen Ermittler lediglich auf Grund einer für den Arbeitnehmer bestehenden faktischen Zwangslage oder einer zivilrechtlichen Auskunftspflicht erlangt haben, ist ebenso umstritten, wie das Bestehen dieser Auskunftspflicht selbst.[98] Regelmäßig wird jedoch entweder das eine oder das andere angenommen, um den betroffenen Arbeitnehmer nicht vollkommen schutzlos zu stellen.[99] Sowohl ein Verwertungsverbot als auch ein Schweigerecht gegenüber dem Arbeitgeber wären geeignete Rechtsinstitute, um die Waffengleichheit zwischen staatlichen Ermittlungsbehörden und Beschuldigten zu erhalten. Das Schweigerecht des Arbeitnehmers würde jedoch nicht nur staatliche Ermittlungen, sondern auch die unternehmensinterne Aufklärung der jeweiligen Vorfälle hindern.[100] Das Auskunftsinteresse des Arbeitgebers dürfte damit nach den von der Rechtsprechung des BGH aufgestellten Grundsätzen den Vorrang beanspruchen[101] und ein Verwertungsverbot insbesondere im Hinblick auf die Nähe der entsprechenden Sachverhalte zum Gemeinschuldnerbeschluss vorzugswürdig sein.[102] Auch die Hörfallenentscheidung des BGH[103] legt ein Verwertungsverbot nahe.[104] Es ließe sich über den Anspruch des Beschuldigten auf ein faires Verfahren begründen, der sich aus dem Rechtsstaatsprinzip, den allgemeinen Freiheitsrechten sowie der Pflicht des Staates zur Achtung der Menschenwürde ergibt und in Art. 6 Abs. 1 EMRK seinen einfachgesetzlichen Niederschlag gefunden hat.[105] Die Argumente für ein Verwertungsverbot gewinnen zudem an Gewicht, wenn man bedenkt, dass die mögliche Auskunftspflicht nicht der einzige Unterschied zwischen einer internen Ermittlung und einem staatlichen Ermittlungsverfahren ist.[106] Einem Unternehmen stehen gegenüber seinen Mitarbeitern diverse Möglichkeiten zur Verfügung, um einen faktischen Zwang zur Kooperation zu begründen.[107] Wollte man ein Beweisverwertungsverbot verneinen, müssten ggf. also noch weitere Verfahrensprinzipien auf das interne Ermittlungsverfahren erstreckt werden. Vorrangig ist an eine entsprechende Anwendung des § 136a Abs. 3 StPO zu denken, wenn beispielsweise bewusst über Mitwirkungspflichten getäuscht wird oder sonst unzulässige Vernehmungsmethoden eingesetzt werden.[108] Eine solche Angleichung der internen Ermittlungen an das staatliche Ermittlungsverfahren dürfte jedoch verfassungsrechtliche Bedenken im Hinblick auf das Strafverfolgungsmonopol der Staatsanwaltschaft begründen.[109] Schlussendlich erfolgen interne Ermittlungen aber auch häufig vollkommen unabhängig von einem konkreten Verdacht gegen einen Mitarbeiter, so dass die Standards der StPO keinen geeigneten Maßstab bieten.[110]
c) Gewahrsam des Zeugnisverweigerungsberechtigten gemäß § 97 Abs. 2 S. 1 StPO
42
Über die bisher genannten Voraussetzungen hinaus muss sich der jeweilige Gegenstand nach dem Wortlaut des § 97 Abs. 2 S. 1 StPO auch im Gewahrsam des Zeugnisverweigerungsberechtigten befinden, damit das Beschlagnahmeverbot eingreift. Die ganz herrschende Meinung sieht in § 148 StPO jedoch eine Ergänzung des § 97 Abs. 2 S. 1 StPO für die Kommunikation mit dem Verteidiger, so dass es ausreichen soll, wenn sich der Gegenstand in einem solchen Verhältnis entweder im Gewahrsam des Zeugnisverweigerungsberechtigten befindet oder es sich um Verteidigerpost oder andere schriftliche Verteidigungsunterlagen handelt.[111] Gewahrsam meint dabei die von einem natürlichen Willen getragene Herrschaft über ein Beweismittel unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung. Mitgewahrsam soll nach überwiegender Auffassung genügen, sofern der Mitgewahrsamsinhaber nicht der Beschuldigte selbst ist.[112] Der Gewahrsam an dem Beweismittel erstreckt sich daher auch auf Beweismittel, die z.B. in Schließfächern verwahrt werden und nur gemeinsam mit dem Vermieter entnommen werden können.[113] Sachen auf dem Postweg befinden sich demgegenüber nicht im Gewahrsam des Berufsträgers.[114] Wie bereits ausgeführt, können sie jedoch trotzdem dem Schutzbereich des § 97 StPO unterfallen, wenn es sich um schriftliche Verteidigungsunterlagen handelt. Eine Beschlagnahme von schriftlichen Verteidigungsunterlagen soll dem Gedanken des § 148 StPO entsprechend stets ausgeschlossen sein. Dabei ist es irrelevant, ob sich der Beschuldigten noch auf freiem Fuß befindet oder bereits inhaftiert wurde,[115] ob die Unterlagen bereits abgesandt worden sind oder sich noch im Gewahrsam des Beschuldigten befinden[116] und ob es sich um Papiere oder lesbare Computerdaten handelt.[117] Auch Aufzeichnungen über interne Ermittlungen können Verteidigungsunterlagen darstellen.[118]
Zur Begründung dieser Auffassung heißt es, § 148 StPO garantiere einen freien und ungehinderten mündlichen und schriftlichen Verkehr des Beschuldigten mit seinem Verteidiger und verbiete die Beschlagnahme von Verteidigungsunterlagen daher auch dann, wenn diese sich im Besitz des Beschuldigten befänden.[119] Zwar beziehe sich die Vorschrift des § 148 Abs. 1 StPO seinem Wortlaut nach nur auf den Verkehr des Verteidigers mit einem inhaftierten Beschuldigten. Dieser Grundsatz des freien ungehinderten Verkehrs müsse jedoch auch für den auf freiem Fuß befindlichen Beschuldigten gelten.[120] § 148 StPO sei Ausdruck einer allgemeinen Rechtsgarantie des unüberwachten Verkehrs zwischen Verteidiger und Beschuldigten und diene somit einer wirksamen ungehinderten Strafverteidigung. Der Schutz gelte daher erst Recht für den in Freiheit befindlichen Beschuldigten.[121] Eine ausdrückliche Regelung sei aus diesem Grund unnötig.[122] Nur für den inhaftierten Beschuldigten habe es wegen der besonderen Ausgestaltung des durch die Inhaftierung gegebenen – früher angenommenen[123] – besonderen Gewaltverhältnisses und der insoweit zulässigen Überwachung des mündlichen und schriftlichen Verkehrs des Beschuldigten der besonderen Regelung des § 148 StPO bedurft. Jede andere Auslegung würde zu einer unzulässigen Benachteiligung des auf freiem Fuß befindlichen Beschuldigten führen. Eine Erstreckung des Beschlagnahmeschutzes auf den Postweg sei aus denselben Gründen geboten.[124] Die Erstreckung auf Datenträger entspreche § 11 Abs. 3 StGB.[125]
43
Die schlichte Behauptung, Unterlagen würden zur Verteidigung benötigt, oder die Vermischung von Beweismitteln mit Verteidigungsunterlagen hindert die Beschlagnahme demgegenüber nicht.[126] Soweit es sich allerdings um Verteidigungsunterlagen handelt, dürfen zu Unrecht beschlagnahmte Unterlagen nicht verwertet werden.[127]
44
Endet der Gewahrsam z.B. durch freiwillige Aufgabe, Tod oder Diebstahl, findet § 97 StPO grundsätzlich keine Anwendung mehr.[128] Eine Ausnahme wird in den Fällen gemacht, in denen der berechtigte Gewahrsamsnachfolger derselben Berufskategorie zuzurechnen ist wie der Berufsträger.[129] Einen häufigen Anwendungsfall dieser Ausnahmeregel bildet der Kanzleiübergang auf einen Rechtenachfolger, aber auch die Übergabe des Gegenstandes an einen Kollegen, um fachlichen Rat zu erhalten.[130]
45
Ein Sonderproblem des Gewahrsams stellt sich bei Geschäfts- und Buchungsunterlagen, die der Beschuldigte seinem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer übergeben hat. Hier ist umstritten, ob der Berufsträger Alleingewahrsam hat, was – die weiteren Voraussetzungen unterstellt – zu einem Beschlagnahmeverbot führen würde,[131] oder lediglich Mitgewahrsam mit dem Beschuldigten, was für eine zulässige Beschlagnahme spräche.[132] Mitgewahrsam solle bestehen, weil der Mandant jederzeit berechtigt sei, die Buchhaltungsunterlagen zurückzufordern.[133] Dieser Argumentation Biermanns und des LG Aachen hatte das LG München aber schon früh und überzeugend widersprochen. Rechte an einem Gegenstand könnten grundsätzlich keinen Gewahrsam begründen.[134] Für den Gewahrsamsinhaber sei vielmehr die tatsächliche Sachherrschaft kennzeichnend. Deshalb führe der Umstand, dass der Mandant Unterlagen zurückfordern könne, nicht zur Begründung eines Mitgewahrsams. Diese Auffassung kann heute wohl als herrschend bezeichnet werden.[135] Der Argumentation ist nichts hinzuzufügen.
46
Ein weiteres Auslegungsproblem stellt sich in Bezug auf elektronische Dokumente, da der Gewahrsam an ihnen im Einzelfall schwer zu bestimmen ist, wenn auf diese von verschiedenen Orten zugegriffen werden kann. Für das Beschlagnahmeverbot des § 97 StPO ist jedoch allein maßgeblich, wo diese Dateien gespeichert sind.[136] Es ist damit auf den Gewahrsam am Datenträger abzustellen. Eine Ausnahme ist erneut für Verteidigungsunterlagen zu machen.
d) Beschlagnahme erforderlich, keine freiwillige Herausgabe
47
Wie bereits unter Rn. 28 ausgeführt, schützt § 97 StPO nur vor Beschlagnahme. Eine freiwillige Herausgabe ist jederzeit möglich.
3. Kein Ausschluss der Beschlagnahmefreiheit
a) Sog. „Verstrickung“, § 97 Abs. 2 S. 3 1. Var. StPO
48
Nach § 97 Abs. 2 S. 3 1. Var. StPO gilt das Beschlagnahmeverbot nicht, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person an der Tat (Anm.: des Anvertrauenden) oder an einer Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei beteiligt ist. Diese Formulierung entspricht auch § 160a Abs. 4 S. 1 StPO. Auf die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens kommt es dabei ebenso wenig an[137] wie auf die Frage, ob die Beteiligung strafbar ist.[138] Lediglich eine rechtswidrige Tat i.S.d. § 11 Abs. 1 Nr. 5 StGB soll erforderlich sein.[139] Der Verdacht selbst muss sich aus bestimmten äußeren oder inneren Tatsachen ergeben und über vage Anhaltspunkte und bloße Vermutungen hinausreichen.[140] Der erforderliche Grad der Konkretisierung ist abhängig von der Schwere des Eingriffs in das Vertrauensverhältnis und muss bereits im Zeitpunkt der Anordnung der Beschlagnahme erreicht sein.[141] Bei Verteidigern gilt im Hinblick auf § 148 StPO die Besonderheit, dass stets gewichtige Anhaltspunkte für eine Beteiligung erforderlich sind.[142]
b) Sog. „Deliktsgegenstände“, § 97 Abs. 2 S. 3 2. Var. StPO
49
Nach § 97 Abs. 2 S. 3 2. Var. StPO gilt das Beschlagnahmeverbot ebenfalls nicht, wenn es sich bei den zu beschlagnahmenden Gegenständen um solche handelt, die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, zu ihrer Begehung gebraucht worden oder bestimmt sind oder die aus einer Straftat herrühren. Sie können daher unbeschränkt beschlagnahmt werden. Unter Gegenstände, die zur Begehung einer Straftat gebraucht worden sind, fallen auch solche, die der Tatvorbereitung dienten.[143] Häufig genannte Beispiele sind der über einen beabsichtigten Betrug geführte Schriftwechsel[144] und die zur Begehung einer Wirtschafts- oder Steuerstraftat benutzten Buchungsunterlagen.[145]
4. Rechtsfolgen des Verstoßes gegen das Beschlagnahmeverbot
50
Verstoßen die Ermittlungsbehörden gegen das einen Berufsgeheimnisträger betreffende Beschlagnahmeverbot, richtet sich die Verwertbarkeit bzw. Verwendbarkeit[146] nach § 160a StPO. § 160a Abs. 1 S. 2 und S. 5 StPO führt stets zur Unverwendbarkeit, im Rahmen des § 160a Abs. 2 S. 3 StPO ist eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nach strengen Maßstäben durchzuführen. Die Erweiterung des Anwendungsbereichs von § 160a Abs. 1 StPO zum 1.2.2011 u.a. auf Rechtsanwälte[147] ist zu beachten. Der in § 160a Abs. 5 StPO normierte Vorrang des § 97 StPO gilt mit umstrittenem Umfang nur für die Ermittlungsmaßnahme als solche und betrifft die Regelung zur Verwendbarkeit erlangter Erkenntnisse bei Gesetzesverstößen nicht.[148] Die Verwertung der Erkenntnisse trotz Verwertungs- bzw. Verwendungsverbot führt zu einem Revisionsgrund.[149] Im Rahmen der Revisionsbegründung muss dargelegt werden, dass die Voraussetzungen der §§ 97 Abs. 2 S. 3, 160a Abs. 4 StPO nicht vorlagen.[150]
51
War die Beschlagnahme zunächst zulässig, bleiben die Erkenntnisse nach herrschender Auffassung verwertbar, selbst wenn später ein Beschlagnahmehindernis entsteht, z.B. der Teilnahmeverdacht entfällt.[151] Im umgekehrten Fall, wenn die Beschlagnahme zunächst unzulässig war, sie aber nachträglich zulässig wird, sollen die Erkenntnisse ebenfalls verwertbar sein, es sei denn, der Verdacht ergibt sich erst aus den unzulässigerweise gewonnenen Erkenntnissen.[152]
Anmerkungen
[1]
BVerfGE 20, 162, 188; 32, 373, 385.
[2]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 1.
[3]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 50 und § 160a Rn. 17.
[4]
Vgl. unten Rn. 68.
[5]
LR-StPO/Menges § 97 Rn. 11.
[6]
RGSt 50, 241, 242; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 10.
[7]
Vgl. oben Rn. 10; umfassend zur alten Rechtslage Roxin NJW 1995, 17, 21 ff.
[8]
BGHSt 25, 168, 169; OLG Hamburg MDR 1981, 603, 603; Krekeler NStZ 1987, 199, 201; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 4 mit zahlreichen weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung und zu einzelnen Berufsgruppen.
[9]
Krekeler NStZ 1987, 199, 201.
[10]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 4.
[11]
Bandisch NJW 1987, 2200, 2204, m.w.N.
[12]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 4a und 8.
[13]
Vgl. oben Rn. 23.
[14]
BGHSt 38, 144, 145; KK-StPO/Greven § 97 Rn. 5; a.A. Gülzow NJW 1981, 265, 267.
[15]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 24.
[16]
Vgl. oben Rn. 17 sowie Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 25; a.A. OLG Nürnberg NJW 1958, 272, 274; OLG Hamburg NJW 1962, 689, 691.
[17]
Fezer JuS 1978, 765, 767; KK-StPO/Greven § 97 Rn. 6.
[18]
Wohlers NStZ 1990, 245, 246; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 6.
[19]
MK-StPO/Hauschild § 97 Rn. 51.
[20]
MK-StPO//Hauschild § 97 Rn. 51; KK-StPO/Greven § 97 Rn. 3.
[21]
Fezer JuS 1978, 765, 768.
[22]
BGHSt 18, 227, 230; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 5.
[23]
KK-StPO/Greven § 97 Rn. 3; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 7.
[24]
KK-StPO/Greven § 97 Rn. 3 f.
[25]
Umfassend BeckOK/Ritzert § 97 Rn. 24 ff. m.w.N. auch zur Gegenauffassung.
[26]
BGHSt 44, 46, 48; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 28.
[27]
KK-StPO/Greven § 97 Rn. 11; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 28.
[28]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 28.
[29]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 28.
[30]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 28.
[31]
BGHSt 33, 148, 151; OLG München NStZ 2006, 300, 301; KK-StPO/Greven § 97 Rn. 11.
[32]
LG Bonn wistra 2006, 396, 397.
[33]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 29.
[34]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 29.
[35]
BVerfGE NStZ 2002, 377, 377; KK-StPO/Greven § 97 Rn. 11 und 13.
[36]
Vgl. zur Beschlagnahme von Urkundsentwürfen LG Köln NJW 1981, 1746, 1747; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 40.
[37]
LG Darmstadt wistra 1987, 232, 232; LG Stuttgart wistra 1988, 245, 245; LG Freiburg wistra 1998, 35, 36; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 40.
[38]
Vgl. OLG Nürnberg NJW 1958, 272, 273.
[39]
Vgl. LG Berlin NJW 1990, 1058, 1058.
[40]
Vgl. zu weiteren Beispielen Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 30.
[41]
OLG Celle NJW 1963, 406, 407; NJW 1965, 362, 363; LG Braunschweig NJW 1978, 2108, 2109; LG Hildesheim NStZ 1982, 394, 395; LG Mainz NStZ 1986, 473, 474; LG Darmstadt NStZ 1988, 286, 286 f.
[42]
OLG Celle NJW 1965, 362, 363; LG Hildesheim NStZ 1982, 394, 395.
[43]
OLG Celle NJW 1965, 362, 363; LG Hildesheim NStZ 1982, 394, 395.
[44]
LG Mainz NStZ 1986, 473, 474.
[45]
Durchsuchung und Beschlagnahme, Rn. 609.
[46]
Krekeler NStZ 1987, 199, 201.
[47]
Krekeler NStZ 1987, 199, 201.
[48]
Krekeler NStZ 1987, 199, 201; Meyer-Goßner/Schmitt § 53 Rn. 7 und 9 m.w.N.
[49]
So wörtlich Krekeler NStZ 1987, 199, 201; Meyer-Goßner/Schmitt § 53 Rn. 9.
[50]
Krekeler NStZ 1987, 199, 201; Park Durchsuchung und Beschlagnahme, Rn. 570, m.w.N.
[51]
OLG Frankfurt NStZ 2006, 302, 303.
[52]
So etwa OLG Koblenz StV 1995, 570, 570; LG Stuttgart DStR 1997, 1449, 1450; LG Fulda NJW 2000, 1508, 1509; OLG Frankfurt NStZ 2006, 302, 303.
[53]
OLG Koblenz StV 1995, 570, 570; LG Stuttgart DStR 1997, 1449, 1450, mit zust. Anm. Füllsack; LG Fulda NJW 2000, 1508, 1509; OLG Frankfurt NStZ 2006, 302, 303; KK-StPO/Greven § 97 Rn. 20; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 36.
[54]
LG Braunschweig NJW 1978, 2108, 2108 f. Ebenso LG München wistra 1985, 41, 42; LG Darmstadt NStZ 1988, 286, 286, jeweils m.w.N.
[55]
LG Braunschweig NJW 1978, 2108, 2109.
[56]
LG Braunschweig NJW 1978, 2108, 2109.
[57]
LG Braunschweig NJW 1978, 2108, 2109.
[58]
Umfassend zu diesem Streit Park Durchsuchung und Beschlagnahme, Rn. 566 ff.
[59]
LG Berlin NJW 1977, 725, 725; LG Hamburg wistra 2005, 394, 397; LG Dresden NJW 2007, 2709, 2710 f.; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 40 m.w.N. auch zur Gegenauffassung. Für eine generelle Beschlagnahmefreiheit auch von Buchführungsunterlagen LG Stade NStZ 1987, 38, 39.
[60]
BVerfG NJW 1981, 33, 33 ff.; NJW 1982, 1687, 1687 ff.
[61]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 40.
[62]
LG München NJW 1984, 1191, 1192.
[63]
LG München NJW 1984, 1191, 1192; LG Stade NStZ 1987, 38, 39.
[64]
LG München NJW 1984, 1191, 1192.
[65]
LG Stade NStZ 1987, 38, 39; LR-StPO/Ignor/Bertheau § 53 Rn. 18.
[66]
In diesem Sinne auch das LG Dresden NJW 2007, 2709, 2712; vertiefend KK-StPO/Greven § 97 Rn. 14 ff., Park Durchsuchung und Beschlagnahme, Rn. 566 ff., m.w.N.; a.A. Erb FS Kühne, S. 171, 180 ff.
[67]
LG Hamburg StV 2011, 148, 150.
[68]
LG Hamburg StV 2011, 148, 149; zustimmend Bauer StV 2012, 277, 277 ff. Ebenso auch LG Bonn NZWiSt 2013, 21, 24, m. abl. Anm. Jahn/Kirsch.
[69]
Vgl. die Nachweise bei Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 153, Fn. 14.
[70]
So auch Bauer StV 2012, 277, 278, m.w.N. aus der gängigen Literatur.
[71]
Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 151 ff.
[72]
Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 152.
[73]
Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 152.
[74]
Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 152; vgl. Frage der Differenzierbarkeit zwischen Verteidigern und Rechtsanwälten auch Puschke/Singelnstein NJW 2008, 113, 117, und Müller-Jacobsen NJW 2011, 257, 257.
[75]
Vgl. die entsprechende Argumentation bei Müller-Jacobsen NJW 2011, 257, 257.
[76]
Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 154.
[77]
Neugefasst zum 1.2.2011 durch das Gesetz zur Stärkung des Schutzes von Vertrauensverhältnissen zu Rechtsanwälten im Strafprozessrecht v. 22.12.2010, BGBl I S. 2261.
[78]
Noch weiter gehend von Galen NJW 2011, 945, 945, die davon ausgeht, dass die Neufassung des § 160a Abs. 1 StPO unmittelbar zu einem Abwägungsverbot im Rahmen des § 97 StPO führe, soweit Rechtsanwälte betroffen sein. Vgl. zu den Motiven des Gesetzgebers BR-Drucks. 229/10, 2.
[79]
So die Zusammenfassung der Ziele des Gesetzgebers bei der Reform des § 160a StPO durch Müller-Jacobs NJW 2011, 257, 259.
[80]
Von Galen NJW 2011, 945, 945.
[81]
Vgl. zu den nationalen Pflichten Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 152, sowie zur Pflicht amerikanischer Börsenunternehmen Momsen ZIS 2006, 508, 510, und Zerbes ZStW 125 (2013), 551, 554 f.
[82]
Ebenso stellt auch Braun StV 2012, 277, 278, nur darauf ab, dass zwischen den Interviewpartnern und den internen Ermittlern keine Mandatsbeziehung bestand. Die schutzwürdige Mandatsbeziehung zum Auftraggeber blendet er aus.
[83]
Vgl. dazu BVerfG NStZ-RR 2004, 83, 84; BVerfG NJW 2009, 281, 282; KK-StPO/Greven § 97 Rn. 1.
[84]
BeckOK-StPO/Inhofer § 444 StPO Rn. 17; BeckOK-OWiG/Meyberg § 30 Rn. 110 ff.; Wabnitz/Janovsky/Raum Kap. 4 Rn. 219; Lis StV 2016, 353, 355. Entsprechendes gilt auch für die Verfallsanordnung und andere Beteiligungsformen, vgl. hierzu Jahn/Kirsch NZWiSt 2013, 28, 29, sowie BT-Drucks. 18/5201, 38.
[85]
Wabnitz/Janovsky/Raum Kap. 4 Rn. 219; Lis StV 2016, 353, 355. Entsprechendes gilt auch hier für die Verfallsanordnung und Vergleichbare (vgl. §§ 442, 434 StPO) sowie BT-Drucks. 18/5201, 38.
[86]
Schuster NZWiSt 2012, 431, 432; Lis StV 2016, 353, 355.
[87]
Umfassend Jahn ZIS 2011, 453 ff.; Park Durchsuchung und Beschlagnahme, Rn. 571 ff.; Rotsch/Sahan S. 133, 137 ff.; Zerbes ZStW 125 (2013), 551, 561 ff.
[88]
Vgl. BVerfGE 15, 226, 234.
[89]
So Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 154.
[90]
So wörtlich Müller-Jacobsen NJW 2011, 257, 257.
[91]
Müller-Jacobsen NJW 2011, 257, 257.
[92]
Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 152.
[93]
Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 152.
[94]
Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 152.
[95]
Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 154.
[96]
So das LG Hamburg NJW 1990, 780, 781.
[97]
LG Mannheim NZWiSt 2012, 424, 429, m. im Ergebnis zust. Anm. Schuster; LG Braunschweig BeckRS 2015, 16005.
[98]
Vgl. LG Hamburg StV 2011, 148, 151; von Galen NJW 2011, 945, 945; Ignor CCZ 2011, 143, 143; Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 152; umfassend zum Streit Bauer StV 2012, 277, 278 f., Greco/Caracas NStZ 2015, 7 ff, Rübenstahl WiJ 2012, 17, 20 ff., Rotsch/Taschke S. 65, 70 ff., und Zerbes ZStW 125 (2013), 551, 557 ff. Vgl. auch in diesem Buch 14. Kap. Rn. 33 ff.; 18. Kap. Rn. 16 ff.; 19. Kap. Rn. 26 ff.
[99]
Von Galen NJW 2011, 945, 945.
[100]
Von Galen NJW 2011, 945, 945; a.A. Zerbes ZStW 125 (2013) 551, 559.
[101]
So Rübenstahl WiJ 2012, 17, 22, m.w.N. aus der Rechtsprechung.
[102]
So auch von Galen NJW 2011, 945, 945, mit weiteren Argumenten zur Übertragbarkeit der Entscheidung, und Theile StV 2011, 381, 386; gegen die Übertragbarkeit Ignor CCZ 2011, 143, 143 f. Umfassend zu den Argumenten gegen eine arbeitsrechtliche Auskunftspflicht Bauer StV 2012, 277, 279.
[103]
BGHSt 42, 139, 139 ff.
[104]
Umfassend Momsen ZIS 2011, 508, 514.
[105]
Momsen ZIS 2011, 508, 513.
[106]
Vertiefend und mit zahlreichen Beispielen Momsen ZIS 2011, 508, 511.
[107]
Vertiefend Momsen ZIS 2011, 508, 511; Zerbes ZStW 125 (2013) 551, 552 und 559 f.
[108]
Vgl. Jahn StV 2009, 41, 45. Zudem ist an Belehrungspflichten, das Recht auf einen Verteidiger und weitere zu denken, vgl. hierzu und zu den Thesen des Strafrechtsausschusses des Bundesrechtsanwaltskammer zum Unternehmensanwalt Rübenstahl WiJ 2012, 17, 18 f. und 24 ff.
[109]
Jahn StV 2009, 41, 43; Momsen ZIS 2011, 508, 514.
[110]
Rübenstahl WiJ 2012, 17, 19.
[111]
BGH NJW 1973, 2035, 2035; NJW 1982, 2508, 2508; LG Mainz NStZ 1986, 473, 473; BeckOK-StPO/Ritzert § 97 Rn. 6 f.; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 37, die Letztgenannten jeweils ausführlich und m.w.N. Vgl. zu Anbahnungsgesprächen und dem zeitlichen Anwendungsbereich der Norm einerseits den zustimmungswürdigen Beschluss des LG Gießen BeckRS 2012, 15498, sowie andererseits den Beschluss des LG Bonn NZWiSt 2013, 21, 25, m. abl. Anm. Jahn/Kirsch.
[112]
BGHSt 19, 374, 374; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 12 m.w.N.
[113]
So das Beispiel bei Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 11.
[114]
LR-StPO/Menges § 97 Rn. 38; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 11; a.A. SK-StPO/Wohlers § 97 Rn. 20.
[115]
LG Mainz NStZ 1986, 473, 473; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 37.
[116]
BGH NJW 1982, 2508, 2508; NJW 1990, 722, 722; Specht NJW 1974, 65, 65.
[117]
BVerfG NJW 2002, 1410, 1410 f.; KK-StPO/Greven § 97 Rn. 11 und 13.
[118]
LG Gießen BeckRS 2012, 15498; LG Braunschweig BeckRS 2015, 16005; Jahn/Kirsch NStZ 2012, 718, 720; Lis StV 2016, 353, 354 f., m.w.N.
[119]
LG Mainz NStZ 1986, 473, 473.
[120]
LG Mainz NStZ 1986, 473, 473.
[121]
BGH NJW 1986, 1183, 1184.
[122]
LG Mainz NStZ 1986, 473, 473.
[123]
Vgl. dazu BeckOK-StVollzG/Gerhold Einleitung Rn. 5.
[124]
BGH NJW 1990, 722, 722.
[125]
BVerfG NJW 2002, 1410, 1410.
[126]
KG NJW 1975, 354, 355 f.; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 37.
[127]
BVerfG NJW 2002, 2458, 2459; BGH NJW 1975, 354, 355.
[128]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 13.
[129]
BVerfG NJW 1972, 1123, 1124; KK-StPO/Greven § 97 Rn. 22; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 13.
[130]
KK-StPO/Greven § 97 Rn. 22.
[131]
So Gülzow NJW 1981, 265, 266; KK-StPO/Greven § 97 Rn. 8 und 17; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 40.
[132]
So LG Aachen NJW 1985, 338, 338; Birmanns MDR 1981, 102,103.
[133]
Birmanns MDR 1981, 102, 103.
[134]
LG München NJW 1984, 1191, 1192; ebenso KK-StPO/Greven § 97 Rn. 8; Park Durchsuchung und Beschlagnahme, Rn. 575.
[135]
Für Alleingewahrsam des Berufsträgers KK-StPO/Greven § 97 Rn. 8 und 17; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 40; Park Durchsuchung und Beschlagnahme, Rn. 575.
[136]
KK-StPO/Greven § 97 Rn. 8.
[137]
BGH NJW 1973, 2035, 2035.
[138]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 19.
[139]
SK-StPO/Wohlers § 97 Rn. 38.
[140]
LG Kiel SchlHA 1955, 368, 369; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 20.
[141]
KK-StPO/Greven § 97 Rn. 35; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 20.
[142]
BGH NStZ 2001, 604, 606; KK-StPO/Greven § 97 Rn. 39.
[143]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 22; differenzierend SK-StPO/Wohlers § 97 Rn. 42.
[144]
Mayer SchlHA 1955, 348, 350; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 22.
[145]
OLG Hamburg MDR 1981, 603, 603; LG Aachen NJW 1985, 338, 338.
[146]
Vgl. zu den Unterschieden zwischen einem Beweisverwertungsverbot und einem Beweisverwendungsverbot Meyer-Goßner/Schmitt Einl. Rn. 57d.
[147]
Neugefasst durch das Gesetz zur Stärkung des Schutzes von Vertrauensverhältnissen zu Rechtsanwälten im Strafprozessrecht vom 22.12.2010, BGBl I, S. 2261.
[148]
Vertiefend unten Rn. 68; vgl. auch BT-Drucks. 16/5846, S. 38; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 50.
[149]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 51 und § 160a Rn. 18 jeweils m.w.N.
[150]
Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 51 und § 160a Rn. 18 jeweils m.w.N.
[151]
BGHSt 18, 227, 228 f.; 25, 168, 170; BeckOK-StPO/Ritzert § 97 Rn. 25.
[152]
BGHSt 25, 168, 171; BGH NStZ 1983, 85, 85; NStZ 2001, 604, 606; BeckOK-StPO/Ritzert § 97 Rn. 25; Meyer-Goßner/Schmitt § 97 Rn. 48.