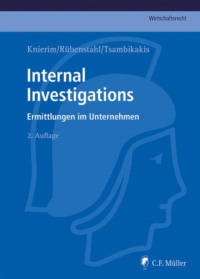Kitabı oku: «Internal Investigations», sayfa 37
1. Teil Ermittlungen im Unternehmen › 5. Kapitel Die Rechtsstellung der internen Ermittler › V. § 160a StPO
V. § 160a StPO
1. Grundlagen
52
Auch die (noch) relativ junge Norm des § 160a StPO[1] dient dem Schutz des Zeugnisverweigerungsrechts von Berufsgeheimnisträgern i.S.d. §§ 53, 53a StPO, indem sie bestimmt, dass dieses bei der Auswahl und Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen, aber auch bei der Verwertung oder sogar der weiteren Verwendung gewonnener Erkenntnisse berücksichtigt werden muss. Zur Durchsetzung dieses Ziels steht in § 160a StPO ein abgestuftes System von Beweiserhebungs-, -verwertungs- und -verwendungsverboten zur Verfügung.[2] Soweit der Berufsträger selbst Beschuldigter eines Strafverfahrens ist, ist die Norm nach herrschender Ansicht unanwendbar.[3] Gleiches gilt, wie auch für die anderen Umgehungsverbote, wenn der Berufsträger wirksam von seiner Verschwiegenheitspflicht entbunden wurde.[4]
2. § 160a Abs. 1 StPO
a) Geschützte Personen
aa) Abs. 1 S. 1 und S. 5
53
Der Anwendungsbereich des § 160a Abs. 1 S. 1 StPO erstreckt sich nach der Neufassung auf die in § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 oder 4 StPO genannten Personen, Rechtsanwälte, nach § 206 BRAO in eine Rechtsanwaltskammer aufgenommene Personen und Kammerrechtsbeistände. Die genannten Personen müssen Adressat der jeweiligen Maßnahme sein.[5] Ermittlungsmaßnahmen gegen sonstige Personen werden grundsätzlich nicht vom Beweiserhebungs- und -verwendungsverbot des Abs. 1 S. 1 erfasst, selbst wenn die Möglichkeit oder sogar Wahrscheinlichkeit besteht, auch geschützte Erkenntnisse zu gewinnen.[6] Der Schutz der in S. 1 genannten Personen wird dann über § 160a Abs. 1 S. 5 StPO gewährt, so dass bei gegen eine sonstige Person gerichteten Ermittlungsmaßnahmen gewonnene Erkenntnisse von einer geschützten Person, über die diese das Zeugnis verweigern dürfte, unverwendbar sind. Die Löschungs- und Dokumentationspflicht gilt ebenfalls. Stellt sich im Einzelfall heraus, dass die gegen einen Dritten gerichtete Ermittlungsmaßnahme wesentliche geschützte Erkenntnisse hervorbringt, besteht ggf. unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten die Pflicht, die Ermittlungsmaßnahme zu beenden.[7] Für Hilfspersonen des Berufsträgers gilt Abs. 3, der den Anwendungsbereich der Norm auf diese erstreckt.
bb) Kein Ausschlussgrund nach Abs. 4
54
§ 160a Abs. 4 S. 1 StPO, der § 97 Abs. 2 S. 3 1. Var. StPO entspricht, schließt die Beweiserhebungs- und -verwendungsverbote aus, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass die zeugnisverweigerungsberechtigten Personen an der Tat oder an einer Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei beteiligt sind. Wie auch im Rahmen des § 97 StPO darf der Verstrickungsverdacht nur auf bestimmte Tatsachen gestützt werden, ein Ermittlungsverfahren gegen den Berufsträger muss aber noch nicht eingeleitet worden sein.[8] Entsteht ein hinreichender Verdacht erst nach der aus diesem Grund unzulässigen Beweiserhebung, sind die Erkenntnisse nach herrschender Ansicht verwertbar, solange sich der Verdacht nicht aus den zu Unrecht gewonnenen Ermittlungsergebnissen ergibt.[9] Dieses Ergebnis erscheint deshalb sachgerecht, weil die Ermittlungsmaßnahme zu dem späteren Zeitpunkt zulässigerweise erfolgen dürfte, und gilt ebenso für die nachträgliche Entbindung von der Schweigepflicht.[10] Im umgekehrten Fall, dass der Verdacht nachträglich wegfällt, kann demgegenüber nicht auf die Rechtsprechung zu § 97 StPO zurückgegriffen werden, da die Verwertungs- und Verwendungsregeln des § 160a StPO in jedem möglichen Verfahrenszeitpunkt eine eigenständige Berücksichtigung verlangen.[11]
b) Ermittlungsmaßnahme
55
Das Beweiserhebungs- und -verwendungsverbot des § 160a Abs. 1 StPO erstreckt sich auf alle Ermittlungsmaßnahmen – nach herrschender Meinung – mit Ausnahme der §§ 97 und 100c Abs. 6 StPO, sofern diese eine eigene Regelung treffen.[12] Ermittlungsmaßnahmen sind Tätigkeiten der Strafverfolgungsbehörden, die auf die Aufdeckung und Erforschung eines Sachverhalts gerichtet sind.[13] Ob die Maßnahme offen oder verdeckt durchgeführt wird, ist irrelevant.[14]
c) Voraussichtliche Erkenntnisse, über die diese Person das Zeugnis verweigern dürfte
56
Der Schutz des § 160a Abs. 1 StPO bezieht sich auf Erkenntnisse, über die die genannten Personen voraussichtlich das Zeugnis verweigern dürften. Die Reichweite des Erhebungs- und Verwendungsverbotes steht daher in unmittelbarem Zusammenhang mit den Vorschriften der §§ 53, 53a StPO und es ist ein enger Zusammenhang der anvertrauten oder bekanntgewordenen Tatsachen mit der Berufsausübung zu fordern. Ist das Bestehen eines Zeugnisverweigerungsrechts umstritten, schlägt dieser Streit unmittelbar auf die Anwendbarkeit des § 160a StPO durch.[15] In tatsächlicher Hinsicht ist Sicherheit über das Bestehen des Zeugnisverweigerungsrechts nicht erforderlich, um den Anwendungsbereich zu eröffnen. Ausreichend ist die Prognose, dass bei Vornahme der jeweiligen Ermittlungsmaßnahme entsprechende Erkenntnisse gewonnen werden.[16] Maßgeblich sind die vorliegenden tatsächlichen Anhaltspunkte.[17] Weitergehende Ermittlungen, ob entsprechende Erkenntnisse zutage treten könnten, sind nicht erforderlich.[18] Treten sie zutage, ist ihre Verwendung gem. § 160a Abs. 1 S. 2 StPO untersagt. Werden nicht geschützte Gegenstände gezielt mit Gegenständen verknüpft, die dem Schutz des § 160a Abs. 1 StPO unterfallen, um eine Überwachung zu verhindern, hindert das rechtsmissbräuchliche Verhalten die Ermittlungsmaßnahme nicht.[19]
d) Rechtsfolgen
aa) Unzulässigkeit der Ermittlungsmaßnahme gemäß Abs. 1 S. 1
57
§ 160a Abs. 1 S. 1 StPO enthält ein Beweiserhebungsverbot, das die genannten Personen von gegen sie gerichteten Ermittlungsmaßnahmen gleich welcher Art freistellt. Die Freistellung ist absolut ausgestaltet, d.h. sie ist keiner Abwägung im Einzelfall zugänglich.[20] Auf die Ausübung des Zeugnisverweigerungsrechts kommt es nicht an.
bb) Beweisverwendungsverbot gemäß Abs. 1 S. 2
58
Unterstützt wird das Beweiserhebungsverbot des S. 1 durch ein absolutes Verwendungsverbot der erlangten Erkenntnisse im weiteren Verfahren. Verboten ist daher nicht nur die Einführung der Erkenntnisse in das Strafverfahren, sondern auch jegliche Form der Nutzung solcher Daten zu Zwecken der weiteren Informationsgewinnung oder -verarbeitung.[21] Ein Verstoß gegen das Beweiserhebungsverbot des § 160a Abs. 1 S. 1 StPO ist nicht erforderlich, um das Verwendungsverbot zu begründen.[22] Im Sinne der Norm „dennoch“ erlangte Erkenntnisse sind insbesondere auch solche, bei denen die Prognose ex ante rechtsfehlerfrei die Durchführung einer Ermittlungsmaßnahme gestattet hat und sich erst ex post herausstellt, dass die Prognose unzutreffend war.[23] Zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung und der besonderen Vertrauensbeziehungen greift das Verwendungsverbot aber auch ein, wenn der Zeugnisverweigerungsberechtigte z.B. ohne Entbindung von der Schweigepflicht freiwillig an der Ermittlungsmaßnahme mitwirkt.[24]
cc) Pflicht zur unverzüglichen Löschung gemäß Abs. 1 S. 3 und zur Erstellung von Aktenvermerken gemäß Abs. 1 S. 4
59
Unverwendbare Daten i.S.d. § 160a Abs. 1 S. 2 StPO sind gem. S. 3 unverzüglich zu löschen. Die Tatsachen der Erlangung und die Löschung der Aufzeichnungen sind gem. S. 3 aktenkundig zu machen, um die Einhaltung der Löschungspflicht zu dokumentieren und zugleich die Voraussetzungen einer gerichtlichen Überprüfung zu erhalten.[25] Der Löschungspflicht unterliegt stets die Person, die mit der Auswertung der Maßnahme betraut ist.[26]
dd) Revisionsgrund
60
Werden Erkenntnisse in der Beweiswürdigung berücksichtigt, die einem Beweisverwertungs- oder sogar -verwendungsverbot i.S.d. § 160a Abs. 1 S. 2 und 5, Abs. 2 S. 3 StPO unterliegen, ist ein relativer Revisionsgrund gegeben.[27] Wie auch im Rahmen des § 97 StPO muss der Revisionsführer darlegen, dass die Voraussetzungen des Abs. 4 nicht vorlagen, wenn diese Möglichkeit ernsthaft in Betracht zu ziehen ist.[28] Wurde zu Unrecht ein Beweisverwertungs- oder -verwendungsverbot angenommen, kann dies mit der Aufklärungsrüge beanstandet werden.[29]
3. § 160a Abs. 2 StPO
a) Geschützte Personen
61
Dem Schutz des Abs. 2 unterfallen gem. S. 1 und 4 die in § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 3–3 b und Nr. 5 genannten Personen mit Ausnahme von Rechtsanwälten, nach § 206 BRAO in eine Rechtsanwaltskammer aufgenommenen Personen und Kammerrechtsbeiständen. Die letztgenannte Gruppe von Berufsträgern wird ja seit der Neufassung des § 160a StPO durch Abs. 1 geschützt. Der Ausschlussgrund des Abs. 4 gilt für Abs. 2 entsprechend den Ausführungen zu Abs. 1.
b) Ermittlungsmaßnahme und Erkenntnisprognose
62
Zu den Tatbestandsmerkmalen „Ermittlungsmaßnahme“ und das „voraussichtliche Erlangen von Erkenntnissen, über die die Person das Zeugnis verweigern dürfte“ gilt das zu Abs. 1 Gesagte entsprechend.
c) Rechtsfolgen
aa) Berücksichtigungspflicht bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung gemäß Abs. 2 S. 1 und 2
63
§ 160a Abs. 2 S. 1 und 2 StPO sieht für die dort genannten Personen ein relatives Beweiserhebungsverbot vor.[30] Dass voraussichtlich Erkenntnisse erlangt werden, über die die geschützten Personen das Zeugnis verweigern dürften, ist im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung besonders zu berücksichtigen. Betrifft das Verfahren keine Straftat von erheblicher Bedeutung, sei – so der Gesetzeswortlaut – in der Regel nicht von einem Überwiegen des Strafverfolgungsinteresses auszugehen. Soweit geboten, ist die Maßnahme dann zu unterlassen oder, soweit dies nach der Art der Maßnahme möglich ist, zu beschränken. Eine Straftat von erheblicher Bedeutung ist nach überwiegender Auffassung eine solche, die mindestens dem Bereich der mittleren Kriminalität zuzurechnen ist, den Rechtsfrieden empfindlich stört und darüber hinaus geeignet erscheint, das Gefühl der Rechtssicherheit der Bevölkerung erheblich zu beeinträchtigten.[31]
64
Die Reichweite des relativen Beweiserhebungsverbotes richtet sich wie auch die Reichweite des absoluten Beweiserhebungsverbotes nach der des Zeugnisverweigerungsrechts. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung selbst ist unabhängig davon durchzuführen, ob sich die Maßnahme unmittelbar gegen den geschützten Berufsträger richtet oder gegen einen Dritten.[32] Anders als in Abs. 1 S. 1 ist es nicht erforderlich, dass sich die Ermittlungsmaßnahme gegen die genannte Person „richtet“. Vielmehr ist nach § 160a Abs. 2 S. 1 StPO ausreichend, dass eine geschützte Person „betroffen wäre“. Einer § 160a Abs. 1 S. 5 StPO entsprechenden Regelung bedurfte es in Abs. 2 daher nicht. Entscheidend ist vielmehr die von den Ermittlungsbehörden anzustellende Prognose, ob die Maßnahmen Erkenntnisse hervorbringen werden, die dem Zeugnisverweigerungsrecht einer geschützten Person unterliegen. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist das Interesse der Allgemeinheit an einer wirksamen Strafrechtspflege gegen das Interesse der Allgemeinheit an der vom Berufsträger wahrgenommenen Aufgabe und dem individuellen Interesse an der Geheimhaltung der jeweiligen Tatsachen abzuwägen.[33] Bei Straftaten, die nicht von erheblicher Bedeutung sind, greift die Regelverpflichtung ein, die entsprechende Maßnahme zu unterlassen. Es handelt sich um einen Fall intendierten Ermessens. Im Wirtschaftsstrafrecht stellt sich im Hinblick auf die Höhe der in Ordnungswidrigkeitenverfahren teilweise verhängten Bußgelder das Sonderproblem, ob § 160a Abs. 2 S. 1 StPO auch Eingriffe zur Ermittlung einer Ordnungswidrigkeit gestattet.[34] Die besseren Gründe sprechen gegen die Verhältnismäßigkeit einer auf Aufdeckung einer Ordnungswidrigkeit gerichteten Ermittlungsmaßnahme, da anderenfalls über die Ordnungswidrigkeit das Verdikt der Gemeinschädlichkeit verhängt werden müsste, was dem Charakter des OWiG widerspricht, so dass eine entsprechende Qualifizierung dem Gesetzgeber vorbehalten bleiben muss.[35]
bb) Beweisverwertung gem. Abs. 2 S. 3
65
Auch für die Frage der Beweisverwertung gilt gem. § 160a Abs. 2 S. 3 StPO der in S. 1 normierte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das Verwertungsverbot ist dabei, wie bereits zu Abs. 1 ausgeführt, nicht an das Bestehen eines Beweiserhebungsverbotes geknüpft, so dass dem unterschiedlichen Zeitpunkt der Beurteilung und den neu gewonnenen Erkenntnissen eine besondere Bedeutung zukommt.[36] Insbesondere kann der Verdacht bezüglich einer erheblichen Straftat zunächst die Beweiserhebung gerechtfertigt haben, sich dann aber zerstreuen, so dass eine Beweisverwertung bezüglich der festgestellten geringfügigen Straftat unverhältnismäßig ist.[37] Ob dies auch in umgekehrter Richtung gilt, etwa wenn trotz Verdachts einer nur geringfügigen Straftat eine Ermittlungsmaßnahme durchgeführt wurde, die dann Erkenntnisse über eine erhebliche Straftat erbringt, ist umstritten.[38] Der Gesetzgeber hat sich in BT-Drucks. 16/5846 S. 37, dafür ausgesprochen. Puschke/Singelnstein nehmen indes an, dass der Mangel nicht ohne weiteres geheilt werde, sondern die Verwertbarkeit des rechtswidrig gewonnenen Beweises nun anhand der Kriterien der Abwägungslehre zu bestimmen sei.[39] Gleiches müsste dann aber auch für Abs. 1 gelten. Vermittelnd schlägt schließlich Bertheau vor, die Unzulässigkeit der Beweiserhebung im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 160a Abs. 2 S. 3 StPO zu berücksichtigen.[40] Auf diese Weise will sie den Bedenken von Puschke und Singelnstein Rechnung tragen. Es bleibt im Hinblick auf ihre Ausführungen zur nachträglichen Entbindung von der Schweigepflicht aber leider unklar, ob diese Einschränkung immer gilt und wie der vergleichbare Fall im Rahmen des § 160a Abs. 1 StPO zu behandeln sei.
66
Zu anderen Zwecken als zu Beweiszwecken können einmal gewonnene Erkenntnisse im Unterschied zu § 160a Abs. 1 StPO stets verwendet werden.[41] Die mittelbare Verwertung der erlangten Informationen wird von Abs. 2 nicht erfasst und die Norm sieht auch keine Löschungs- oder Dokumentationspflichten vor. Ein absolutes Beweiserhebungs- und Verwendungsverbot kann jedoch auch unabhängig von § 160a Abs. 2 StPO aus einem Eingriff in den Kernbereich privater Lebensgestaltung erwachsen.[42]
cc) Revisionsgrund
67
Vgl. oben Rn. 60.
4. § 160a Abs. 5 StPO: § 97 StPO bleibt unberührt
68
Dass § 97 StPO dem § 160a StPO gem. dessen Abs. 5 nur in dem Umfang vorgeht, in dem § 97 StPO eine eigenständige Regelung trifft, wurde bereits wiederholt betont.[43] Die Reichweite dieser Feststellung ist jedoch umstritten. Unstreitig entfaltet § 97 StPO keine Sperrwirkung für die Beweisverwendungs- und -verwertungsanordnungen des § 160a StPO, da sich § 97 StPO ausschließlich auf die Zulässigkeit der Beweiserhebung bezieht.[44] Ebenso unstreitig folgt aus der Vorrangregelung des § 160a Abs. 5 StPO, dass eine Beschlagnahme, die nach § 97 StPO unzulässig ist, auch dann unzulässig bleibt, wenn sie nach § 160a StPO zulässig wäre.[45] Umstritten ist jedoch der gegenläufige Fall, wenn eine Ermittlungsmaßnahme keinem Beschlagnahmeverbot des § 97 StPO unterfällt, aber dem Beweiserhebungsverbot nach § 160a StPO. Die überwiegende Auffassung geht in dem entsprechenden Fall wohl von einer Beschlagnahmemöglichkeit und einem absoluten Vorrang des § 97 StPO für die Beweiserhebung aus, so dass auch der Änderung des § 160a Abs. 1 S. 1 StPO keine Beachtung geschenkt wird.[46] Zu Recht bezeichnet Bertheau dieses Vorgehen jedoch als nicht nachvollziehbar,[47] wenn man an der restriktiven Auslegung des § 97 StPO festhalten möchte. Bertheau führt aus, § 97 StPO sei keine Rechtsgrundlage für Beschlagnahmen, sondern regele ausschließlich Verbote der Beschlagnahme. Die grundsätzliche Zulässigkeit der Beschlagnahme nach den §§ 94 ff. StPO etc. werde vorausgesetzt. § 160a Abs. 5 StPO lasse nun aber nicht die Zulässigkeit der Beschlagnahme unberührt, sondern lediglich deren Verbot nach § 97 StPO. Aus diesem Grund verbiete sich der Schluss, aus § 160a Abs. 5 StPO folge, eine Beschlagnahme sei stets zulässig, wenn § 97 StPO sie nicht verbiete. Ein Verbot der Beschlagnahme könne auch unmittelbar aus § 160a StPO erwachsen. § 97 StPO kann den umfassenden Schutz des § 160a StPO bei enger Auslegung nicht einschränken, sondern muss ihn zwingend ergänzen.[48] Auf diesem Weg gelingt es dann, vertrauliche Dokumente, die nicht dem Beschuldigten zuzuordnen sind, in den Schutz einzubeziehen. Der Preis ist jedoch, dass auch die differenzierten Regelungen über den Ausschluss des Beschlagnahmeverbotes nach § 97 Abs. 2 StPO ausgehebelt werden.[49] Dies war offensichtlich bei der Neufassung des § 160a StPO nicht gewollt, weshalb die Lösung des Problems im Rahmen der Auslegung des § 97 StPO zu suchen ist.[50] Das Ergebnis muss jedenfalls lauten: Dokumente, die ein Rechtsanwalt im Rahmen einer internen Untersuchung erstellt hat und die sich in seinem Gewahrsam befinden, sind von der Beschlagnahme frei.
Anmerkungen
[1]
Eingeführt mit Wirkung zum 1.1.2008 durch Art. 1 Nr. 13a des Gesetzes zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG v. 21.12.2007, BGBl I, S. 3198.
[2]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 1.
[3]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 1.
[4]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 1. Die Sonderprobleme bei der Entbindung von Geistlichen und Abgeordneten berühren die möglichen Fragestellungen zu internen Ermittlungen nicht, vgl. zu diesem Problemkreis Bertheau StV 2012, 303 f.
[5]
KK-StPO/Griesbaum § 160a Rn. 4.
[6]
KK-StPO/Griesbaum § 160a Rn. 4; Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 3.
[7]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 7.
[8]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 15.
[9]
KK-StPO/Griesbaum § 160a Rn. 7; Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 15.
[10]
Bertheau StV 2012, 303, 304.
[11]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 15. Vertiefend Bertheau StV 2012, 303, 304.
[12]
KK-StPO/Griesbaum § 160a Rn. 4.
[13]
KK-StPO/Griesbaum § 160a Rn. 4.
[14]
Bertheau StV 2012, 303, 303.
[15]
Bertheau StV 2012, 303, 303.
[16]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 15.
[17]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 3a.
[18]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 3a.
[19]
LG Mannheim NZWiSt 2012, 424, 429, m. im Ergebnis zust. Anm. Schuster; Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 3a; ähnlich zum Schutz des Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung BVerfG NJW 2008, 822, 834.
[20]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 1 und 3.
[21]
Bertheau StV 2012, 303, 304; Meyer-Goßner/Schmitt Einl. Rn. 57d.
[22]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 4.
[23]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 4.
[24]
BT-Drucks. 16/5846, S. 37; BeckOK-StPO/Ritzert § 97 Rn. 25; Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 1 und 4; vgl. zum Menschenwürdegehalt der Kommunikation mit dem Verteidiger die Nachweise bei KK-StPO/Griesbaum § 160a Rn. 3.
[25]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 6.
[26]
KK-StPO/Griesbaum § 160a Rn. 10.
[27]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 18.
[28]
BGHSt 37, 245, 248; 38, 144, 146; Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 18.
[29]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 18.
[30]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 9.
[31]
BVerfG NJW 2005, 1338, 1339; Meyer-Goßner/Schmitt § 98a Rn. 5. Vgl. zu den Abgrenzungskriterien im Einzelfall Bertheau StV 2012, 303, 304 f.
[32]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 9.
[33]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 9a; Puschke/Singelnstein NJW 2008, 113, 117 m.w.N. aus der Rechtsprechung des BVerfG.
[34]
Bertheau StV 2012, 303, 305, m.w.N. für beide Auffassungen.
[35]
So Bertheau StV 2012, 303, 305.
[36]
BT-Drucks. 16/5846, S. 37; Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 11.
[37]
BT-Drucks. 16/5846, S. 37; Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 11.
[38]
Für eine Verwertbarkeit BT-Drucks. 16/5846, S. 37; Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 11, gegen eine Verwertbarkeit Puschke/Singelnstein NJW 2008, 113, 117.
[39]
Puschke/Singelnstein NJW 2008, 113, 117; zust. KK-StPO/Griesbaum § 160a Rn. 16.
[40]
Bertheau StV 2012, 303, 305. Kritisch zur Einbeziehung der Rechtswidrigkeit der Beweiserhebung in die Verhältnismäßigkeitsprüfung betreffend die Beweisverwertung KK-StPO/Griesbaum § 160a Rn. 16.
[41]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 12.
[42]
BVerfG NJW 2004, 999, 1002 und 1004; Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 13 m.w.N.
[43]
Meyer-Goßner/Schmitt § 160a Rn. 17.
[44]
LG Mannheim NZWiSt 2012, 424, 430, m.w.N. und m. im Ergebnis zust. Anm. Schuster; Erb FS Kühne, S. 171, 176.
[45]
Bertheau StV 2012, 303, 306.
[46]
LG Hamburg StV 2011, 148, 151, zur alten Rechtslage; LG Mannheim NZWiSt 2012, 424, 430, m. im Ergebnis zust. Anm. Schuster; Bauer StV 2012, 277, 277; Jahn/Kirsch StV 2011, 151, 154.
[47]
Bertheau StV 2012, 303, 306.
[48]
So von Galen NJW 2011, 945, 945; zust. Wessing WiJ 2012, 1, 5; Rotsch/Sahan S. 133, 142 ff.
[49]
Vertiefend Erb FS Kühne, S. 171, 175 ff.
[50]
Vgl. dazu auch LG Mannheim NZWiSt 2012, 424, 430, m. dem Ergebnis zust. Anm. Schuster; Jahn/Kirsch NStZ 2012, 718, 719.