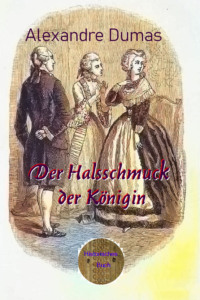Kitabı oku: «Der Halsschmuck der Königin», sayfa 3
"Bah! Ich bin nicht in meinem Reich; nehmt wieder Euren Platz ein, Herzog. Fahren Sie fort, M. de Cagliostro, ich bitte Sie."
Cagliostro blickte wieder durch sein Glas, und man hätte sich vorstellen können, wie die Partikel, die durch diesen Blick aufgewühlt wurden, im Licht tanzten. "Sire", sagte er, "sagen Sie mir, was Sie zu wissen wünschen?"
"Sagt mir, durch welchen Tod ich sterben werde."
"Durch einen Gewehrschuss, Sire."
Die Augen von Gustavus leuchteten auf. "Ah, in einer Schlacht!" sagte er; "der Tod eines Soldaten! Danke, M. de Cagliostro, tausendmal Dank; oh, ich sehe Schlachten voraus, und Gustavus Adolphus und Karl XII. haben mir gezeigt, wie ein König von Schweden sterben sollte."
Cagliostro ließ den Kopf sinken, ohne zu antworten.
"Oh!", rief Graf Haga, "wird meine Wunde dann nicht in der Schlacht gegeben?"
"Nein, Sire."
"In einem Aufruhr?-Ja, das ist möglich."
"Nein, nicht in einem Aufruhr, Majestät."
"Aber, wo dann?"
"Auf einem Ball, Majestät."
Der König schwieg, und Cagliostro vergrub den Kopf in seinen Händen.
Alle sahen bleich und erschrocken aus; dann nahm M. de Condorcet das Glas Wasser und untersuchte es, als ob er darin das Problem von allem, was vorgefallen war, lösen könnte; aber da er nichts fand, was ihn befriedigte, "Nun, auch ich", sagte er, "werde unseren erlauchten Propheten bitten, für mich seinen Zauberspiegel zu konsultieren: leider bin ich kein mächtiger Herr; ich kann nicht befehlen, und mein obskures Leben betrifft keine Millionen von Menschen."
"Herr", sagte Graf Haga, "Sie befehlen im Namen der Wissenschaft, und Ihr Leben gehört nicht nur einer Nation, sondern der ganzen Menschheit."
"Danke", sagte De Condorcet; "aber vielleicht wird Ihre Meinung zu diesem Thema von M. de Cagliostro nicht geteilt."
Cagliostro hob den Kopf. "Ja, Marquis", sagte er in einer Weise, die zu erregen begann, "Sie sind in der Tat ein mächtiger Herr im Reich der Intelligenz; sehen Sie mir also ins Gesicht, und sagen Sie mir, ernsthaft, ob Sie auch wünschen, dass ich Ihnen prophezeie."
"Ernsthaft, Graf, bei meiner Ehre."
"Nun, Marquis", sagte Cagliostro mit heiserer Stimme, "Ihr werdet an dem Gift sterben, das Ihr in Eurem Ring tragt; Ihr werdet sterben -"
"Oh, aber wenn ich ihn wegwerfe?"
"Werfen Sie ihn weg!"
"Du gibst zu, dass das einfach wäre."
"Wirf ihn weg!"
"Oh, ja, Marquis", rief Madame Dubarry; "werfen Sie dieses schreckliche Gift weg! Werfen Sie es weg, und sei es nur, um diesen Propheten des Bösen zu verfälschen, der uns allen so viel Unglück androht. Denn wenn du es wegwirfst, kannst du nicht daran sterben, wie M. de Cagliostro voraussagt; da wird er sich also wenigstens geirrt haben."
"Madame la Comtesse hat recht", sagte Graf Haga.
"Bravo, Gräfin!", sagte Richelieu. "Kommen Sie, Marquis, werfen Sie das Gift weg, denn jetzt, wo ich weiß, dass Sie es bei sich tragen, werde ich jedes Mal zittern, wenn wir zusammen trinken; der Ring könnte sich von selbst öffnen und -"
"Es ist nutzlos", sagte Cagliostro leise; "M. de Condorcet wird es nicht wegwerfen."
"Nein", erwiderte de Condorcet, "ich werde ihn nicht wegwerfen; nicht, weil ich meinem Schicksal nachhelfen will, sondern weil es sich um ein einzigartiges Gift handelt, das von Cabanis zubereitet wurde, und das der Zufall vollständig gehärtet hat, und dieser Zufall könnte nie wieder eintreten; deshalb werde ich ihn nicht wegwerfen. Triumphieren Sie, wenn Sie wollen, M. de Cagliostro."
"Das Schicksal", erwiderte er, "findet immer einen Weg, seine eigenen Ziele zu verwirklichen."
"Dann werde ich durch Gift sterben", sagte der Marquis; "nun, so sei es. Es ist ein bewundernswerter Tod, denke ich; ein wenig Gift auf die Zungenspitze, und ich bin weg. Es ist kaum ein Sterben: es ist nur ein Aufhören zu leben."
"Es ist nicht nötig, dass Sie leiden, mein Herr", sagte Cagliostro.
"Dann, mein Herr", sagte M. de Favras, "haben wir einen Schiffbruch, einen Gewehrschuss und eine Vergiftung, die mir den Mund wässrig macht. Wollen Sie mir nicht auch den Gefallen tun, mir ein kleines Vergnügen der gleichen Art vorauszusagen?"
"Oh, Marquis!" erwiderte Cagliostro, der unter dieser Ironie warm zu werden begann, "beneiden Sie diese Herren nicht, Sie werden noch Besseres haben."
"Besser!" sagte M. de Favras lachend; "das ist ein Versprechen auf viel. Es ist schwer, das Meer, das Feuer und das Gift zu schlagen!"
"Es bleibt die Kordel, Herr Marquis", sagte Cagliostro und verbeugte sich.
"Die Kordel! Was meinen Sie?"
"Ich meine, dass Sie gehängt werden", antwortete Cagliostro, der nicht mehr Herr seiner prophetischen Wut zu sein schien.
"Gehängt! Der Teufel!", rief Richelieu.
"Monsieur vergisst, dass ich ein Edelmann bin", sagte M. de Favras kalt; "oder wenn er meint, von einem Selbstmord zu sprechen, so warne ich ihn, dass ich mich selbst in meinen letzten Augenblicken genügend respektieren werde, um keinen Strick zu benutzen, solange ich ein Schwert habe."
"Ich spreche nicht von einem Selbstmord, Sir."
"Dann sprechen Sie von einer Bestrafung?"
"Ja."
"Sie sind ein Fremder, Sir, und deshalb verzeihe ich Ihnen."
"Was?"
"Ihre Unwissenheit, Sir. In Frankreich enthaupten wir Adlige."
"Das können Sie, wenn Sie können, mit dem Henker regeln", antwortete Cagliostro.
M. de Favras sagte nichts mehr. Ein paar Minuten lang herrschte allgemeines Schweigen und Zurückweichen.
"Wisst Ihr, dass ich zuletzt zittere", sagte M. de Launay; "meine Vorgänger sind so schlecht davongekommen, dass ich um mich fürchte, wenn ich jetzt an die Reihe komme."
"Dann sind Sie vernünftiger als sie; Sie haben Recht. Versuchen Sie nicht, die Zukunft zu kennen; gut oder schlecht, lassen Sie es ruhen - es liegt in den Händen Gottes."
"Oh! M. de Launay," sagte Madame Dubarry, "ich hoffe, Sie werden nicht weniger mutig sein als die anderen."
"Das hoffe ich auch, Madame", sagte der Gouverneur. Dann wandte er sich an Cagliostro: "Mein Herr", sagte er, "bitte geben Sie mir meinerseits mein Horoskop, wenn Sie wollen."
"Es ist leicht", antwortete Cagliostro, "ein Schlag mit dem Beil auf den Kopf, und alles ist vorbei."
Ein Blick des Entsetzens war wieder allgemein. Richelieu und Taverney baten Cagliostro, nichts mehr zu sagen, aber die weibliche Neugier setzte sich durch.
"Wenn man Sie reden hört, Graf", sagte Madame Dubarry, "könnte man meinen, das ganze Universum müsse einen gewaltsamen Tod sterben. Hier waren wir, acht von uns, und fünf sind bereits von Ihnen verurteilt worden."
"Ach, Sie verstehen doch, dass das alles vorbereitet ist, um uns zu erschrecken, und wir werden nur darüber lachen", sagte M. de Favras und versuchte, dies zu tun.
"Gewiss werden wir lachen", sagte Graf Haga, "ob es nun wahr ist oder nicht."
"Oh, dann werde ich auch lachen", sagte Madame Dubarry. "Ich will die Versammlung nicht durch meine Feigheit entehren; aber, ach! Ich bin nur eine Frau, ich kann nicht zu euch gehören und eines tragischen Endes würdig sein; eine Frau stirbt in ihrem Bett. Mein Tod, eine kummervolle alte Frau, die von allen verlassen wird, wird der schlimmste von allen sein. Nicht wahr, M. de Cagliostro?"
Sie hielt inne und schien darauf zu warten, dass der Prophet sie beruhigte. Cagliostro sprach nicht, und da ihre Neugierde die Oberhand über ihre Ängste gewann, fuhr sie fort. "Nun, M. de Cagliostro, wollen Sie mir nicht antworten?"
"Was wünschen Sie von mir zu hören, Madame?"
Sie zögerte, dann nahm sie ihren Mut zusammen: "Ja", rief sie, "ich werde das Risiko eingehen. Erzählen Sie mir das Schicksal von Jeanne de Vaubernier, der Gräfin Dubarry."
"Auf dem Schafott, Madame", antwortete der Prophet des Bösen.
"Ein Scherz, mein Herr, nicht wahr?", sagte sie und sah ihn mit flehender Miene an.
Cagliostro schien es nicht zu sehen. "Warum glauben Sie, dass ich scherze?", fragte er.
"Oh, weil man, um auf dem Schafott zu sterben, ein Verbrechen begangen haben muss - gestohlen, gemordet oder etwas Schreckliches getan haben muss; und es ist unwahrscheinlich, dass ich das tun werde. Es war ein Scherz, nicht wahr?"
"Oh, mon Dieu, ja", sagte Cagliostro; "alles, was ich gesagt habe, ist nur ein Scherz."
Die Gräfin lachte, aber kaum auf eine natürliche Weise. "Kommen Sie, M. de Favras", sagte sie, "lassen Sie uns unsere Beerdigung anordnen."
"Oh, das wird für Sie nicht nötig sein, Madame", sagte Cagliostro.
"Warum denn, Monsieur?"
"Weil Sie in einem Wagen zum Schafott fahren werden."
"Oh, wie furchtbar! Dieser furchtbare Mann, Herr Marschall! Wählen Sie um Himmels willen das nächste Mal fröhlichere Gäste, oder ich werde Sie nie wieder besuchen."
"Verzeihen Sie, Madame", sagte Cagliostro, "aber Sie möchten, dass ich spreche, wie alle anderen auch."
"Zumindest hoffe ich, dass Sie mir Zeit geben, meinen Beichtvater zu wählen."
"Das wird überflüssig sein, Gräfin."
"Warum?"
"Der letzte Mensch, der in Frankreich mit einem Beichtvater das Schafott besteigen wird, wird der König von Frankreich sein." Und Cagliostro sprach diese Worte mit einer so erregenden Stimme aus, dass alle von Entsetzen ergriffen waren.
Alle waren still.
Cagliostro hob das Glas Wasser, in dem er diese schrecklichen Prophezeiungen gelesen hatte, an seine Lippen, aber kaum hatte er es berührt, setzte er es mit einer Bewegung des Ekels ab. Er wandte seinen Blick zu M. de Taverney.
"Oh", rief er entsetzt, "sagen Sie mir nichts; ich will es nicht wissen!"
"Nun, dann werde ich an seiner Stelle fragen", sagte Richelieu.
"Sie, Herr Marschall, seien Sie froh; Sie sind der einzige von uns allen, der in seinem Bett sterben wird."
"Kaffee, meine Herren, Kaffee", rief der Marschall, verzaubert von der Vorhersage. Alle erhoben sich.
Doch bevor sie in den Salon gingen, wandte sich Graf Haga an Cagliostro und sagte
"Sagen Sie mir, wovor ich mich hüten soll."
"Vor einem Muff, Sir", antwortete Cagliostro.
"Und ich?", sagte Condorcet.
"Vor einem Omelett."
"Gut; ich verzichte auf Eier", und er verließ den Raum.
"Und ich?" sagte M. de Favras; "was habe ich zu befürchten?"
"Einen Brief."
"Und ich?" sagte de Launay.
"Die Einnahme der Bastille."
"Oh, Sie beruhigen mich sehr." Und er ging lachend davon.
"Nun zu mir, Sir", sagte die Gräfin zitternd.
"Sie, schöne Gräfin, meiden die Place Louis XV."
"Ach", sagte die Gräfin, "ich habe mich schon einmal dort verloren; an diesem Tag habe ich sehr gelitten."
Sie verließ das Zimmer, und Cagliostro war im Begriff, ihr zu folgen, als Richelieu ihn aufhielt.
"Einen Augenblick", sagte er; "es bleiben nur noch Taverney und ich, mein lieber Zauberer."
"M. de Taverney bat mich, nichts zu sagen, und Sie, Herr Marschall, haben mich nichts gefragt."
"Oh, ich will nichts hören", rief Taverney erneut.
"Aber kommen Sie, um Ihre Macht zu beweisen, sagen Sie uns etwas, was nur Taverney und ich wissen", sagte Richelieu.
"Was?", fragte Cagliostro und lächelte.
"Sagen Sie uns, was Taverney dazu bringt, nach Versailles zu kommen, anstatt ruhig in seinem schönen Haus in Maison-Rouge zu leben, das der König vor drei Jahren für ihn gekauft hat."
"Nichts einfacher als das, Herr Marschall", sagte Cagliostro. "Vor zehn Jahren wollte M. de Taverney seine Tochter, Mademoiselle Andrée, dem König Ludwig XV. schenken, aber es ist ihm nicht gelungen."
"Oh!", knurrte Taverney.
"Nun, Monsieur möchte seinen Sohn Philippe de Taverney der Königin Marie Antoinette schenken; fragen Sie ihn, ob ich die Wahrheit sage."
"Bei meinem Wort", sagte Taverney, zitternd, "dieser Mann ist ein Zauberer; der Teufel soll mich holen, wenn er es nicht ist!"
"Sprich nicht so kavalierhaft vom Teufel, mein alter Kamerad", sagte der Marschall.
"Es ist furchtbar", murmelte Taverney, und er wandte sich um, um Cagliostro zu beschwören, diskret zu sein, aber er war fort.
"Kommen Sie, Taverney, in den Salon", sagte der Marschall, "oder sie werden ihren Kaffee ohne uns trinken."
Aber als sie dort ankamen, war das Zimmer leer; niemand hatte den Mut, dem Urheber dieser schrecklichen Vorhersagen erneut gegenüberzutreten.
Die Wachslichter brannten in den Kandelabern, das Feuer brannte auf dem Herd, aber alles umsonst.
"Ma foi, alter Freund, es scheint, wir müssen unseren Kaffee tête-à-tête nehmen. Aber wo zum Teufel ist er hin?" Richelieu sah sich um, aber Taverney war verschwunden wie die anderen. "Macht nichts", sagte der Marschall, kicherte, wie Voltaire es hätte tun können, und rieb sich die verdorrten, aber immer noch weißen Hände; "ich werde der einzige sein, der in meinem Bett stirbt. Nun, Graf Cagliostro, glaube ich wenigstens. In meinem Bett! Das war's; ich werde in meinem Bett sterben, und ich hoffe, nicht für lange Zeit. Hola! Mein Kammerdiener und meine Tropfen."
Der Kammerdiener trat mit der Flasche ein, und der Marschall ging mit ihm in das Schlafzimmer.
ENDE DES PROLOGS.
1. Kapitel: Zwei unbekannte Damen.
Den Winter von 1784, das Ungeheuer, das halb Frankreich verschlungen hatte, konnten wir nicht sehen, obwohl er an den Türen knurrte, während wir im Haus von M. de Richelieu, eingeschlossen in jenem warmen und gemütlichen Esszimmer, waren.
Ein wenig Frost an den Fenstern scheint nur der Luxus der Natur zu sein, der zu dem des Menschen hinzukommt. Der Winter hat seine Diamanten, seinen Puder und seine silbernen Stickereien für den reichen Mann, der in seine Pelze eingewickelt und in seine Kutsche gepackt ist oder es sich in den Watten und dem Samt eines gut gewärmten Zimmers gemütlich macht. Raureif ist eine Schönheit, Eis eine Veränderung der Dekoration durch die größten Künstler, die die Reichen durch ihre Fenster bewundern. Wer warm ist, kann die verdorrten Bäume bewundern und im Anblick der schneebedeckten Ebene einen düsteren Reiz finden. Wer sich nach einem Tag ohne Leiden, während Millionen seiner Mitmenschen furchtbare Entbehrungen ertragen müssen, auf sein Daunenbett wirft, zwischen seine feinen und gut gelüfteten Laken, mag feststellen, dass in dieser besten aller möglichen Welten alles zum Besten steht.
Wer aber hungrig ist, sieht nichts von diesen Schönheiten der Natur; wer friert, hasst den Himmel ohne Sonne und folglich ohne ein Lächeln für solche Unglücklichen. Nun, zu der Zeit, wo wir schreiben, also etwa um die Mitte des Monats April, stöhnten allein in Paris dreihunderttausend elende Wesen, die vor Kälte und Hunger starben - in jenem Paris, wo trotz der Prahlerei, dass kaum eine andere Stadt so viele Reiche beherberge, nichts vorbereitet worden war, um die Armen vor dem Verenden an Kälte und Elend zu bewahren.
Seit vier Monaten hatte derselbe bleierne Himmel die Armen aus den Dörfern in die Stadt getrieben, wie er die Wölfe aus den Wäldern in die Dörfer schickte.
Kein Brot mehr. Kein Holz mehr.
Kein Brot mehr für diejenigen, die diese Kälte spürten - kein Holz mehr, um es zu kochen. Alle Vorräte, die man gesammelt hatte, hatte Paris in einem Monat verschlungen. Der Propst, kurzsichtig und unfähig, wusste nicht, wie er für Paris, das unter seiner Obhut stand, das Holz beschaffen sollte, das man in der Nachbarschaft hätte sammeln können. Wenn es gefror, sagte er, der Frost hindere die Pferde daran, es zu bringen; wenn es auftaute, plädierte er auf Mangel an Pferden und Transportmitteln. Ludwig XVI., immer gut und menschlich, immer bereit, sich um die physischen Bedürfnisse seines Volkes zu kümmern, obwohl er die sozialen übersah, begann damit, eine Summe von 200.000 Francs für Pferde und Fuhrwerke beizusteuern, und bestand auf deren sofortiger Verwendung. Doch die Nachfrage war weiterhin größer als das Angebot. Zuerst durfte niemand mehr als eine Wagenladung Holz vom öffentlichen Holzlagerplatz wegbringen, dann wurde die Menge auf die Hälfte beschränkt. Bald sah man die Menschen in langen Reihen vor den Türen warten, so wie man sie später bei den Bäckereien sah. Der König verschenkte sein gesamtes privates Einkommen für wohltätige Zwecke. Er beschaffte 3.000.000 Francs durch ein Stipendium und wandte sie zur Unterstützung der Leidenden an, indem er erklärte, dass jede andere Not vor der von Kälte und Hunger weichen müsse. Die Königin ihrerseits gab 500 Louis aus ihrer Börse. Die Klöster, die Hospitäler und die öffentlichen Gebäude wurden als Asyl für die Armen geöffnet, die in Scharen kamen, um sich an den dort aufbewahrten Feuern zu laben. Sie hofften immer wieder auf Tauwetter, aber der Himmel schien unnachgiebig. Jeden Abend enttäuschte derselbe kupferfarbene Himmel ihre Hoffnungen; und die Sterne leuchteten hell und klar wie Leichenfackeln durch die langen, kalten Nächte, die den Schnee, der tagsüber fiel, immer wieder verhärteten. Den ganzen Tag über räumten Tausende von Arbeitern mit Spaten und Schaufeln den Schnee vor den Häusern weg, so dass sich auf jeder Seite der Straßen, die ohnehin schon zu eng für den Verkehr waren, eine hohe, dicke Mauer erhob und den Weg versperrte. Bald wurden diese Schnee- und Eismassen so groß, dass die Geschäfte von ihnen verdeckt wurden und sie gezwungen waren, den Schnee dort liegen zu lassen, wo er fiel. Paris konnte nicht mehr tun. Sie gab nach und erlaubte dem Winter, sein Schlimmstes zu tun. So vergingen Dezember, Januar, Februar und März, obwohl ab und zu ein paar Tage Tauwetter die Straßen, deren Abwasserkanäle verstopft waren, in fließende Bäche verwandelten. In den Straßen, die zum Teil nur mit Booten befahrbar waren, wurden Pferde ertränkt und Kutschen zerstört. Paris, seinem Charakter treu, sang durch diese Zerstörung durch das Tauwetter, wie es durch jene durch die Hungersnot getan hatte. Prozessionen wurden zu den Märkten gemacht, um die Fischerfrauen zu sehen, die ihre Kunden mit riesigen ledernen Stiefeln bedienten, in die ihre Hosen hineingeschoben waren, und mit ihren Unterröcken, die sie um die Hüften geschlungen hatten, alle lachten, gestikulierten und spritzten sich gegenseitig, während sie im Wasser standen. Das Tauwetter war jedoch nur vorübergehend; der Frost kehrte zurück, härter und hartnäckiger als je zuvor, und man griff auf Schlitten zurück, die von Schlittschuhläufern geschoben oder von raubeinigen Pferden über die Dämme gezogen wurden, die wie polierte Spiegel waren. Die Seine, die viele Fuß tief zugefroren war, wurde zum Treffpunkt für alle Müßiggänger, die sich dort zum Schlittschuhlaufen oder Rutschen versammelten, bis sie, durch die Bewegung aufgewärmt, in die Nähe der Stadt liefen.
Ungefähr eine Woche nach dem von M. de Richelieu gegebenen Abendessen fuhren vier elegante Schlitten in Paris ein und glitten über den gefrorenen Schnee, der den Cours la Reine und das Ende der Boulevards bedeckte. Von da an wurde das Vorankommen schwieriger, denn die Sonne und der Verkehr hatten begonnen, den Schnee und das Eis in eine nasse Masse aus Schmutz zu verwandeln.
Im vordersten Schlitten saßen zwei Männer in braunen Reitmänteln mit Doppelumhängen. Sie wurden von einem schwarzen Pferd gezogen und drehten sich von Zeit zu Zeit um, als ob sie den Schlitten beobachten wollten, der ihnen folgte und in dem sich zwei Damen befanden, die so in Pelze gehüllt waren, dass man ihre Gesichter nicht sehen konnte. Es wäre sogar schwierig gewesen, ihr Geschlecht zu unterscheiden, wenn nicht die Höhe ihrer Frisur gewesen wäre, die von einem kleinen Hut mit einem Federbusch gekrönt wurde. Aus dem kolossalen Gebilde dieser Frisur, das mit Bändern und Juwelen durchsetzt war, entwich gelegentlich eine Wolke aus weißem Pulver, wie wenn ein Windstoß den Schnee von den Bäumen schüttelt.
Die beiden Damen, die nebeneinander saßen, unterhielten sich so ernsthaft, dass sie die zahlreichen Zuschauer, die ihren Weg über die Boulevards verfolgten, kaum bemerkten. Die eine von ihnen, größer und majestätischer als die andere, hielt ein fein besticktes Kambriktuch vor ihr Gesicht und trug ihren Kopf aufrecht und stattlich, trotz des Windes, der über ihren Schlitten fegte.
Es hatte gerade fünf Uhr in der Kirche St. Croix d'Antin geschlagen, und die Nacht begann über Paris hereinzubrechen, und mit der Nacht die bittere Kälte. Sie hatten gerade die Porte St. Denis erreicht, als die Dame, von der hier die Rede ist, den Vordermännern ein Zeichen gab, die daraufhin den Schritt ihres Pferdes beschleunigten und bald im Abendnebel verschwanden, der sich schnell um den kolossalen Bau der Bastille verdichtete.
Dieses Signal wiederholte sie dann den beiden anderen Schlitten, die ebenfalls in der Rue St. Denis verschwanden. Derjenige, in dem sie saß, hielt derweil, am Boulevard de Menilmontant angekommen, an.
An diesem Ort waren nur wenige Menschen zu sehen; die Nacht hatte sie zerstreut. Außerdem würden sich in diesem abgelegenen Viertel nicht viele Bürger ohne Fackeln und eine Eskorte trauen, da der Winter die Bedürfnisse von drei- oder viertausend Bettlern, die sich leicht in Räuber verwandeln konnten, verschärft hatte.
Die Dame berührte mit dem Finger die Schulter des Kutschers, der sie fuhr, und sagte: "Weber, wie lange werden Sie brauchen, um das Cabriolet zu bringen, das Sie kennen?"
"Madame wünscht, dass ich das Kabriolett bringe?", fragte der Kutscher mit starkem deutschen Akzent.
"Ja, ich werde über die Straßen zurückkehren; und da sie noch schlammiger sind als der Boulevard, sollten wir nicht mit dem Schlitten vorankommen; außerdem fange ich an, die Kälte zu spüren. Nicht wahr, petite?" sagte sie und wandte sich an die andere Dame.
"Ja, Madame."
"Dann, Weber, werden wir das Kabriolet nehmen."
"Sehr wohl, Madame."
"Wie spät ist es, petite?"
Die junge Dame schaute auf ihre Uhr, die sie allerdings kaum sehen konnte, da es schon dunkel wurde, und sagte: "Viertel vor sechs, Madame."
"Dann um viertel vor sieben, Weber."
Mit diesen Worten sprang die Dame leichtfüßig vom Schlitten, gefolgt von ihrer Freundin, und ging schnell davon, während der Kutscher mit einer Art respektvoller Verzweiflung, die laut genug war, dass seine Herrin sie hören konnte, murmelte: "Oh, mein Gott! welche Unvorsichtigkeit."
Die beiden Damen lachten, zogen ihre Mäntel enger um sich und stapften mit ihren kleinen Füßen durch den Schnee.
"Sie haben gute Augen, Andrée", sagte die Dame, die die ältere der beiden zu sein schien, obwohl sie nicht älter als dreißig oder zweiunddreißig gewesen sein konnte; "versuchen Sie, den Namen an der Ecke dieser Straße zu lesen."
"Rue du Pont-aux-Choux, Madame."
"Rue du Pont-aux-Choux! Ah, mon Dieu, wir müssen uns geirrt haben. Man sagte mir die zweite Straße rechts;-aber was für ein Geruch von heißem Brot!"
"Das ist nicht verwunderlich", sagte ihr Begleiter, "denn hier ist eine Bäckerei."
"Nun, fragen wir dort nach der Rue St. Claude", sagte sie und ging auf die Tür zu.
"Oh! Gehen Sie nicht hinein, Madame; erlauben Sie mir", sagte Andrée.
"Die Rue St. Claude, meine hübschen Damen?", sagte eine fröhliche Stimme. "Sie fragen nach der Rue St. Claude?"
Die beiden Damen wandten sich der Stimme zu und sahen, an die Ladentür gelehnt, einen Mann, der trotz der Kälte Brust und Beine ganz nackt hatte.
"Oh! Ein nackter Mann!" rief die junge Dame, sich halb hinter ihrem Begleiter versteckend; "sind wir unter Wilden?"
"War es nicht das, was Sie wollten?" sagte der Bäckergeselle, denn ein solcher war er, der ihre Bewegung nicht im Geringsten verstand und, an seine eigene Tracht gewöhnt, nicht im Traum an die Wirkung auf sie dachte.
"Ja, mein Freund, die Rue St. Claude", sagte die ältere Dame, kaum imstande, sich das Lachen zu verkneifen.
"Oh, sie ist nicht schwer zu finden; außerdem werde ich Sie selbst dorthin führen", und er begann, den Worten die Tat folgen lassend, seine langen knochigen Beine zu bewegen, die in riesigen Holzschuhen endeten.
"Oh, nein!" rief die ältere Dame, die sich einen solchen Führer nicht vorstellen konnte; "bitte, stören Sie sich nicht. Sagen Sie uns den Weg, und wir werden ihn leicht finden."
"Die erste Straße rechts", sagte er und zog sich wieder zurück.
"Danke", sagten die Damen und liefen weiter, so schnell sie konnten, damit er das Lachen nicht hörte, dass sie nicht mehr unterdrücken konnten.