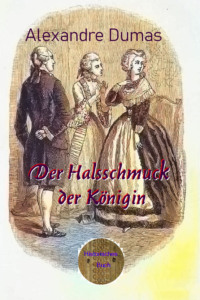Kitabı oku: «Der Halsschmuck der Königin», sayfa 4
2. Kapitel: Ein Innenraum.
Wenn wir nicht zu sehr mit dem Gedächtnis unserer Leser rechnen, kennen sie sicherlich die Rue St. Claude, die an einem Ende in den Boulevard und am anderen Ende in die Rue St. Louis mündet; das war eine wichtige Straße im ersten Teil unserer Geschichte, als sie von Joseph Balsamo, seiner Sibylle Lorenza und seinem Herrn Althotas bewohnt wurde. Es war immer noch eine respektable Straße, wenn auch schlecht beleuchtet und keineswegs sauber, aber wenig bekannt oder frequentiert.
An der Ecke des Boulevards befand sich jedoch ein großes Haus mit aristokratischer Ausstrahlung; aber dieses Haus, das durch die Anzahl seiner Fenster die ganze Straße hätte erhellen können, wenn es beleuchtet gewesen wäre, war das dunkelste und düsterste von allen. Man sah nie, dass sich die Tür öffnete, und die Fenster waren dick mit Staub bedeckt, der sich nie zu regen schien. Manchmal näherte sich ein Müßiggänger, von Neugierde angelockt, dem Tor und spähte hindurch; aber alles, was er sehen konnte, waren Massen von Unkraut, die zwischen den Steinen des Hofes wuchsen, und grünes Moos, das sich über alles ausbreitete. Gelegentlich rannte eine riesige Ratte, die einzige Bewohnerin dieser verlassenen Domänen, über den Hof, auf dem Weg zu ihrer üblichen Behausung in den Kellern, was ihr jedoch als ein Übermaß an Bescheidenheit erschien, wo sie doch die Wahl zwischen so vielen schönen Wohnzimmern hatte, in denen sie niemals das Eindringen einer Katze zu befürchten hatte.
Manchmal blieben ein oder zwei Nachbarn, die am Haus vorbeikamen, stehen, um sich umzuschauen, und einer sagte zum anderen:
"Na, was siehst du?"
"Nun", antwortete er, "ich sehe die Ratte."
"Oh! Lass mich sie ansehen. Wie dick sie geworden ist!"
"Das ist nicht zu verwundern; er wird nie gestört; und im Haus muß es gute Beute geben. M. de Balsamo ist so plötzlich verschwunden, dass er etwas zurückgelassen haben muss."
"Aber Sie vergessen, dass das Haus halb abgebrannt war."
Und sie setzten ihren Weg fort.
Gegenüber dieser Ruine stand ein hohes schmales Haus, das von einer Gartenmauer umschlossen war. Aus den oberen Fenstern war ein Licht zu sehen; der Rest war in Dunkelheit gehüllt. Entweder schliefen schon alle Bewohner, oder sie waren sehr sparsam mit Holz und Kerzen, die in diesem Winter sicher furchtbar teuer waren. Wir haben aber nur mit dem fünften Stock zu tun.
Wir müssen uns zunächst einen Überblick über das Haus verschaffen und, die Treppe hinaufsteigend, die erste Tür öffnen. Dieser Raum ist jedoch leer und dunkel, aber er öffnet sich in einen anderen, dessen Einrichtung unsere Aufmerksamkeit verdient.
Die Türen waren bunt gestrichen, und es befanden sich darin weiß bezogene Sessel mit gelben Samtbesätzen und ein dazu passendes Sofa, dessen Kissen allerdings so voller Altersfalten waren, dass sie kaum noch Kissen waren. Zwei Porträts, die an den Wänden hingen, zogen als nächstes die Aufmerksamkeit auf sich. Eine Kerze und eine Lampe - eine auf einem etwa drei Fuß hohen Ständer und die andere auf dem Kamin - warfen ein konstantes Licht auf sie.
Das erste war ein bekanntes Porträt von Heinrich III., König von Frankreich und Polen, mit einer Mütze auf dem Kopf, die sein langes, blasses Gesicht und die schweren Augen überragte, mit einem spitzen Bart und einer Halskrause um den Hals.
Darunter stand in schwarzen Lettern auf einem schlecht vergoldeten Rahmen die Inschrift "Henri de Valois".
Das andere Porträt, dessen Vergoldung neuer und das Gemälde frischer und jünger war, stellte eine junge Dame mit schwarzen Augen, gerader Nase und ziemlich zusammengepressten Lippen dar, die unter einem Turm von Haaren und Bändern erdrückt schien, zu dem die Mütze Heinrichs III. im Verhältnis wie ein Maulwurfshügel zu einer Pyramide stand.
Unter diesem Porträt stand die Inschrift: "Jeanne de Valois".
Schauen Sie auf den feuerlosen Herd, auf die verblichenen Vorhänge, und wenden Sie sich dann einem kleinen Eichentisch in der Ecke zu; denn dort sitzt, auf den Ellbogen gestützt, und die Adressen einiger Briefe schreibend, das Original dieses Porträts.
Ein paar Schritte weiter, in einer halb neugierigen, halb respektvollen Haltung, steht eine kleine alte Frau, offenbar um die sechzig.
"Jeanne de Valois", sagt die Inschrift; aber wenn diese Dame tatsächlich eine Valois ist, fragt man sich, wie das Porträt Heinrichs III., des sybaritischen Königs, des großen Wollüstlings, den Anblick von so viel Armut bei einer Person ertragen konnte, die nicht nur seiner Rasse angehört, sondern auch seinen Namen trägt.
In ihrer Person jedoch machte diese Dame aus dem fünften Stock ihrem Porträt keine Untreue. Sie hatte weiße, zarte Hände, die sie von Zeit zu Zeit aneinander rieb, als wolle sie versuchen, ihnen etwas Wärme zu geben; auch ihr Fuß, der in einen ziemlich koketten Samtpantoffel gehüllt war, war klein und hübsch.
Der Wind pfiff durch alle alten Türen und drang durch die Ritzen der wackelnden Fenster, und die alte Dienerin blickte immer wieder traurig zum leeren Kamin. Ihre Herrin setzte ihre Beschäftigung fort und sprach dabei laut.
"Madame de Misery", murmelte sie; "erste Kammerfrau Ihrer Majestät - ich kann nicht mehr als sechs Louis von ihr erwarten, denn sie hat mir schon einmal gegeben." Und sie seufzte. "Madame Patrick, Kammerzofe Ihrer Majestät, zwei Louis; M. d'Ormesson, eine Audienz; M. de Calonne, einen guten Rat, M. de Rohan, einen Besuch; wenigstens werden wir versuchen, ihn dazu zu bewegen", sagte sie und lächelte bei dem Gedanken. "Nun denn, ich denke, ich darf auf acht Louis innerhalb einer Woche hoffen." Dann blickte sie auf: "Dame Clotilde", sagte sie, "schnupfen Sie diese Kerze."
Die alte Frau tat, wie ihr geheißen, und setzte sich dann wieder auf ihren Platz. Diese Art der Inquisition schien die junge Dame zu ärgern, denn sie sagte: "Bitte gehen Sie und sehen Sie nach, ob Sie nicht das Ende einer Wachskerze für mich finden können; dieser Talg ist widerlich."
"Es gibt keinen", antwortete die alte Frau.
"Aber schau nur."
"Wo?"
"In der Vorkammer."
"Es ist so kalt dort."
"Da läutet jemand", sagte die junge Frau.
"Madame irrt sich", erwiderte die hartnäckige alte Frau.
"Ich dachte, ich hätte es gehört, Dame Clotilde;" dann gab sie den Versuch auf und wandte sich wieder ihren Berechnungen zu. "Acht Louis! Drei schulde ich für die Miete, und fünf habe ich M. de la Motte versprochen, um ihn für seinen Aufenthalt in Bar-sur-Aube zu unterstützen. Pauvre diable, unsere Ehe hat ihn noch nicht bereichert - aber Geduld", und sie lächelte wieder und betrachtete sich in dem Spiegel, der zwischen den beiden Porträts hing. "Nun denn", fuhr sie fort, "mir fehlt noch ein Louis für die Reise von Versailles nach Paris und zurück; eine Woche wohnen, ein Louis; Kleid und Geschenke an die Pförtner der Häuser, wo ich hingehe, vier Louis; aber", sagte sie, indem sie aufstand, "es läutet jemand!"
"Nein, Madame", antwortete die alte Frau. "Es ist unten, in der nächsten Etage."
"Aber ich sage Ihnen doch, dass es nicht so ist", sagte sie ärgerlich, als die Glocke noch lauter läutete.
Auch die alte Frau konnte es nicht länger leugnen, und so humpelte sie davon, um die Tür zu öffnen, während ihre Herrin schnell alle Papiere wegräumte und sich auf das Sofa setzte, wobei sie die Miene einer demütigen und resignierten, wenn auch leidenden Person annahm.
Es war jedoch nur ihr Körper, der sich ausruhte; denn ihre Augen, unruhig und unruhig, suchten unaufhörlich, zuerst ihren Spiegel und dann die Tür.
Endlich öffnete sie sich, und sie hörte eine junge, süße Stimme sagen: "Ist es hier, wo Madame la Comtesse de la Motte wohnt?"
"Madame la Comtesse de la Motte Valois", antwortete Clotilde.
"Es ist dieselbe Person, meine gute Frau; ist sie zu Hause?"
"Ja, Madame; sie ist zu krank, um auszugehen."
Während dieses Gesprächs sah die vermeintlich Kranke im Glas die Gestalt einer Dame, die sich mit Clotilde unterhielt und zweifelsohne zu den höheren Rängen gehörte. Dann sah sie, wie diese sich umdrehte und zu jemandem hinter ihr sagte: "Wir können reingehen - es ist hier."
Und die beiden Damen, die wir zuvor gesehen haben, wie sie nach dem Weg fragten, machten sich bereit, den Raum zu betreten.
"Wen soll ich der Gräfin ankündigen?", sagte Clotilde.
"Kündigen Sie eine Schwester der Nächstenliebe an", sagte die ältere Dame.
"Aus Paris?"
"Nein; aus Versailles."
Clotilde betrat das Zimmer, und die Fremden folgten ihr.
Jeanne de Valois schien sich nur mit Mühe von ihrem Platz zu erheben, um ihre Besucher zu empfangen.
Clotilde stellte ihnen Stühle hin und zog sich dann widerwillig zurück.
3. Kapitel: Jeanne de La Motte Valois.
Der erste Gedanke von Jeanne de la Motte war, die Gesichter ihrer Besucher zu untersuchen, um so viel wie möglich über deren Charakter zu erfahren. Die ältere Dame, die, wie gesagt, etwa zweiunddreißig Jahre alt gewesen sein mochte, war bemerkenswert schön, wenn auch auf den ersten Blick ein großer Hauteur den Charme ihres Ausdrucks ein wenig schmälerte; ihre Haltung war so stolz und ihre ganze Erscheinung so distingué, dass Jeanne selbst bei einem flüchtigen Blick nicht an ihrem Adel zweifeln konnte.
Sie schien sich jedoch absichtlich so weit wie möglich vom Licht entfernt zu platzieren, um wenig gesehen zu werden.
Ihre Begleiterin schien vier oder fünf Jahre jünger und war nicht weniger schön. Ihr Teint war bezaubernd; ihr Haar, das von den Schläfen zurückgezogen war, brachte das perfekte Oval ihres Gesichts zur Geltung; zwei große blaue Augen, ruhig und gelassen; ein wohlgeformter Mund, der auf eine große Offenheit des Gemüts schließen ließ; eine Nase, die der Venus von Medici Konkurrenz machte; so sah das andere Gesicht aus, das sich dem Blick von Jeanne de Valois darbot.
Sie erkundigte sich sanft, welchem glücklichen Umstand sie die Ehre ihres Besuchs verdankte.
Die ältere Dame gab der jüngeren ein Zeichen, die daraufhin sagte: "Madame, denn ich glaube, Sie sind verheiratet -"
"Ich habe die Ehre, die Frau von M. le Comte de la Motte zu sein, einem ausgezeichneten Gentleman."
"Nun, Madame la Comtesse, wir stehen an der Spitze einer wohltätigen Einrichtung und haben über Ihren Zustand Dinge gehört, die uns interessieren, und wir wünschten daher, genauere Angaben zu diesem Thema zu erhalten."
"Mesdames", erwiderte Jeanne, "Sie sehen dort das Porträt Heinrichs III. das heißt, des Bruders meines Großvaters, denn ich stamme wirklich aus dem Geschlecht der Valois, wie man Ihnen zweifellos gesagt hat." Und sie wartete auf die nächste Frage, wobei sie ihre Besucher mit einer Art stolzer Demut ansah.
"Madame", sagte die ernste und süße Stimme der älteren Dame, "ist es wahr, wie wir auch gehört haben, dass Ihre Mutter Haushälterin in einem Ort namens Fontelle war, in der Nähe von Bar-sur-Seine?"
Jeanne verfärbte sich bei dieser Frage, antwortete aber: "Es ist wahr, Madame; und", fuhr sie fort, "da Marie Jossel, meine Mutter, von seltener Schönheit war, verliebte sich mein Vater in sie und heiratete sie, denn von meinem Vater stamme ich adelig ab; er war ein St. Rémy de Valois, direkter Nachkomme der Valois, die auf dem Thron waren."
"Aber wie sind Sie zu diesem Grad der Armut gekommen, Madame?"
"Ach! Das ist leicht gesagt. Ihr wisst nicht, dass nach der Thronbesteigung Heinrichs IV., durch die die Krone vom Hause Valois auf das Haus Bourbon überging, noch viele Zweige der gefallenen Familie übriggeblieben sind, obskur, zweifellos, aber unbestreitbar derselben Wurzel entsprungen wie die vier Brüder, die alle so elendig zugrunde gingen."
Die beiden Damen machten ein Zeichen des Einverständnisses.
"Dann", fuhr Jeanne fort, "änderten diese Überreste der Valois, die trotz ihrer Unklarheit fürchteten, der herrschenden Familie unangenehm zu sein, ihren Namen von Valois in den von St. Rémy. Rémy, den sie von irgendeinem Besitz übernommen hatten, und unter diesem Namen lassen sie sich bis zu meinem Vater zurückverfolgen, der, als er die Monarchie so fest etabliert und den alten Zweig vergessen sah, dachte, er brauche sich seines illustren Namens nicht länger zu berauben, und sich wieder Valois nannte, welchen Namen er in Armut und Obskurität in einer fernen Provinz trug, während niemand am französischen Hof auch nur von der Existenz dieses Nachkommens seiner alten Könige wusste."
Jeanne hielt bei diesen Worten inne, die sie mit einer Schlichtheit und Milde gesprochen hatte, die einen wohlwollenden Eindruck machte.
"Sie haben zweifellos Ihre Beweise schon zusammengestellt, Madame", sagte die ältere Dame mit Freundlichkeit.
"Oh, Madame", erwiderte sie mit einem bitteren Lächeln, "an Beweisen fehlt es nicht - mein Vater hat sie arrangiert und sie mir als sein einziges Vermächtnis hinterlassen; aber was nützen Beweise für eine Wahrheit, die niemand anerkennen wird?"
"Ihr Vater ist also tot?" fragte die jüngere Dame.
"Ach! ja."
"Ist er in der Provinz gestorben?"
"Nein, Madame."
"Also in Paris?"
"Ja."
"In diesem Zimmer?"
"Nein, Madame; mein Vater, Baron de Valois, Großneffe des Königs Heinrich III., starb an Elend und Hunger; und nicht einmal in diesem armseligen Refugium, nicht in seinem eigenen Bett, so arm das auch war. Nein; mein Vater starb Seite an Seite mit den leidenden Elenden im Hôtel Dieu!"
Die Damen stießen einen Ausruf des Erstaunens und der Verzweiflung aus.
"Nach dem, was Sie mir erzählen, Madame, haben Sie, wie man sieht, großes Unglück erlebt; vor allem den Tod Ihres Vaters."
"Oh, wenn Sie die ganze Geschichte meines Lebens hören würden, Madame, würden Sie sehen, dass der Tod meines Vaters nicht zu den größten Unglücksfällen zählt."
"Wie, Madame! Sie betrachten den Tod Ihres Vaters als ein geringes Übel?" sagte die ältere Dame mit einem Stirnrunzeln.
"Ja, Madame; und damit spreche ich nur als fromme Tochter, denn mein Vater wurde dadurch von allen Übeln erlöst, die er in diesem Leben erfahren hat und die seine Familie noch immer heimsuchen. Inmitten der Trauer, die mir sein Tod bereitet, empfinde ich eine gewisse Freude, weil ich weiß, dass der Nachkomme von Königen nicht mehr um sein Brot betteln muss."
"Um sein Brot zu betteln?"
"Ja, Madame; ich sage es ohne Scham, denn an all unserem Unglück trugen weder mein Vater noch ich selbst die Schuld."
"Aber Sie sprechen nicht von Ihrer Mutter?"
"Nun, mit derselben Freimütigkeit, mit der ich Ihnen soeben sagte, dass ich Gott segne, dass er mir meinen Vater genommen hat, klage ich darüber, dass er mir meine Mutter gelassen hat."
Die beiden Damen sahen sich an und erschauderten fast über diese seltsamen Worte.
"Wäre es indiskret, Madame, Sie um eine genauere Schilderung Ihres Unglücks zu bitten?"
"Die Indiskretion, Madame, läge bei mir, wenn ich Sie mit einem so langen Katalog von Leiden ermüden würde."
"Sprechen Sie, Madame", sagte die ältere Dame so gebieterisch, dass ihre Begleiterin sie ansah, als wolle sie sie ermahnen, vorsichtiger zu sein. In der Tat war Madame de la Motte von diesem gebieterischen Akzent überrascht worden und starrte sie mit einigem Erstaunen an.
"Ich höre, Madame", sagte sie dann in einem sanfteren Ton; "wenn Sie so gut sein werden, uns mitzuteilen, was wir verlangen."
Ihre Begleiterin sah, wie sie beim Sprechen zitterte, und weil sie fürchtete, ihr sei kalt, schob sie ihr einen Teppich zu, auf den sie ihre Füße stellen konnte und den sie unter einem der Stühle entdeckt hatte.
"Behalte ihn selbst, meine Schwester", sagte sie und schob ihn wieder zurück. "Du bist zarter als ich."
"In der Tat, Madame", sagte Jeanne, "es tut mir sehr weh, Sie unter der Kälte leiden zu sehen; aber Holz ist jetzt so teuer, und mein Vorrat war vor einer Woche erschöpft."
"Sie sagten, Madame, Sie seien unglücklich, eine Mutter zu haben", sagte die ältere Dame, um zum Thema zurückzukehren.
"Ja, Madame. Zweifellos schockiert Sie eine solche Blasphemie sehr, nicht wahr?" sagte Jeanne; "aber hören Sie meine Erklärung. Ich hatte bereits die Ehre, Ihnen zu sagen, dass mein Vater eine Mésalliance machte und seine Haushälterin heiratete. Marie Jossel, meine Mutter, begann, anstatt sich über die Ehre, die er ihr erwiesen hatte, zu freuen und stolz darauf zu sein, meinen Vater zu ruinieren, was einer Person, die nur auf ihr eigenes Vergnügen bedacht war, sicher nicht schwer fiel. Und nachdem sie ihn dazu gebracht hatte, seinen ganzen verbliebenen Besitz zu verkaufen, veranlasste sie ihn, nach Paris zu gehen, um die Rechte einzufordern, die ihm sein Name zugestand. Mein Vater ließ sich leicht überreden; vielleicht hoffte er auf die Gerechtigkeit des Königs. Er kam also, nachdem er zuvor alles, was er besaß, zu Geld gemacht hatte. Er hatte außer mir noch eine Tochter und einen Sohn.
"Sein Sohn, unglücklich wie ich, vegetiert in den untersten Rängen der Armee; die Tochter, meine arme Schwester, wurde am Abend unserer Abreise vor dem Haus eines benachbarten Bauern ausgesetzt.
"Die Reise erschöpfte unsere geringen Mittel - mein Vater verausgabte sich in fruchtlosen Bitten - wir sahen ihn kaum - unser Haus war elend - und meine Mutter, der ein Opfer nötig war, ließ ihre Unzufriedenheit und schlechte Laune an mir aus: sie warf mir sogar vor, was ich aß, und für den geringsten Fehler wurde ich unbarmherzig geschlagen. Die Nachbarn, die mir zu dienen gedachten, erzählten meinem Vater von der Behandlung, die ich erfuhr. Er bemühte sich, mich zu schützen, aber seine Einmischung diente nur dazu, sie noch mehr gegen mich zu verbittern.
"Schließlich erkrankte mein Vater und wurde erst im Haus und dann in seinem Bett eingeschlossen. Meine Mutter verbannte mich aus seinem Zimmer unter dem Vorwand, dass ich ihn störe. Sie ließ mich nun einen Satz lernen, den ich, Kind wie ich war, nicht auszusprechen wagte; aber sie trieb mich mit Schlägen auf die Straße hinaus und befahl mir, ihn jedem Vorübergehenden zu wiederholen, wenn ich nicht zu Tode geprügelt werden wolle."
"Und wie lautete dieser Satz?", fragte die ältere Dame.
"Es war dieser, Madame: 'Habt Mitleid mit einem kleinen Waisenkind, das in direkter Linie von Henri de Valois abstammt.'"
"Welch eine Schande!", riefen die Damen.
"Aber welche Wirkung hatte das auf das Volk?", erkundigte sich Andrée.
"Einige hörten zu und hatten Mitleid mit mir, andere waren zornig und drohten mir; einige freundliche Leute blieben stehen und warnten mich, dass ich eine große Gefahr einginge, wenn ich solche Worte wiederholte; aber ich kannte keine andere Gefahr als die, meiner Mutter nicht zu gehorchen. Das Ergebnis war jedoch so, wie sie gehofft hatte: Ich brachte in der Regel ein wenig Geld nach Hause, was uns eine Zeitlang vor dem Verhungern oder dem Krankenhaus bewahrte; aber dieses Leben wurde mir so verhasst, dass ich schließlich eines Tages, statt meinen gewohnten Satz zu wiederholen, die ganze Zeit auf einer Türschwelle saß und abends mit leeren Händen zurückkehrte. Meine Mutter schlug mich so, dass ich am nächsten Tag krank wurde; dann musste mein armer Vater, aller Mittel beraubt, ins Hôtel Dieu gehen, wo er starb."
"Oh! Was für eine schreckliche Geschichte", riefen die Damen.
"Was wurde aus dir nach dem Tod deines Vaters?", fragte die ältere Dame.
"Gott hatte Erbarmen mit mir, einen Monat nach dem Tod meines Vaters lief meine Mutter mit einem Soldaten davon und ließ meinen Bruder und mich im Stich. Wir fühlten uns durch ihren Weggang erleichtert und lebten von öffentlichen Almosen, obwohl wir nie um mehr als genug zu essen bettelten. Eines Tages sah ich eine Kutsche, die langsam den Faubourg Saint Marcel entlangfuhr. Dahinter waren vier Lakaien, und eine schöne Dame saß darin; ich hielt ihr meine Hand zum Almosen hin. Sie fragte mich aus, und meine Antwort und mein Name schienen sie zu verwundern. Sie fragte nach meiner Adresse und erkundigte sich am nächsten Tag, und da sie herausfand, dass ich ihr die Wahrheit gesagt hatte, nahm sie sich meines Bruders und meiner selbst an; sie versetzte meinen Bruder in die Armee und mich zu einer Schneiderin."
"War diese Dame nicht Madame de Boulainvilliers?"
"Das war sie."
"Sie ist tot, glaube ich?"
"Ja; und ihr Tod hat mich meines einzigen Beschützers beraubt."
"Ihr Mann lebt noch und ist reich."
"Ah, Madame, ihm verdanke ich mein späteres Unglück. Ich war groß geworden und, wie er fand, hübsch, und er wollte einen Preis für seine Vorteile, den ich nicht zahlen wollte. In der Zwischenzeit starb Madame de Boulainvilliers, die mich zuerst mit einem tapferen und treuen Soldaten, M. de la Motte, verheiratet hatte, aber von ihm getrennt, schien ich nach ihrem Tod noch verlassener zu sein, als ich es nach dem Tod meines Vaters gewesen war. Dies ist meine Geschichte, Madame, die ich so weit wie möglich abgekürzt habe, um Sie nicht zu ermüden."
"Wo ist denn Ihr Mann?", fragte die ältere Dame.
"Er ist in der Garnison in Bar-sur-Aube; er dient in der Gendarmerie und wartet, wie ich, in der Hoffnung auf bessere Zeiten."
"Aber Sie haben Ihren Fall vor Gericht gebracht?"
"Zweifelsohne."
"Der Name Valois muss doch einige Sympathien geweckt haben."
"Ich weiß nicht, Madame, welche Gefühle er geweckt haben mag, denn ich habe keine Antwort auf meine Bitten erhalten."
"Ihr habt weder die Minister, den König, noch die Königin gesehen?"
"Niemanden. Überall habe ich versagt."
"Sie können jetzt aber nicht betteln."
"Nein, Madame; ich habe die Gewohnheit verloren; aber ich kann vor Hunger sterben, wie mein armer Vater."
"Sie haben kein Kind?"
"Nein, Madame; und mein Mann wird, indem er im Dienste seines Königs getötet wird, für sich selbst ein glorreiches Ende all unseres Elends finden."
"Können Sie, Madame - ich bitte um Verzeihung, wenn ich aufdringlich erscheine -, aber können Sie die Beweise für Ihre Abstammung vorlegen?"
Jeanne erhob sich, öffnete eine Schublade und zog einige Papiere heraus, die sie der Dame überreichte, die sich erhob, um näher ans Licht zu kommen, damit sie sie untersuchen konnte; aber als sie sah, dass Jeanne diese Gelegenheit eifrig nutzte, um sie deutlicher zu beobachten, als sie es bisher vermocht hatte, wandte sie sich ab, als ob das Licht ihren Augen weh täte, und drehte Madame de la Motte den Rücken zu.
"Aber", sagte sie schließlich, "das sind doch nur Kopien."
"Oh! Madame, ich habe die Originale sicher und bin bereit, sie vorzulegen."
"Wenn sich ein wichtiger Anlass ergibt, nehme ich an?", sagte die Dame lächelnd.
"Es ist zweifellos ein wichtiger Anlass, Madame, der mir die Ehre Ihres Besuchs verschafft, aber diese Papiere sind so kostbar..."
"Dass Sie sie nicht dem erstbesten Besucher zeigen können. Ich habe Sie verstanden."
"Oh, Madame!" rief die Gräfin; "Sie sollen sie sehen", und sie öffnete eine geheime Schublade über der anderen und zog die Originale heraus, die sorgfältig in eine alte Mappe eingeschlossen waren, auf der das Wappen der Valois stand.
Die Dame nahm sie an sich und sagte, nachdem sie sie geprüft hatte: "Sie haben recht; diese sind vollkommen zufriedenstellend, und Sie müssen sich bereithalten, sie vorzulegen, wenn sie von der zuständigen Behörde verlangt werden."
"Und was, glauben Sie, darf ich erwarten, Madame?", fragte Jeanne.
"Zweifellos eine Pension für Sie und eine Beförderung für M. de la Motte, wenn er sich dessen würdig erweist."
"Mein Mann ist ein ehrenwerter Mann, Madame, und hat seine militärischen Pflichten nie vernachlässigt."
"Es ist genug, Madame", sagte die Dame und zog ihre Kapuze noch mehr über ihr Gesicht. Dann griff sie in ihre Tasche und holte zuerst dasselbe bestickte Taschentuch heraus, mit dem sie zuvor im Schlitten ihr Gesicht verbarg, dann eine kleine Rolle von etwa einem Zoll Durchmesser und drei oder vier Zentimetern Länge, die sie auf den Chiffon legte und sagte: "Der Schatzmeister unseres Wohltätigkeitsvereins ermächtigt mich, Madame, Ihnen diese kleine Hilfe zu gewähren, bis Sie etwas Besseres erhalten."
Madame de la Motte warf einen raschen Blick auf das kleine Brötchen. "Drei-Franc-Stücke", dachte sie, "und es müssen fast hundert sein; was für eine Wohltat des Himmels."
Während sie so dachte, gingen die beiden Damen schnell in das Vorzimmer, wo Clotilde in ihrem Sessel eingeschlafen war.
Die Kerze in der Steckdose brannte aus, und der Geruch, der von ihr ausging, veranlasste die Damen, ihre Riechfläschchen zu zücken. Jeanne weckte Clotilde, die darauf bestand, ihnen mit dem widerwärtigen Kerzenstummel zu folgen.
"Au revoir, Madame la Comtesse", sagten sie.
"Wo darf ich die Ehre haben, mich bei Ihnen zu bedanken?", fragte Jeanne.
"Wir werden es Sie wissen lassen", antwortete die ältere Dame und ging schnell die Treppe hinunter.
Madame de la Motte lief zurück in ihr Zimmer, ungeduldig, um ihr Rouleau zu untersuchen, aber ihr Fuß stieß gegen etwas, und als sie sich bückte, um es aufzuheben, sah sie ein kleines flaches Goldkästchen.
Es dauerte eine Weile, bis sie es öffnen konnte, aber nachdem sie endlich die Feder gefunden hatte, flog es auf und enthüllte das Porträt einer Dame, die keine geringe Schönheit besaß. Die Frisur war deutsch, und sie trug einen Kragen wie einen Orden. Ein M und ein T, umgeben von einem Lorbeerkranz, schmückten die Innenseite der Schachtel. Madame de la Motte zweifelte aufgrund der Ähnlichkeit des Porträts mit der Dame, die sie gerade verlassen hatte, nicht daran, dass es das ihrer Mutter oder einer nahen Verwandten war.
Sie lief zur Treppe, um es ihnen zurückzugeben; als sie aber die Haustür schließen hörte, lief sie zurück und wollte sie vom Fenster aus rufen, kam aber gerade noch rechtzeitig an, um ein Cabriolet schnell wegfahren zu sehen. Sie war daher gezwungen, die Schachtel vorläufig zu behalten, und wandte sich wieder dem kleinen Rouleau zu.
Als sie es öffnete, stieß sie einen Freudenschrei aus: "Doppellouis, fünfzig Doppellouis, zweitausendvierhundert Francs!" und ergriffen von dem Anblick von mehr Gold, als sie je in ihrem Leben gesehen hatte, blieb sie mit gefalteten Händen und offenen Lippen stehen. "Hundert Louis", wiederholte sie; "diese Damen sind dann sehr reich. Oh! Ich werde sie wiederfinden."