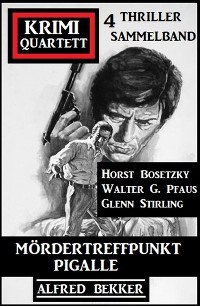Kitabı oku: «Mördertreffpunkt Pigalle: Krimi Quartett 4 Thriller», sayfa 4
7. Kapitel
Als ich nach Hause kam, stand die Wohnungstür weit offen, und im Haus wurden Möbel gerückt. Luise war wieder einmal am Umstellen. Sie konnte die Möbel kein halbes Jahr an einem Platz stehen lassen, und ich ärgerte mich jedes Mal wenn ich nach Hause kam und mein Sessel zeigte in eine andere Richtung.
Aber es war Luises Lieblingsbeschäftigung, und es war zugleich ihre einzige Beschäftigung. Sie hatte sonst nichts zu tun und wusste alleine auch nichts mit sich anzufangen. Also ließ ich ihr die kleine Freude und machte meinem Ärger nur dann ein wenig Luft, wenn das Möbelrücken länger als eine Woche dauerte.
Meistens fand die Möbelaktion dann statt, wenn ich gerade zu Hause war. Nur sehr selten hatte sie ihre Aktivitäten in einer Woche entwickelt, in der ich gerade auf Reisen war. Ich hatte mich schon oft gefragt, warum sie das tat, und ich hatte nur eine plausible Antwort darauf gefunden: Luise wollte mir zeigen, dass ihre Tage mit Arbeit ausgefüllt waren und dass sie gar keine Zeit hatte, sich auf die faule Haut zu legen und Däumchen zu drehen. Dabei war es mir völlig egal, was sie den ganzen Tag über trieb. Von mir aus konnte sie den ganzen Tag im Bett verbringen, allein oder mit einem Liebhaber. Es wäre mir gleich gewesen. Sie hätte tun und lassen können, was sie wollte. Aber Luise tat nichts. Sie blieb brav zu Hause, legte sich bei schönem Wetter in die Sonne, badete im Swimmingpool und brachte bei schlechtem Wetter das Haus auf Hochglanz. Und da in unseren Breitengraden das Wetter fast immer schlecht ist, hatten wir das sauberste Haus in der ganzen Stadt.
Aber ich wollte kein schönes sauberes Haus, und erst recht keinen Putzteufel als Ehefrau. Ich wollte eine attraktive Frau, um die mich alle Männer beneideten, und ich wollte eines Tages die Firma ganz allein für mich haben. Doch solange ich Luise am Hals hängen hatte, kam ich weder zu einer attraktiven Ehefrau, noch zur Alleinherrschaft in der Firma. Solange der Alte am Leben war, saß ich auf dem Schleudersitz. Wenn ich mir nur das Geringste zu Schulden kommen lasse, kann er mich von heute auf morgen auf die Straße setzen.
Und diesen Zustand musste ich ändern. Ich hatte mir alles genau überlegt. Seit Luise mir von den Schulden und Plänen des Malers erzählt hatte, war mir die Idee nicht mehr aus dem Kopf gegangen, und je länger ich darüber nachgedacht hatte, desto sicherer erschien mir der Plan. Es konnte einfach nichts dabei schief gehen. Dass Pawelka mir dann über den Weg gelaufen war, konnte ich nicht vorausahnen. Er könnte mir tatsächlich gefährlich werden. Und deshalb musste er für immer zum Schweigen gebracht werden.
Ich war sicher, dass ich für ihn den richtigen Köder ausgeworfen hatte. Was ich jetzt noch brauchte, waren eiserne Nerven und eine gehörige Portion Kaltblütigkeit. Dass ich beides besaß, hatte ich in anderen Situationen oft genug bewiesen. Pawelka war nur ein kleines Hindernis auf meinem Weg nach oben. Heute Abend würde ich es aus dem Weg räumen, und dann konnte mich nichts mehr aufhalten. In weniger als acht Wochen gehörte mir die Firma ganz allein, und ich konnte endlich etwas daraus machen.
Ich trat in den Korridor, zog meine Schuhe aus und schlüpfte in meine Pantoffeln. Luise mochte es nicht, wenn man mit Straßenschuhen ihre Wohnung betrag. Das war schon immer so bei den Grashofers gewesen, und ich hatte mich widerspruchslos dem Beispiel ihres Vaters angeschlossen. Aber ich hasste es, meine Schuhe ausziehen zu müssen, bevor ich ins Haus ging. Es war erniedrigend und hatte einen Hauch von Pantoffelheld. Aber lange hatte ich das ja nicht mehr zu erdulden. Luise würde bald tot sein, und ich konnte tun und lassen was ich wollte, und niemand konnte mir noch irgendwelche Vorschriften machen.
Luise war gerade beim Probesitzen. Sie hatte die Couchgarnitur umgestellt und testete nun von ihrem Sessel aus den Blick auf den Fernseher. Sie verbrachte die Abende fast ausschließlich vor dem Fernseher, und die wenigen Abende, die ich im Jahr zu Hause war, verbrachten wir dann zu zweit davor. Mit Luise auszugehen, hatte ich längst aufgegeben. Ich hatte es satt, immer blöd angeklotzt zu werden. Die Blicke der Leute hatten vom Mitleid über Verständnislosigkeit bis zum Hohn gereicht, und ich hatte es einfach nicht mehr ertragen können. Also war ich entweder allein ausgegangen, oder ich war zu Hause geblieben. Mit Luise hatte ich mich nur noch in der Öffentlichkeit sehen lassen, wenn es unumgänglich war.
Als Luise mich im Türrahmen stehen sah, sprang sie mit einem strahlenden Lächeln auf.
„Du bist heute schon da?“, fragte sie.
Aber da war ein falscher Ton in ihrer Stimme. Luise war eine schlechte Schauspielerin. Ich merkte sofort, dass ihr Vater angerufen hatte. Aber ich ließ mir nichts anmerken. Ich lächelte und sagte: „Mir ist heute ein Zahn ausgefallen, und ich möchte mich so nicht im Büro zeigen. Es sieht schrecklich aus.“
„Ach, du Armer. Wie ist denn das passiert?“
Ich erzählte es ihr, obwohl mir klar war, dass sie es längst wusste. Ihr Vater hatte sie bestimmt angerufen und ihr von meinem Missgeschick berichtet, und sicher hatte er wieder schallend darüber gelacht.
Luise lachte nicht. Sie heuchelte Mitleid. Vielleicht war es auch echtes Mitgefühl; ich weiß es nicht. Aber was immer es auch war, ich hasste es. Ich hasste ihre Mitleidtour, wenn ich abends müde nach Hause kam, und ich hasste ihre mütterliche Tour, die sie am liebsten abzog.
Sie glaubte ständig, mich bemuttern zu müssen. Sie legte mir jeden Morgen ein frisches Hemd, frische Unterwäsche und einen Anzug in den Ankleideraum. Aber sie bewies dabei so viel Geschmack wie eine Kuh. Meistens passten die Krawatte nicht zum Hemd und das Hemd nicht zum Anzug. Kam ich zum Frühstück, lagen zwei aufgeschnittene Brötchen neben meiner Kaffeetasse. Beide Brötchen waren mit Butter und Marmelade bestrichen. Dabei wusste sie genau, dass ich immer nur ein Brötchen aß. Und ich mochte auch keine weichgekochten Eier, aber jeden Morgen stand ein weichgekochtes Ei an meinem Platz.
Am Anfang unserer Ehe sagte ich ihr ein paar Mal, dass ich morgens nur ein Brötchen wollte und kein weichgekochtes Ei. Aber genauso gut hätte ich an eine Wand reden können. Sie lächelte mich immer nur verständnisvoll an, und beim nächsten Mal stand wieder dasselbe auf meinem Frühstückstisch. Sie wollte einfach nicht glauben, dass ich nicht wie ihr Vater war.
Ihr Vater aß jeden Morgen zwei Brötchen mit Marmelade und dazu ein weichgekochtes Ei. Nach dem Tode ihrer Mutter, die vor elf Jahren an einer Blutkrankheit gestorben war, hatte sie ihrem Vater jeden Morgen das Frühstück gerichtet. Als wir heirateten, zogen wir in dieses herrliche Haus auf dem Eselsberg, und sie machte mir das Frühstück. Vielleicht hätte ich ihr öfter sagen sollen, dass ich nicht wie ihr Vater war. Möglich, dass es etwas genützt hätte, aber ich bezweifelte es.
Luise rückte den Sessel ein Stück nach rechts und fragte, ohne mich dabei anzusehen: „Bist du gleich nach dem Essen nach Hause gefahren?“
Nun sieh dir dieses Luder an, dachte ich verblüfft. Sie will mich testen. Sicher hat ihr Vater gesagt, ich käme jeden Moment nach Hause. Aber inzwischen sind fast zwei Stunden vergangen, und sie möchte wissen, wo ich war.
Ich hatte zuerst eine heftige Erwiderung auf der Zunge. Aber ich schluckte sie hinunter, setzte mich in meinen Sessel, lehnte den Kopf zurück und sagte geduldig: „Nein, ich bin nicht gleich nach Hause gekommen. Ich habe erst noch Vater in die Firma gefahren. Danach habe ich meinen Zahnarzt angerufen. Aber er hatte heute keine Zeit mehr, und da bin ich noch auf einen Sprung zu „Erika“ gefahren und habe zwei Bier und zwei Schnäpse getrunken.“
„Zur Erika“ ist eine nette kleine Kneipe in der Nähe des Bahnhofs. Ich hatte Luise einmal dorthin mitgenommen, und es hatte ihr sehr gut gefallen.
Luise nickte nur und sagte nichts mehr. Als die Möbel endlich so standen, wie sie wollte, setzte sie sich zu mir auf die Lehne und legte den Arm um meine Schultern. Ich wusste, dass sie jetzt mit mir schlafen wollte, und ich tat, als wäre ich hundemüde.
Ich hasste Luises Zärtlichkeiten. Alles was sie machte, wirkte plump und ungeschickt, und sie verzog dabei das Gesicht zu einem idiotischen Grinsen.
Um meine Ruhe zu haben, nahm ich sie manchmal schnell, und sie machte danach meistens einen sehr befriedigten Eindruck, und ich wunderte mich darüber sehr, weil sie doch gar nichts davon gehabt haben konnte. Aber Luise war eben nicht mit normalen Maßstäben zu messen.
An diesem Tag stoppte ich Luises Zärtlichkeiten, bevor sie richtig damit angefangen hatte. „Bitte, Luise, lass mich in Ruhe. Ich bin heute nicht in Stimmung.“
Sofort zog Luise die Hand zurück und erhob sich. Sie strich ihren Rock zurecht, und ich sah, dass sie einen roten Kopf hatte. Ohne ein Wort über die Abfuhr zu verlieren, wandte sie sich um und sagte: „Soll ich dir einen Drink machen?“
„Ja, sei so lieb.“
Sie ging auf ihren krummen, dicken Beinen zur Bar, und ich sah ihr unter halbgeschlossenen Augenlidern zu, wie sie umständlich Eiswürfel in ein Glas gab und es bis zur Hälfte mit Scotch füllte.
Luise hatte ein rundes, hässliches Vollmondgesicht, aus dem ihre lange, spitze Nase wie ein Warnzeichen hervorstach. Ihre Augen waren grau, und ihre Lippen waren so dünn wie Streichhölzer. Sie hatte ein Doppelkinn und kleine muschelartige Ohren, und ihr kurzgeschnittenes, dunkelblondes Haar, das wie ausgefranst wirkte, gab ihrem Gesicht einen dümmlichen Ausdruck.
Als wir vor vier Jahren heirateten, trug sie das Haar schulterlang, was ihr Aussehen einigermaßen erträglich gemacht hatte. Zwei Monate nach der Hochzeit ließ sie sich das Haar ganz kurz schneiden, und ihr Vater fand das auch noch schön. Ich fand es grauenhaft. Aber ich sagte es ihr nicht. Ich behielt es für mich, und ich hasste sie von Tag zu Tag ein bisschen mehr.
Luise war nicht nur dumm und plump und unansehnlich, sondern obendrein auch noch geradezu widerlich anhänglich und irgendwie selbstsicher. Außerdem war sie, was sie selbst betraf, schlampig und nachlässig geworden. Sie lief den ganzen Tag mit einer bunten Kleiderschürze herum, schminkte sich nicht mehr, was sie früher mit großer Sorgfalt getan hatte, und wurde von Tag zu Tag dicker.
Ich hasste diese Frau, wie ich kaum einen Menschen hasste, und ich sehnte den Tag herbei, an dem ich sie mir für immer vom Hals schaffen konnte. Und der Tag war nicht mehr fern. Bald würde ich sie für immer los sein.
Luise brachte mir meinen Scotch und für sich selbst hatte sie Orangensaft eingeschenkt. Sie trank nur selten Alkohol, und ich war sehr froh darüber, denn sie vertrug nicht sehr viel, und wenn sie angeheitert war, wurde sie läppisch und wollte immer nur Sex.
Wir tranken eine Weile schweigend, und ich legte den Kopf zurück und schloss die Augen, um sie nicht ansehen zu müssen. Ich konnte ihren Anblick kaum noch ertragen.
Nach einer Weile sagte sie: „Du solltest dir eine bessere Prothese machen lassen.“
„Ja, ich weiß. Hat mir Sterzel auch schon ein paar Mal gesagt.“
„Und? Wirst du es tun?“
„Ich denke schon. Ich möchte so was nicht noch mal erleben. Es war sehr peinlich.“
„Was wird das kosten?“
„Zwölftausend.“
„Was, so viel?“
„Guter Zahnersatz ist heute sehr teuer“, sagte ich müde.
„Aber zwölftausend Euro …“
„Ich denke doch, dass ich mir das leisten kann“, sagte ich scharf. Ich richtete mich steil im Sessel auf und sah sie wütend an. Das hatte mir gerade noch gefehlt. „Seit vier Jahren rackere ich mich für die Firma ab. Ich schufte tagaus tagein, bin fast das ganze Jahr über auf Achse, fahre vom Norden in den Süden und vom Süden in den Norden, schließe Verträge ab, renne auf Ausstellungen herum, handle die Preise aus und bringe Aufträge in Hülle und Fülle nach Hause. Die Firma lebt nur noch von meinen Aufträgen. Und sie lebt gut davon. Die Firma ist in den letzten vier Jahren enorm gewachsen, und der Gewinn ist auch gestiegen. Es ist mein Verdienst, dass die Firma gewachsen ist, und es ist mein Verdienst, dass wir höhere Gewinne erzielen. Aber was gönne ich mir? Nichts, rein gar nichts! Nicht das kleinste Vergnügen. Ich habe nicht einmal ein Hobby. Ich nehme auch nie Geld aus dem Betrieb, obwohl mir das zustehen würde. Ich nehme nur das, was wir zum Leben brauchen. Und was ich auf meinen Reisen ausgebe, sind Spesen, die wieder von der Steuer abgesetzt werden können. Ich gönne mir nichts, und jetzt kommst du und hältst mir die zwölftausend Euro vor …“
„Ich halte sie die nicht vor“, verteidigte sie sich. „Ich meinte nur allgemein …“
„Nein“, widersprach ich, weil ich gerade so schön in Fahrt war. „Das war auf mich gezielt. Zwölftausend Euro sind dir zu viel für meine Zähne. Das bin ich wohl nicht wert?“
„Aber das ist doch Unsinn“, verteidigte Luise sich und bekam einen roten Kopf. „Du kannst dir die Zähne machen lassen und wenn sie zwanzigtausend kosten würden. Ich meinte damit doch nur allgemein, dass die Zahnärzte heutzutage eine Menge Geld für so ein paar Zähne verlangen …“
Sie ließ den Satz unbeendet und blickte zu Boden. Ich tat so, als wäre ich immer noch skeptisch, weil die Gelegenheit gerade günstig war, und ich noch etwas anbringen wollte. „Also ich weiß nicht … Mir klang das ganz so, als würdest du mir das neue Gebiss, das ich noch gar nicht habe, nicht gönnen, weil dir das Geld leidtut. Dabei mache ich doch alles für dich, deinen Vater und die Firma. Ich arbeite Tag und Nacht und schufte wie ein Berserker. Ich habe mir in den letzten vier Jahren genau zehn Tage Urlaub gegönnt, und wenn ich mal zu Hause bin, muss ich abends auch noch mit Vertretern oder Geschäftsfreunden zum Essen gehen. So wie heute Abend auch. Der Juniorchef vom Schöller-Versandhaus in Hamburg ist auf dem Weg nach Ulm. Ich muss ihn um neun Uhr vom Bahnhof abholen, ihn in einem Hotel unterbringen und anschließend mit ihm Essen gehen. Ich mache das nicht zu meinem Vergnügen. Ich würde mich viel lieber hier in den Sessel setzen und mit dir zusammen fernsehen. Aber das geht nicht. Schöller ist ein sehr guter Kunde. Er will sich übermorgen unseren Betrieb ansehen, und wenn ich ein bisschen Glück habe, habe ich am Mittwochabend einen dicken Auftrag in der Tasche. Und das mache ich alles für die Firma, und mich mache ich dabei kaputt.“
Das war nur halb gelogen. Schöller kam nach Ulm, aber erst morgen Abend, und morgen muss ich natürlich wieder mit ihm ausgehen, weil ich ja einen dicken Auftrag von ihm erwarte. Dass ich den Auftrag schon so gut wie in der Tasche hatte, brauchte ich Luise ja nicht auf die Nase zu binden. Sie verstand von Geschäften ohnehin nichts; dazu war sie einfach zu blöd. Und Hans-Georg Grashofer kümmerte sich nur noch um die Fertigung und die Auslieferung und dass sonst alles normal lief. Die Betreuung der Kunden überließ er mir. Das war mein Aufgabengebiet, und er redete mir seit einem Jahr nicht mehr in meine Arbeit rein. Seit er gemerkt hatte, dass ich alles im Griff habe, ließ er mich gewähren und kümmerte sich nicht mehr darum.
„Ich weiß, dass du viel arbeitest“, sagte Luise und setzte sich wieder auf die Sessellehne. „Ich wollte schon längst mal mit dir darüber reden. Papa meint auch, dass du zu viel arbeitest. Du solltest mal eine Weile ausspannen. Du siehst in letzter Zeit nicht gut aus …“
Kaum hatte sie es ausgesprochen, spürte ich auch schon wieder die Stiche in der Brust. Es war nicht sehr schlimm, und ich hatte es nie besonders ernst genommen. Ich nahm es auch jetzt nicht ernst. Ich war einfach ein wenig überarbeitet. Aber das würde sich ab Freitag bestimmt wieder geben. Ich hatte nämlich die Absicht, tatsächlich ein wenig auszuspannen. Aber ohne Luise.
Dass Schöller den Auftrag unterschreiben würde, darüber bestand kein Zweifel. Ich würde anschließend den unterschriebenen Auftrag meinem Schwiegervater vorenthalten und ihm klarmachen, dass ich nun doch noch nach Hamburg fahren müsste, um den Auftrag zu bekommen. Grashofer würde das schlucken, weil es ihm auch schon so ergangen war.
Auf diese Weise würde ich zu vier oder fünf freien Tagen kommen, und die hatte ich dringend nötig. Nicht nur, weil ich gesundheitlich etwas angeschlagen war. Das zählte für mich eigentlich nicht. Für mich zählte nur das Wiedersehen mit Sabine, der Frau meiner Träume. Ihr musste Luise weichen. Sie war es, die ich mir an meiner Seite wünschte.
Sabine würde am Mittwoch nach einem dreimonatigen Aufenthalt in New York wieder nach Hamburg zurückkehren, und ich konnte es kaum erwarten, sie nach so langer Zeit wieder in meine Arme schließen zu können. Nicht zuletzt für sie hatte ich das Risiko auf mich genommen. Ich wollte frei sein – für sie.
Ich atmete ein paar Mal tief durch, und das Stechen in meiner Brust ließ nach.
„Ich bin ein wenig müde, das ist alles“, entgegnete ich. „Ich werde mich jetzt zwei Stunden aufs Ohr legen, dann bin ich wieder okay.“
Luise wollte noch etwas sagen; ich sah es ihr an. Aber als ich mich einfach erhob und ins Schlafzimmer ging, schwieg sie.
Ich legte mich angezogen auf das Bett. Ich versuchte zu schlafen, aber es ging nicht. Ich konnte nicht einschlafen. Ich musste an Pawelka denken und daran, dass ich ihn für immer zum Schweigen bringen musste, und ich stellte zu meiner Verwunderung fest, dass ich nicht die geringsten Skrupel hatte. Ich war nicht aufgeregt. Ich war ganz ruhig.
Niemand würde Pawelka eine Träne nachweinen.
Für mich war Pawelka bereits tot.
8. Kapitel
Zehn Minuten vor neun brach ich auf. Luise saß vor ihrem geliebten Fernseher und sah sich eine Komödie an.
„Wann kommst du nach Hause?“, fragte sie, ohne den Blick vom Bildschirm zu nehmen.
„Ich weiß noch nicht“, antwortete ich wahrheitsgemäß. „Es wird sicher Mitternacht werden.“
Sie nickte nur, und ich ging hinaus zu meinem Wagen …
Punkt neun Uhr bog ich in den Münsterplatz ein. Ich fuhr langsam die Straße entlang und hielt nach Pawelka Ausschau. Es war noch hell, und es waren nur wenige Leute auf dem Münsterplatz.
Pawelka war nicht unter ihnen.
Ich umrundete den Platz einmal, fuhr auf die Neue Straße hinaus und bog über die Kramgasse wieder in den Münsterplatz ein.
Pawelka war wieder nicht da, und ich kochte vor Wut. Zuerst dachte ich, er könnte mich versetzt haben, weil er Verdacht geschöpft hat. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass er schon immer unzuverlässig war. Pawelka war schon damals nie pünktlich gewesen, als wir noch zusammengearbeitet haben.
Ich fuhr also noch ein drittes Mal um den Platz. Diesmal stand er am Ausgang der Hirschstraße und winkte, als er mich kommen sah. Er grinste, und ich grinste zurück. Kurz darauf hielt neben ihm an.
„Du hast dich nicht verändert“, sagte ich. „Du bist wie immer unpünktlich.“
„Ich bin aufgehalten worden“, erwiderte er.
„Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, musst du dich an Pünktlichkeit gewöhnen.“
„Das ist noch nicht raus“, sagte er.
„Was?“
„Dass ich für dich arbeite.“
„Ich werde dich nicht dazu zwingen“, grinste ich. „Man soll niemanden zu seinem Glück zwingen.“
„Ich frage mich, ob es wirklich ein Glück ist“, sagte er zynisch. „Du bist doch ein Schwein. Wer mit dir gemeinsame Sache macht, muss höllisch aufpassen, dass er nicht übers Ohr gehauen wird.“
Ich fuhr rechts ran und hielt an.
„Du kannst sofort aussteigen, wenn du mir nicht traust“, sagte ich scharf. „Ich finde hundert andere für den Job. Ich brauche dich nicht.“
Ich war sicher, dass Pawelka nicht aussteigen würde. Er hatte das große Geld gerochen. Er würde sich zumindest anhören wollen, was ich für einen Job zu vergeben hätte. Und sei es nur, um mich irgendwie in die Hand zu bekommen.
Ich behielt recht. Pawelka stieg nicht aus.
„Was soll das“, fragte er. „Fahr weiter!“
Ich fuhr weiter und bog auf die Autobahn nach Kempten ab.
„Hast du irgendjemandem gesagt, dass du dich mit mir triffst?“, fragte ich ihn beiläufig.
„Natürlich nicht. Für wen hältst du mich?“
Ich zuckte mit den Schultern und schwieg. Ich glaubte ihm. Warum sollte er es jemandem gesagt haben? Dazu bestand kein Anlass. Pawelka vermutete, dass ich ihm ein schmutziges Geschäft vorschlagen würde, und er hoffte sicherlich, mich damit erpressen zu können. Warum sollte er also eine dritte Person einweihen? Er müsste dann damit rechnen, mit der Person teilen zu müssen, und Pawelka war noch nie fürs Teilen gewesen.
Die Autobahn war nur sehr wenig befahren. Langsam brach die Nacht herein, und ich musste die Scheinwerfer einschalten.
Ich schwieg und wartete, Pawelka würde es sicher nicht lange aushalten. Ich sah ihm an, dass er vor Neugier fast platzte.
Wir waren noch keinen Kilometer auf der Autobahn gefahren, als er fragte: „Also, was ist? Was hast du für einen Job?“
„Hast du eine Pistole?“, wollte ich wissen.
„Nein.“
„Dann wirst du dir eine besorgen müssen.“
Er schwieg eine Weile und starrte geradeaus. Dann sagte er: „Ich soll also jemanden umlegen.“
„Ja.“
„Und das traust du mir zu?“
„Warum nicht? Wenn die Kohle stimmt …“
Aus den Augenwinkeln sah ich, wie er mich mit offenem Mund anstarrte.
Ich tat, als müsste ich mich auf die Fahrbahn konzentrieren. Ich blickte nicht ein einziges Mal zu ihm hinüber.
„Was bist du doch für ein kaltschnäuziger Hund“, sagte er endlich. „Du bist noch ein größeres Schwein, als ich angenommen hatte. Ich glaube, in deinen Adern fließt kein Blut, sondern Eiswasser.“
„Es hat dich nicht zu interessieren, welche Flüssigkeit durch meine Adern fließt“, entgegnete ich kalt. „Ich habe dir einen Job angeboten, bei dem du eine Menge Geld machen kannst, und ich möchte von dir nichts weiter, als ein klares Ja oder Nein hören.“
Wir näherten uns der Ausfahrt Senden, ich ging vom Gas und wechselte auf die rechte Fahrspur.
Pawelka fragte: „Weißt du, was du da von mir verlangst?“
„Natürlich.“
„Ich bin doch kein Mörder.“
„Nun tu’ doch nicht so, als wäre der Job neu für dich“, sagte ich und hatte Mühe, mein aufkommendes Lachen zu unterdrücken. „Du hast doch sicher schon eine ganze Menge Leute umgelegt.“
„Du musst komplett verrückt sein“, stöhnte er entsetzt. „Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Menschen umgebracht. Ich habe schon ein paar Villen geknackt; ich habe ein paar Autos gestohlen, und ich war schon bei einem Bankraub dabei. Aber ich habe noch nie auf einen Menschen geschossen. Ich habe ja noch nicht mal eine Pistole.“
Pawelka war ehrlich entrüstet, und ich hätte mich ausschütten können vor Lachen. Er verteidigte sich gegen meine Unterstellung, indem er mir seine Schandtaten verriet. Das erleichterte mir mein Vorhaben. Pawelka war nichts weiter, als ein mieser, kleiner Ganove, auf den die Gesellschaft verzichten konnte. Um ihn war es nicht schade. Ich tat der Menschheit nur einen Gefallen, wenn ich sie von ihm befreite.
„Hör zu, Klaus“, sagte ich und steuerte den Wagen an der Rotisserie vorbei durch Senden. „Ich will von dir keine Geständnisse hören. Ich will auch nicht wissen, ob du schon einmal jemanden umgebracht hat oder nicht. Ich will von dir nur wissen, ob du bei dem Job dabei bist.“
„Aber ich habe wirklich noch nie jemanden umgebracht“, sagte Pawelka todernst. „Das musst du mir glauben, Willi. Ich habe das noch nie getan.“
Er war einfach zu blöd. Aber das hatte ich ja geahnt.
„Na gut“, seufzte ich. „Ich glaube dir, dass du noch nie jemanden umgebracht hast. Aber es gibt immer ein erstes Mal, und ich frage dich noch einmal: Bist du dabei?“
Wir hatten den Ort inzwischen hinter uns, und ich konnte wieder Gas geben.
„Also, ich wusste ja immer, dass du ein kaltblütiger Hund bist“, sagte er. „Aber dass du so eiskalt …“
„Das hast du schon einmal gesagt“, erinnerte ich ihn ärgerlich. „Du brauchst mir meine Eigenschaften nicht aufzuzählen. Gib mir lieber eine Antwort auf meine Frage.“
Er blickte eine Weile geradeaus. Plötzlich wandte er sich ruckartig mir zu.
„Wohin fahren wir eigentlich?“, wollte er wissen. „Senden liegt doch schon hinter uns.“
„Wir fahren zu den Baggerseen hinaus.“
„Aber wozu? Ich dachte, du wolltest in diese Ro… Roterie oder so.“
„Rotisserie.“
„Sag’ ich doch. Warum fahren wir nicht dorthin?“
„Das kommt später“, erklärte ich und bog von der Hauptstraße in eine kleine, unbefestigte Straße ein. „Erst müssen wir uns einig sein.“
„Und wenn wir uns nicht einig werden?“
„Dann fahren wir wieder zurück. Dann gibt es keine Rotisserie.“
„Du bist zum Kotzen, weißt du das?“
Ich sagte nichts. Sollte er sich ruhig austoben. Lange konnte er es ohnehin nicht mehr tun.
Langsam rollte der Wagen über die holprige Straße. Es war inzwischen schon fast ganz dunkel, aber noch nicht dunkel genug. Ich musste noch eine Weile warten.
Wir hatten den ersten See erreicht, und ich hielt unmittelbar am Wasser an und schaltete die Scheinwerfer aus.
„Also was ist? Bist du an dem Job interessiert?“
„Wer soll eigentlich gekillt werden?“, fragte er.
„Man beantwortet eine Frage nicht mit einer Gegenfrage“, belehrte ich ihn.
„Es ist deine Frau, nicht wahr?“
„Warum fragst du, wenn du’s doch schon weißt?“
„Ich wollte es genau wissen.“ Er lehnte sich in die entfernteste Ecke des Wagens und sah mich kopfschüttelnd an. „Was bist du doch für ein Schwein?“
„Du wiederholst dich“, sagte ich kalt.
„Aber du bist eine clevere Sau“, fuhr er unbeirrt fort. „Du bist cleverer, als ich und meine Kumpel zusammen. Wir backen kleine Brötchen. Aber du gibst dich mit so was gar nicht ab. Du gehst aufs Ganze. Ich gehe doch recht in der Annahme, dass der Alte auch dran glauben muss?“
„Natürlich.“
„Lieber Himmel“, flüsterte Pawelka. „Ich habe schon immer gewusst, dass du ein Spinner und ein Angeber, eben ein Großkotz bist. Aber dass du auch noch verrückt bist, hätte ich nicht gedacht. Du bist doch nicht mehr richtig im Kopf. Du gehörst in eine Anstalt.“
Es war gut, dass Pawelka sich so sicher und überlegen fühlte. Das würde mir die Arbeit erleichtern.
„Willst du dir meinen Plan nicht erst mal anhören?“, fragte ich ruhig.
„Nein“, sagte er prompt. „So gut kann dein Plan gar nicht sein, dass ich da mitmache.“
„Er ist gut“, versicherte ich ihm. Ich musste das Gespräch aufrechterhalten bis es dunkel wurde. Es musste völlig dunkel sein. Ich wollte kein Risiko eingehen. „Du kennst mich, Klaus. Ich habe noch nie halbe Sachen gemacht.“
„Diesmal übernimmst du dich“, prophezeite er. „Das geht nicht gut. Das kann gar nicht gut gehen. Glaubst du, die Polizei ist blöd?“
„Haben sie dich schon mal geschnappt?“
„Nein, noch nie. Und so soll es auch bleiben.“
„Du bist zwar stärker als ich, Klaus, aber ich bin intelligenter. Viel intelligenter, das weißt du. Was ich anpacke, hat Hand und Fuß. Wenn dich die Polizei noch nie erwischt hat, werden sie bei mir erst recht nicht dahinterkommen.“
Und das meinte ich so, wie ich es sagte. Ich war sicher, dass meinen Plan niemand durchschauen würde.
Pawelka sah mich einige Zeit schweigend an. Schließlich fragte er: „Wie sieht denn dein Plan aus?“
„Einfach. Sehr einfach. Für dich ein Kinderspiel.“
Er sagte nichts. Er sah mich nur an.
„Du brichst nachts in mein Haus ein; es wäre ja nicht das erste Mal, dass du das machst. Darin hast du sicher eine Menge Erfahrung. Du nimmst ein paar wertvolle Sachen an dich. Dann kommt meine Frau dazwischen. Du erschießt sie und verschwindest. Für die Polizei wird es so aussehen, als hätte der Einbrecher die Nerven verloren und geschossen. Das ist alles. Mehr hast du nicht zu tun.“
Das war natürlich nur die Version für Pawelka. In Wirklichkeit hatte ich einen viel besseren Plan.
„Und du glaubst, das geht so einfach?“, fragte Pawelka.
„Natürlich.“
„Und du behauptest, du wärst intelligent.“
Ich musste selbst zugeben, dass das kein guter Plan war. Aber in der Eile war mir nichts anderes eingefallen.
„Das Intelligente daran ist die Einfachheit.“ Ich grinste ihn entwaffnend an. Ich musste einfach noch eine Weile reden. „Du musst doch zugeben, dass das schon oft vorgekommen ist. Einbrecher erschießt Hausbesitzer, weil er bei dessen Auftauchen die Nerven verloren hat.“
„Das nimmt dir doch niemand ab.“
„Und warum nicht? Ich bin zu der Zeit weit weg. Ich habe ein bombensicheres Alibi.“
„Dann werden sie auf mich kommen.“
„Warum sollten sie? Du hast doch niemandem gesagt, dass wir wieder Verbindung zueinander haben?“
„Nein.“
„Na also, dann kann dir nichts passieren. Vorausgesetzt, du hinterlässt keine Spuren.“
Er wiegte eine Weile den Kopf hin und her. Dann fragte er: „Und wie willst du den Alten loswerden?“
„Das lass mal meine Sorge sein“, sagte ich schroff. Ich hatte plötzlich genug. Ich wollte dem Spiel ein Ende machen. Er hatte mich lange genug aufgehalten. „Bist du nun mit meinem Plan einverstanden?“
Ich griff unauffällig nach dem Gummiknüppel, den ich zwischen Tür und Vordersitz versteckt hatte.
„Ich weiß nicht …“
Pawelka zögerte. Aber ich hatte es nicht anders erwartet. Ich hatte nie angenommen, dass er darauf eingehen würde. Ich wollte ihn ja auch nur eine Weile hinhalten, und er sollte sein Misstrauen verlieren.
Er war jetzt nach diesem Gespräch bestimmt nicht mehr misstrauisch, und ich war nun ganz sicher, dass er niemandem etwas von unserem Treffen erzählt hatte.
Ich hatte den Gummiknüppel fest im Griff.
„Sieh mal ins Handschuhfach“, sagte ich ruhig. Ich war noch immer die Ruhe selbst.