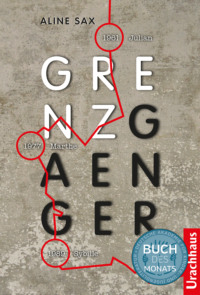Kitabı oku: «Grenzgänger», sayfa 7
ZWANZIG
Keine Ahnung, was mich antrieb, einen wirklichen Entschluss hatte ich nicht gefasst, aber tags darauf schlug ich am Abend den Weg zum Stadtbad Mitte ein. Das Hallenbad war in einem stattlichen alten Gebäude untergebracht, einem der wenigen, die den Krieg überstanden hatten. Das Dach war zwar von zwei Bomben beschädigt worden, die aber zum Glück nicht explodierten. Der Leiter des Bades hatte sie eigenhändig ins Freie getragen, das Dach reparieren lassen und das Schwimmbad bald darauf wieder eröffnet.
Im Eingangsbereich zögerte ich kurz. Da ich keine Badehose eingepackt hatte, würde man mich bestimmt nicht in die Schwimmhalle lassen.
Langsam ging ich die Treppe in den ersten Stock hinauf, wo es eine Galerie mit Aussicht auf das Becken gab. Es war Jahre her, dass ich das letzte Mal hier gewesen war; für Schwimmen hatte ich nicht viel übrig. Meine Haut war von einem feuchten Film überzogen, noch ehe ich oben angelangt war. Ich knöpfte meine Jacke auf.
Der Chlorgeruch weckte unangenehme Erinnerungen an Sportstunden. Unser Schwimmlehrer, ein humorloser Muskelprotz mit blondem Schnurrbart und schmalen Lippen, schlug jedem, der sich am Rand festhalten wollte, mit einem langen Stock auf die Finger. Woche um Woche hatte ich am Beckenrand Trockenübungen absolviert. Woche um Woche hatte ich Wasser geschluckt und in meiner Panik geglaubt, sterben zu müssen, wenn er mich ins Tiefe zwang. Woche um Woche hatte ich die Tortur überlebt.
Hinter den hohen Fenstern war es dunkel, an der Decke jedoch brannten Lampen und erleuchteten die Halle bis in den letzten Winkel.
Der Bademeister forderte mit schrillen Pfiffen und Gebärden die letzten Badegäste, die noch ihre Bahnen zogen, zum Verlassen des Beckens auf.
Unterdessen waren bereits die Synchronschwimmerinnen gekommen – sechs an der Zahl –, alle gertenschlank. Sie machten Aufwärmübungen, streckten sich und beugten den Körper bald hierhin, bald dorthin.
Ich zog meine Jacke aus, hängte sie übers Geländer und schaute hinab zu den Mädchen, die alle schwarze Badeanzüge und weiße Badehauben trugen. Ob Franziskas Gruppenleiterin dabei war, konnte ich nicht erkennen.
Zum Schluss kam noch eine dickere Frau in die Schwimmhalle. Ihre kurze Hose spannte über dem Hintern, und das weiße Oberteil hing wie ein Lappen an ihr. Sie klatschte in die Hände, woraufhin die Mädchen sich wie Hundewelpen um sie scharten. Außer ihnen war nun niemand mehr in der Halle.
Ich trat ein wenig zurück, um nicht gesehen zu werden. Im Grunde war es doch lächerlich, bei einer Trainingsstunde zuzuschauen. Wäre es eine Vorführung gewesen, ja … aber ein Training?
Ein durchdringender Pfiff. Die Mädchen marschierten – wenn auch mit einer gewissen Grazie – am Beckenrand entlang. Dann sprangen sie, jeweils zu zweit, ins Tiefe. Die Trainerin zählte mit lauter Stimme, und die Schwimmerinnen vollführten dazu Figuren: Sie tauchten auf und unter, reckten Arme oder Beine in die Luft, schwammen im Kreis. Alles perfekt abgestimmt, aber nicht sonderlich spektakulär. Eher DDR-typisch. Gleicher Rhythmus, gleiche Bewegungen, keine Abweichung. Kraft und Disziplin – das Idealbild des neuen sozialistischen Menschen.
Ich seufzte. Was tat ich hier überhaupt? Wo ich doch Franziskas Leiterin nicht einmal erkannte …
Ich legte die Ellbogen aufs Geländer und starrte auf die dunklen Fenster gegenüber. Das gesamte Hallenbad spiegelte sich darin. Auch der junge Mann auf der Galerie. Er wollte nicht ins Bild passen, war viel zu dick angezogen, wusste nicht recht, wohin mit sich, fühlte sich nicht zugehörig – weder zur gespiegelten noch zur wirklichen Welt. Betrachtete die Schwimmerinnen unten, als wäre er Lichtjahre von ihnen entfernt.
Ist es das, was ich will, fragte ich mich: eine FDJ-Leiterin, die jede Woche zum Synchronschwimmen geht?
Nein, so schnell durfte ich nicht aufgeben!
Wo ist der kämpferische Julian geblieben?, würde Heike sagen, der Julian, der davon träumt, mich auf dem Moped hinten mitzunehmen, der in fremde Häuser einbricht, um für mich zu kochen und mit mir zu schlafen, dem es egal ist, was man hinter seinem Rücken tuschelt, der tut, was er will?
Ich schämte mich für den Gedanken, Heike gegen solch eine gesichtslose FDJ-Trine eintauschen zu wollen.
Die chlorgeschwängerte Luft machte mir das Atmen schwer, und ich schwitzte wie ein Stier.
Ich musste hier weg! Entschlossen griff ich nach meiner Jacke, wandte mich zum Gehen – und erschrak bis ins Mark.
Denn in der Tür der Galerie stand Wolfgang Wichser.
»Liebe Güte!«, stieß ich hervor. »Was willst du denn hier?«
»Mit dir reden.« Er grinste.
»Mit mir?«
Ich wollte an ihm vorbei, aber er vertrat mir den Weg.
»Woher weißt du, dass ich hier bin?«
»Ich bin dir nachgegangen.« Völlig gelassen sagte er das, als wäre es die normalste Sache der Welt. Als täte er das jeden Abend, rein zum Vergnügen.
»Scharfe Weiber, was?« Er machte eine Kopfbewegung zum Schwimmbecken.
»Was willst du von mir?«
Er zog die Tür hinter sich zu, sodass ich keine Möglichkeit mehr hatte, zu entkommen.
Die Trillerpfeife der Trainerin gellte mir in den Ohren.
»Dir einen Vorschlag machen.« Wieder dieses selbstgefällige Grinsen. »Einen, den du nicht ausschlagen kannst, das gebe ich zu.«
Ich verdrehte die Augen. Mannomann, was hatte ich diese Spielchen satt!
»Das Land ohne Genehmigung verlassen, ist illegal«, sagte er.
Ich wurde stocksteif.
»Drei Jahre Zuchthaus stehen drauf, das weißt du ja wohl.«
War er allein gekommen? Oder hatte er bereits die Stasi informiert und das Hallenbad war umstellt? Ich schwitzte noch stärker.
»Nun ja, jeder macht mal ’nen Fehler, nicht wahr?«
Wusste er, dass wir es versucht hatten, oder vermutete er es nur? Hatte er etwa doch mein Gespräch mit Veronika mitbekommen? »Ich melde das nicht, aber dafür erwarte ich natürlich eine Gegenleistung.«
Darum also ging es.
»Sagen wir so: Du gibst mir nächste Woche fünfhundert Mark, und dafür informiere ich die Stasi nicht.«
»Fünfhundert!«, entfuhr es mir. »So viel habe ich nicht.«
»Tss-tss«, machte Wolfgang kopfschüttelnd. »Also abgemacht?«
»Weißt du was: Du siehst Gespenster!« Ich machte eine wegwerfende Gebärde und versuchte, an ihm vorbeizugehen, doch er blockierte nach wie vor die Tür.
»Vielleicht. Ob es so ist, wird dann die Stasi herausfinden.«
Ich musste mich zusammenreißen, um ihn nicht in seine hämisch grinsende Visage zu schlagen.
»Wir sehen uns also kommende Woche. Du bringst fünfhundert Mark mit. Wohin, erfährst du noch rechtzeitig. Und mach ja keine Sperenzchen, ich behalte dich im Auge.« Nach diesen Worten drehte er sich um und ging.
Ich schnappte nach Luft. Was, um Himmels willen, war da gerade passiert?!
EINUNDZWANZIG
Mir blieb keine andere Wahl. Ich wusste nicht, wie ich sonst an eine solche Menge Geld kommen sollte. Jedenfalls nicht in kurzer Zeit. Und schon gar nicht seit dem Mauerbau. Ich klemmte das Paket fester unter den Arm und schritt zügig aus. Je schneller ich die Sache hinter mir hatte, desto besser.
Mit der U-Bahn fuhr ich zum Alexanderplatz. Schon auf der Treppe nach oben merkte ich, dass meine Hände klamm wurden. Ich stellte mich neben den großen Lebensmittelladen an der Ecke und ließ den Blick schweifen. Dass der Schwarzmarkt seit Kriegsende auf dem Alex angesiedelt war, wusste ich, hatte aber keine Ahnung, wie man dort Geschäfte anbahnte.
Um nicht unnütz herumzustehen, kaufte ich mir an einem Imbissstand ein Bratwurstbrötchen. Mit dem Brötchen in der einen Hand und dem Paket unter dem anderen Arm sah ich mich weiter um. Auf der anderen Seite des Platzes standen Leute beisammen, meist in Zweiergrüppchen. Jacken wurden aufgeklappt und Ärmel hochgeschoben, um den Interessenten Dinge wie Armbanduhren, Nylonstrumpfhosen, verpackte Lebensmittel und so weiter zu zeigen. Gegenstände wechselten blitzschnell den Besitzer, Geldscheine verschwanden ebenso schnell in Hosentaschen. Käufer und Verkäufer sahen einander dabei kaum an, redeten nur das Allernötigste. Die auffällige Unauffälligkeit, mit der all das geschah, reizte schon fast zum Lachen. Berlins Schwarzmarkt blühte jedenfalls nach wie vor.
Mutter hatte mich nach Kriegsende manchmal zum Alexanderplatz mitgenommen, der damals noch ein Trümmerfeld war. Ein Trümmerfeld voller Menschen, die auf lukrative Tauschgeschäfte aus waren. Auch russische und amerikanische Soldaten beteiligten sich mit Kaugummi und Tabak an dem Handel.
Mutter nahm meist Haushaltsgegenstände mit, die sie gegen Butter und Speck tauschte. Meine Aufgabe war es, sie am Ärmel zu ziehen, sobald sich jemand näherte, und zu jammern, ich hätte Hunger. Bei den Deutschen verfing diese Masche ebenso wenig wie bei den Russen. Die Amerikaner hingegen steckten mir öfter mal ein Stück Schokolade zu.
Heute aber ging es nicht um Schokolade. Heute brauchte ich Geld, viel Geld. Für dieses Arschloch von Wolfgang Wichser. Ich biss mir auf die Lippe, als ich an sein dreckiges Grinsen dachte.
Dann steckte ich das letzte Stück Bratwurst in den Mund und überquerte langsam den Platz. Wen sollte ich ansprechen? Wer hatte wohl genug Geld bei sich?
Ein Mann nahm Blickkontakt mit mir auf und kam näher, als ich ein Nicken andeutete. Er trug einen für die Jahreszeit viel zu warmen Mantel und hatte eine große Tasche geschultert.
»Marlboro, Nylons, Whisky …?«, nuschelte er, zündete sich eine Zigarette an und schaute von mir weg.
»Ich hab selber was zu verkaufen.«
Ein knappes Nicken.
Ich nahm das Paket unter dem Arm hervor und schlug das Tuch, in das ich meine roten Schuhe gewickelt hatte, ein Stück beiseite. »Westware«, fügte ich, überflüssigerweise, hinzu. »Nagelneu.«
Ich hatte sie so lange poliert, bis sie aussahen wie frisch aus dem Schaufenster am Ku’damm.
Seine Miene verriet nichts.
Ich wollte schon weggehen, da gab er ein zustimmendes Brummen von sich.
»Achthundert Mark.« Wahrscheinlich war der Preis viel zu hoch, aber ich musste aufs Ganze gehen.
Der Mann musterte mich flüchtig und zog an seiner Zigarette.
»Zweihundert.«
»Fünfhundert.«
Keine Reaktion. Ich schlug das Tuch wieder über die Schuhe und überlegte noch, ob ich besser gehen oder sein Angebot doch annehmen sollte, da schnippte er die Zigarette weg.
»In Ordnung.« Er zog ein Bündel Geldscheine aus der Tasche, zählte schneller, als ich schauen konnte, ein paar davon ab und drückte sie mir in die Hand. Ich gab ihm die Schuhe. Und noch ehe ich nachprüfen konnte, ob er mich auch nicht betrogen hatte, war er verschwunden.
Ich konnte es kaum glauben. Ich hatte das Geld! So einfach war es also, an fünfhundert Mark zu kommen … mehr als ein Monatslohn. Keine zwei Minuten hatte das Ganze gedauert.
Plötzlich stand ein Junge vor mir, den ich überhaupt nicht hatte kommen sehen. Er mochte etwa sechzehn sein, war aber gut einen Kopf kleiner als ich und trug eine Strickjacke, die ihm viel zu groß war.
»Waren das Schuhe aus dem Westen?«, flüsterte er und trat noch einen Schritt näher.
Ich wich ein wenig zurück.
»Hast du Westkontakte?«, fuhr er fort, jetzt mit dringlicherem Tonfall.
Ich zog die Brauen hoch. »Seit die Grenze dicht ist, hat keiner mehr Westkontakte«, erwiderte ich.
»Aber es gibt doch Möglichkeiten …«
Mit einem Mal sah ich den Mann: In etwa fünfzig Metern Entfernung lehnte er an einem geparkten Auto und rauchte eine Zigarette. Und im Wagen saß ebenfalls ein Mann.
Jetzt hieß es aufpassen.
»Ich kenne keine solchen Möglichkeiten. Lass mich in Ruhe.« Brüsk wandte ich mich ab und ging davon.
Der Junge folgte mir nicht, und ich hörte auch keinen Motor anspringen. Dennoch schlug mein Herz wie wild, und ich musste mich zusammennehmen, um nicht zu rennen.
Am Stand des Wurstverkäufers blieb ich stehen und schaute über die Schulter. Der Junge schlenderte zum Rand des Platzes und bog um eine Ecke. Der Mann am Auto trat gerade seine Kippe aus und sagte etwas zu dem am Steuer, der daraufhin den Motor anließ und langsam in die Richtung fuhr, in welcher der Junge verschwunden war.
Erst jetzt merkte ich, dass ich die ganze Zeit die Hände zu Fäusten geballt hatte – die Geldscheine waren feucht von meinem Schweiß. Die Begegnung mit dem Jungen und seine Unvorsichtigkeit lehrten mich zweierlei. Erstens: Wenn Rolf und ich fliehen wollten, durften wir auf keinen Fall einen Dritten einbeziehen oder gar um Hilfe bitten, denn letztlich war niemandem zu trauen. Zweitens: Ich wollte unbedingt hier weg, sonst würde diese verdammte Paranoia mein ganzes weiteres Leben bestimmen, und ich würde mich immer wieder mit Gestalten wie Wolfgang Wichser herumschlagen müssen.
Höchste Zeit, dass Rolf und ich neue Pläne schmiedeten.
ZWEIUNDZWANZIG
Wir wussten es nicht. Wir wussten es einfach nicht.
Den ganzen Abend hatten wir zusammengesessen und überlegt, wie sich die Flucht bewerkstelligen ließe. Wir hatten sogar erwogen, die Mauer zu überfliegen. Aber woher ein Flugzeug nehmen? Mieten? Kapern? Selbst bauen?
Rolf hatte die Stirn in Falten gelegt – ein Gedankenspiel, nicht realisierbar.
»Wir müssen komplett anders denken als der Staat«, hatte ich gesagt. »Dann finden wir bestimmt eine Möglichkeit, die diese Sturköpfe übersehen haben.« Aber was für eine, das wollte mir auf die Schnelle nicht einfallen.
Über die Mauer klettern oder durch die Spree schwimmen kam nicht infrage. Nicht seit sie auf Flüchtlinge scharf schossen. Dass wir ein Risiko eingehen mussten, war klar, aber wenn schon, dann sollte unser Plan gute Erfolgschancen haben.
Die Sache mit der Kanalisation konnten wir vergessen, denn darauf würden sie nun ein besonderes Auge haben.
Einen Tunnel graben – das hatten wir als Nächstes erwogen. Material und Werkzeuge könnte ich mir auf den Baustellen beschaffen. Aber ich war kein Ingenieur, und Rolf ebenso wenig. Wir hatten beide keine Ahnung von Dingen wie Neigungsgrad, Grundwasserspiegel, Stützkonstruktionen und wie man sich unter der Erde orientieren konnte, damit der Tunnel dort endete, wo er sollte. Jemanden einweihen, der sich damit auskannte? Diesen Gedanken verwarfen wir gleich wieder, es wäre zu gefährlich gewesen.
Trotz allem wollte ich die Idee nicht aufgeben – irgendeine Möglichkeit musste sich doch finden!
Selbst bei der Arbeit konnte ich an nichts anderes mehr denken. Während ich Maurerkellen einsammelte, Eimer mit Wasser füllte und Zementsäcke schleppte, überlegte ich, was wir für einen Tunnel alles brauchen würden, und ließ meinen Blick über die herumliegenden Werkzeuge und das Baumaterial schweifen. Wir könnten die Sachen bei Nacht holen – ich wusste ja, was wo zu finden war. Dieser Gedanke verlieh mir so viel Energie, dass ich mit nie da gewesener Begeisterung Mörtel anmischte.
Nachts und sonntags, so stellte ich mir vor, würden wir graben und graben und graben. Dabei schwitzen und von Kopf bis Fuß dreckig werden. Dennoch würden wir unverdrossen weitermachen und unseren Tunnel Meter um Meter vorantreiben, immer näher zur Grenze hin, darunter durch und ein Stück in den Westen hinein. Und dann würde ich endlich vor Heike stehen …
Und wenn der Tunnel schon einmal da war, könnten auch Vater und Mutter ihn zur Flucht nutzen. Und Gudrun mit ihrer Familie. Dann wären wir wieder alle beisammen und keiner müsste sich nach den anderen sehnen. Dass mein Plan unversehens in Träumerei übergegangen war, fiel mir erst gar nicht auf. Ich merkte nicht, dass ich zu viel Wasser genommen hatte und der Mörtel zu dünnflüssig geworden war. Und ich merkte auch nicht, dass der Polier plötzlich neben mir stand und mein Tun stirnrunzelnd verfolgte.
»Niemöller!«
Ich fuhr zusammen.
»Sie sollen nach Feierabend zu Herrn Bormann ins Büro kommen.« Ohne meine Antwort abzuwarten, ging er wieder.
Nach Feierabend zum Chef … ach du grüne Neune! Mein Blick fiel auf den viel zu nassen Mörtel. Das würde Ärger geben!
Ich schüttete Pulver nach und rührte aus Leibeskräften. Was schwierig war, denn die Wanne war jetzt viel zu voll.
Womöglich hatte der Chef von meiner früheren Beschäftigung in Westberlin Wind bekommen?
Ich holte eine zweite Wanne und schöpfte mit einem Eimer einen Teil der Mischung um. Na, das hatte ich gründlich verpatzt.
»Beeilung, Niemöller!«, rief einer der Maurer mir zu. »Wir warten schon eine ganze Weile!«
Verflogen war der Tunneltraum und mit ihm alle Energie und Hoffnung.
Die Stunden zogen sich hin. Ich war froh, als der Polier endlich sagte, wir könnten Feierabend machen. In Windeseile zog ich mich um, rannte zu meinem Rad und dachte nicht mehr an Bormann.
»Niemöller!« Der Polier rief mir nach, als ich gerade in die Straße einbiegen wollte. Da fiel es mir wieder ein.
Sofort machte ich kehrt und steuerte das Büro des Chefs an.
»Warten Sie bitte einen Moment. Herr Bormann wird gleich da sein«, sagte eine junge Frau. Sie trug einen ziemlich kurzen Rock. Wenn sie sich vorgebeugt hätte, ohne dabei in die Knie zu gehen, hätte ich einen Blick auf ihren Schlüpfer erhaschen können. Sie führte mich in einen Nebenraum voller Bücher und ließ mich dort allein. In dem Raum standen keine Stühle, nur ein Sessel im Fenstererker. Ein Monstrum von einem Sessel, aus dem man so schnell nicht wieder hochkam, darum verzichtete ich darauf, mich zu setzen. Auch wenn es länger dauern sollte, bis Bormann zu erscheinen beliebte.
Ich ging hin und her und ließ dabei den Blick über die Buchregale schweifen. Da standen Fachbücher über Ingenieurwissenschaften, diverse Enzyklopädien, Jahresberichte des Ministeriums für Bauwesen und natürlich die obligatorischen Klassiker von Marx, Engels, Lenin und Konsorten, teils in russischen Ausgaben. Ob Bormann die alle gelesen hatte? Wahrscheinlich ebenso wenig wie ich, bis auf ein paar Passagen im Russischunterricht oder in Staatsbürgerkunde.
Viele der Bücher waren alt, stellte ich fest. Ich zog wahllos eines heraus, einen schmalen Band. Die U-Bahn Gesundbrunnen–Neukölln – Zur Eröffnung der Nordstrecke Neanderstraße–Gesundbrunnen am 18. April 1930 stand in Großbuchstaben auf dem Leinenumschlag. Typischer Regalfüller, dachte ich, blätterte aber dennoch darin herum. Es enthielt Bauzeichnungen und Tabellen mit genauen Angaben zu Bahnsteiglängen, Höhen der Tunnel und so weiter.
Tunnel … das Wort elektrisierte mich regelrecht. Die U-Bahnen fuhren durch Tunnel, die es bereits gab! Wir bräuchten also gar nicht selbst zu graben, sondern bloß eine Möglichkeit finden …
Ein Blick zum Regal. Da standen noch mehr Bücher über den U-Bahn-Bau. Ich zog ein zweites heraus.
»Aber sicher, Frau Lindner!«, hörte ich Bormanns Stimme hinter der Tür. Blitzschnell schob ich die beiden Bücher unter meine Jacke und wandte mich zur Tür um, durch die Sekunden später Bormann kam. Er nickte knapp und bedeutete mir, ihm in sein Büro zu folgen.
»Setzen Sie sich.« Er wies auf den Stuhl neben seinem Schreibtisch und nahm in einem Sesselmonstrum Platz, wie es auch in der kleinen Bibliothek nebenan stand.
Und dann kam er auch schon zur Sache: »Der Meister hat mir gesagt, dass Sie Ihre Arbeit gut machen, meinte aber, die Maurer könnten auch ohne Ihre Hilfe auskommen.«
Dieser Auftakt verhieß nichts Gutes, trotzdem riss ich mich zusammen und hörte weiter zu. Denn am liebsten wäre ich aufgesprungen, weil ich mit meiner Beute zu Rolf wollte.
»Es verhält sich so, dass auf einer Großbaustelle an der Marchlewskistraße weitere Maurer gebraucht werden. Und weil Sie Erfahrung in diesem Beruf haben, will ich Sie dort einsetzen.«
Wie? Er wollte mich gar nicht entlassen? Sondern sogar befördern? Sodass ich künftig in meinem erlernten Beruf würde arbeiten können statt als Hilfskraft.
»Vielen Dank«, sagte ich zögerlich.
»Als Maurer bekommen Sie natürlich einen höheren Lohn. Frau Lindner hat bereits Anweisung, die nötigen Unterlagen auszufertigen.« Er lehnte sich zurück und betrachtete unser Gespräch anscheinend als beendet.
Ich bedankte mich noch einmal und stand auf, die Hand vor der Brust, damit die Bücher nicht unter der Jacke hervorrutschten.
In Frau Lindners Büro unterschrieb ich alle Papiere, die sie mir vorlegte, ohne sie durchzulesen. Weil ich möglichst schnell wegwollte. Ich hatte einen neuen Plan, nur das zählte jetzt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.