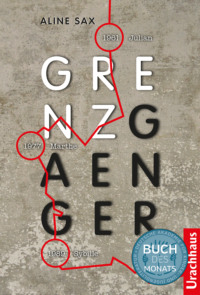Kitabı oku: «Grenzgänger», sayfa 5
VIERZEHN
Es war ein Tag zum Ersticken. Was das Wetter betraf und auch sonst. Der Himmel war verhangen, aber unter der Wolkendecke herrschte eine Schwüle, als könnte jede Minute ein Gewitter losbrechen. Mir war, als wäre nicht nur die Luft um mich herum, sondern auch mein Inneres elektrisch aufgeladen.
Heute waren wir mit dem blonden Mädchen auf dem Friedhof verabredet. Falls ihr zu trauen war, würde sie dort auf uns warten. Falls nicht, jemand von der Stasi.
Die Woche hatte sich zäh und langsam hingezogen, und heute wollte die Zeit überhaupt nicht vergehen. Im Gottesdienst am Vormittag hatte ich mich fortwährend umgesehen, nach Männern Ausschau gehalten, die mich eventuell verfolgten, weil etwas durchgesickert war. Aber da war niemand, weder in der Kirche noch auf dem Nachhauseweg. Irgendwie überstand ich das Mittagessen, zu dem Frau Schulze sich selbst eingeladen hatte, und zog mich dann in mein Zimmer zurück, um Schallplatten zu hören. Auf dem Bett liegend, ließ ich zur Musik sämtliche Erinnerungen an Heike vor meinem inneren Auge vorbeiziehen. Es kam mir vor, als hätten wir uns vor einer Ewigkeit das letzte Mal gesehen, und meine Sehnsucht nach ihr wurde so groß, dass die Brust schmerzte.
Kurz vor dem Abendessen kam Rolf, und Mutter freute sich so über den unerwarteten Besuch, dass außer ihr kaum jemand zu Wort kam. Sie redete ohne Punkt und Komma über alle möglichen Alltagsdinge. Was sie beim Bäcker gehört hatte … dass sie beim Fleischer eine geschlagene Stunde anstehen musste, dann aber tatsächlich Koteletts bekommen habe … dass die Tochter und der Schwiegersohn von Frau Katzenberg endlich Aussicht auf eine Wohnung hätten und deshalb nicht mehr lange mit dem Baby bei ihr wohnen müssten …
Wem wird sie all das erzählen, wenn wir beide nicht mehr da sind?, dachte ich unwillkürlich. Vater? Franziska? Frau Schulze? Ein Schuldgefühl wollte sich breitmachen, aber ich ließ es nicht zu. Mein Entschluss stand fest, es gab kein Zurück mehr.
Nach dem Essen zogen wir los. Mutter fragte überhaupt nicht, was wir vorhatten; wahrscheinlich glaubte sie, ihre Söhne gingen noch kurz auf ein Bier.
Draußen war es noch drückender als am Vormittag. Der Himmel war lila, und Böen trieben dicht am Boden erstes Herbstlaub durch die Straßen.
Beim Friedhof angekommen, öffnete Rolf das eiserne Gittertor. Es quietschte nicht, was es in einem Film sicherlich getan hätte. Und in einem Film wären wir natürlich verfolgt worden. Aber auch das war nicht der Fall; ich hatte mich auf dem Weg hierher immer wieder umgeblickt. Dennoch war mir unbehaglich zumute.
Der Friedhof machte einen gepflegten Eindruck. Auf den Grabplatten lag kein Laub herum, und auf vielen Gräbern standen frische Blumen oder brannten ewige Lichter. Eine Baumreihe schloss das Gelände zur Straße hin ab, sodass man nicht das Gefühl hatte, sich mitten in einer Großstadt zu befinden. Und es war ungewöhnlich still, nicht einmal Vogelgezwitscher war zu hören. Das blonde Mädchen saß auf einer Bank an einem Nebenweg. Mit einem etwa dreißigjährigen Mann in blauer Arbeitshose und einem schmuddeligen Pullover.
»Setzt euch.«
Wir ließen uns neben den beiden auf der Bank nieder.
»Das ist … Frank«, sagte das Mädchen. »Er ist hier bei uns zuständig. Für das … äh … Reisebüro.«
Der Mann musterte uns. »Ihr wollt also fliehen?« Seine Stimme war kühl, sachlich.
Rolf und ich nickten.
»Warum?«
Ein schneller Blick von Rolf.
Es war meine Idee gewesen, also war es nur recht und billig, wenn ich die Frage beantwortete. Ich schluckte kurz. Ob man diesem Frank trauen konnte? Dass er in Wirklichkeit nicht so hieß, war klar – das Zögern des Mädchens, bevor sie seinen Namen nannte, war mir nicht entgangen. Womöglich waren die beiden doch Spitzel und wollten uns aushorchen und verhaften lassen, sobald wir unsere Fluchtabsicht laut und deutlich geäußert hatten. Wieder schluckte ich, aber meine Kehle war und blieb trocken. Wenn es doch nur regnen würde … Andererseits – die beiden konnten sich ja auch nicht sicher sein, was uns betraf, und dachten vielleicht, wir wollten ihre Organisation infiltrieren und auffliegen lassen.
»Meine Freundin ist im Westen«, sagte ich schließlich heiser. Frank verzog keine Miene.
Dass ich mein Leben in Ostberlin als sinnlos und leer empfand, würde ihn wohl kaum interessieren, darum fuhr ich fort: »Ich habe in Westberlin gearbeitet und habe dort Freunde. Und, wie schon gesagt, meine Freundin. Ich lebe auf der falschen Seite der Mauer.«
»Und du meinst, auf der kapitalistischen Seite gefällt’s dir besser?«
Ich zuckte zusammen. Also doch …
Aber er grinste. »Kleiner Scherz, schon gut.« Dann wandte er sich an Rolf: »Und du?«
Rolf hatte sich inzwischen eine Zigarette angezündet, nahm einen Zug und blies den Rauch aus.
»Ich möchte Paris sehen. Und ich will meinen kleinen Bruder nicht allein gehen lassen. Der ist leichtsinnig und schlägt gern mal über die Stränge.«
An der Art, wie er den Glimmstängel hielt, merkte ich, dass seine Lässigkeit nur Schein war.
»Und wie habt ihr euch die Flucht vorgestellt?«, fragte Frank.
»Ich hab mir die Häuser an der Bernauer Straße angesehen«, sagte ich. »An der Ecke Ruppiner Straße war ein Kellerschacht zum Westen hin offen …«
»Aber jetzt ist da alles zugemauert«, ergänzte Rolf. »Und eine andere Möglichkeit haben wir noch nicht gefunden. Ich war mehrmals am Teltowkanal und an der Spree …«
Das war mir neu. Davon hatte er noch gar nichts erzählt … oder bluffte er?
»… aber da ist wohl auch nichts zu machen.«
»Tja, und dann habe ich sie …« – ich zeigte auf das Mädchen.
»Veronika«, sagte sie rasch.
»… habe ich Veronika kennengelernt, und sie hat mir von eurem Unternehmen erzählt.«
Frank ließ uns nicht aus den Augen.
»Hast du ’ne Kippe für mich?«, wandte er sich plötzlich an Rolf. Der zog eine Selbstgedrehte aus seiner Hemdtasche und reichte sie ihm. Dann beugte er sich zu ihm hinüber, um ihm Feuer zu geben.
»Gut.« Frank blies den Rauch über unsere Köpfe hinweg.
»Am vierundzwanzigsten September geht die nächste Gruppe. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit.«
»Am vierundzwanzigsten September?«, wiederholte Rolf. »Das heißt: kommende Woche?«
Er nickte.
Schon in einer Woche … eine Woche war so schnell vorbei … was würde ich bis dahin noch alles erledigen müssen? Es kam mir fast vor, als hätte man mir gesagt, mir bliebe nur noch eine Woche zu leben.
»Wir müssen schnell handeln. Kann gut sein, sie machen demnächst auch die Kanalisation dicht.« Es klang, als hätte er das schon x-mal zu Leuten gesagt, die ähnlich dachten wie ich im Moment. »Ihr könnt aber auch auf die Warteliste, dann …«
»Wir gehen mit«, unterbrach ich ihn entschlossen.
»Gut. Ihr werdet zu sechst sein. Also noch drei andere. Wer, das braucht ihr nicht zu wissen. Kein Gepäck. Dunkle Kleidung bitte. Und weder Seile noch Taschenlampen mitnehmen. Wenn ihr mit so was erwischt werdet, ist es für die ganze Gruppe aus. Ein siebter, der Deckelmann, macht den Kanaldeckel auf und schließt ihn hinter euch wieder. Unten geht ihr geradeaus. An der Grenze sind die Gänge mit Sperrgittern versehen, aber unter denen kann man durchtauchen. Jenseits davon stehen zwei Westler. Die führen euch zu einem Ausgang außer Sichtweite der Grenze. Unterwegs nicht sprechen und kein Licht machen. Das Ganze muss schnell und leise vor sich gehen.«
Seine Erläuterungen waren äußerst präzise, dabei kurz und knapp.
»Selbstverständlich redet ihr mit keinem darüber. Ihr verhaltet euch bis zum vierundzwanzigsten wie sonst auch. Geht zur Arbeit, kauft ein – alles wie immer. Kein Abschied von Familienangehörigen und so. Und keine Briefe hinterlassen, das würde euren Leuten nur Scherereien machen.«
Ich schluckte.
»Noch Fragen?«
Mir fiel so schnell nichts ein. Und auch Rolf schüttelte den Kopf. »Also gut. Sonntagabend um zehn wartet Veronika in der Kneipe, wo ihr sie kennengelernt habt, auf euch.« Die beiden standen auf und gaben uns nacheinander die Hand.
Und ehe ich mich’s versah, waren sie auch schon verschwunden. Rolf und ich saßen allein da und sahen einander ungläubig an: Würden wir tatsächlich schon nächste Woche im Westen sein?
»Mir scheint, wir sind Glückspilze«, meinte Rolf schließlich. »Besser organisiert könnte die Flucht gar nicht sein. Das hätten wir selber nie so hinbekommen.« Er grinste.
Ich erwiderte das Grinsen halbherzig. Irgendwie konnte ich es noch nicht fassen.
Auch als ich zu Hause in meinem Zimmer am Fenster stand und es endlich zu regnen begonnen hatte, kam mir unser Vorhaben noch unwirklich vor. In einer Woche würde ich nicht nur bei Heike sein, sondern auch als Staatsfeind gelten und meine Familie nie mehr wiedersehen.
FÜNFZEHN
Es wurde die merkwürdigste Woche meines Lebens. Ich war ängstlich, erleichtert, aufgeregt und deprimiert – alles zugleich. Die Zeit verging zu schnell und doch nicht schnell genug. Ich versuchte, Franks Anweisung zu befolgen und mich so zu verhalten wie sonst auch. Aber das war schwierig, weil ich mich so völlig anders fühlte.
Am Esstisch prägte ich mir das Gesicht meiner Mutter ein, ihre Augenfarbe, ihre Haarfarbe und die feinen Fältchen in den Mundwinkeln. Jeden Satz, den sie sagte, wollte ich mir merken.
Auch meinen Vater betrachtete ich heimlich. Und wieder einmal wurde mir bewusst, wie wenig ich ihn doch kannte. Zu gern hätte ich gefragt, woher sein Starrsinn und seine Härte rührten, warum er sich wie mit einem Panzer gegen uns abschottete. Der Krieg hat ihn innerlich umgebracht, hatte meine Mutter einmal gesagt, aber nicht erklärt, wie sie das genau meinte. Er selbst mied das Thema Krieg. Als er ’46 aus russischer Gefangenschaft zurückkehrte, traf er zu Hause Kinder an, die ihn den größten Teil ihres Lebens nicht gesehen hatten. Ich – damals fünf – hatte ihn überhaupt noch nie gesehen. Mein Vater war für mich das Foto auf Mutters Nachttisch. Ein stattlicher Offizier in Wehrmachtsuniform mit lachendem Gesicht. Und auf einmal stand ein ausgemergelter Mann in der Tür, der meine Mutter küsste und von da an bei uns wohnte. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich begriff, dass der wortkarge Mann, der mich schlug, wenn ich im Weg herumstand oder meinen Teller nicht leeraß, derselbe war wie auf dem Foto. Für ihn wiederum war ich das Kind, von dem er nur aus Briefen meiner Mutter wusste. Gudrun und Rolf hingegen hatte er als Säuglinge und Kleinkinder erlebt.
Als ich in die Pubertät kam, rechnete ich des Öfteren nach, traute mich aber nicht, meine Mutter direkt zu fragen, ob er neun Monate vor meiner Geburt auf Heimaturlaub gewesen war.
Jedenfalls war es, als hätte sein Leben erst mit der Rückkehr aus der Gefangenschaft begonnen, denn über früher sprach er nie, auch nicht über die Zeit vor dem Krieg. Eine einzige Geschichte aus dem Krieg kam mir zu Ohren, als er sie Florian erzählte. Vater und seine Kameraden hatten im Afrikakorps gekämpft und in der Wüste ein Kamel eingefangen, mit dem sie ein britisches Lager überfallen wollten. Weil das Tier ihnen den gesamten Wasservorrat wegsoff, war ihr Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Aber das konnte ihn innerlich nicht umgebracht haben. Es musste etwas anderes gewesen sein.
Ich überlegte, ob er es mir wohl sagen würde, wenn er von unserem Fluchtplan wüsste und dass wir einander wahrscheinlich nie mehr sehen würden. Nein, eher nicht … stattdessen würde er mir eine Predigt halten. Über Gehorsam und Pflichtbewusstsein. Und mich abkanzeln, weil ich mir von einem Mädchen aus dem Westen den Kopf hatte verdrehen lassen. Seine wahren Gefühle würde er hinter Prinzipien und Ermahnungen verstecken. So wie immer. Also ließ ich es beim Beobachten und bedauerte, dass ich meinen Vater nie wirklich würde kennenlernen.
Wenn ich durch die Straßen ging, kamen mir die Farben anders vor, die Sonne wärmte meine Haut intensiver, und der Wind trug die verschiedensten Gerüche heran. An den heruntergekommenen Häusern, den Schutthalden aus dem Krieg, den neu angelegten breiten Straßen und den einförmigen Wohnblocks nahm ich Details wahr, die mir vorher nie aufgefallen waren. Ich sah, dass die Sockel der Laternenpfähle entlang der Stalinallee kleine Klappen hatten und dass eines der Arbeiterdenkmäler an der Rathausstraße statt Stiefeln eine Art Pantoffeln trug. Die Herbstblumen im Park hatten leuchtendere Farben, und die Straßenbahnen bimmelten lauter. Nur die Parolen auf den Plakatwänden blieben leere Phrasen.
Und ich achtete auf etwas, das mich bisher nie interessiert hatte: die Gullys. Ihr Durchmesser würde einen problemlosen Abstieg erlauben. Und sie hatten Löcher, an denen der Deckelmann sie anheben konnte. Wie viele von den Gängen darunter mochten in den Westen führen? Letztlich wohl alle, denn da unten stand alles miteinander in Verbindung. Und wenn ich auf einem Gullydeckel stehen blieb, war mir, als könnte ich das fühlen und als hörte ich das Abwasser unter mir rauschen.
Mir alles so gut wie möglich einzuprägen war meine einzige Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Mutter und Vater müssten sich später alles zusammenreimen. Das heißt, vermutlich würde jemand von der Staatssicherheit kommen, um sie über unsere Flucht zu informieren. Sie würden die Nachricht ebenso verwundert wie entsetzt aufnehmen, sodass der Stasi-Mensch gar nicht auf die Idee kam, sie könnten Mitwisser sein.
Weil mein Vater mir andauernd zusetzte und weil ich mich verhalten sollte wie sonst auch, bemühte ich mich weiterhin um Arbeit. Und es war, als hätte der Teufel die Hand im Spiel. Als ich mich am Mittwoch zum x-ten Mal bei irgendeinem Stellvertreter irgendeines Geschäftsführers irgendeiner Baufirma vorstellen durfte, hatte ich auf einmal eine Stelle. Nicht als Maurer, aber als Hilfskraft. Der Lohn betrug nur einen Bruchteil dessen, was ich bei Reitmann & Sohn verdient hatte. Aber weil es ohnehin egal war, sagte ich zu. Am Montag könne ich anfangen, hieß es. Ich nickte, stellte pro forma noch ein paar Fragen, unterschrieb den Vertrag und verabschiedete mich mit einem Händedruck. Der Mann würde sich wundern, wenn ich am ersten Arbeitstag gar nicht erst auftauchte. Aber das brauchte mich nicht zu kümmern.
Einzig mit Rolf konnte ich über alles reden. Ich ging jeden Abend bei ihm vorbei. Den Rücken an die Wand gelehnt, saßen wir nebeneinander auf seinem Bett, tranken Bier, und er rauchte eine Zigarette nach der anderen. Als ich ihm erzählte, wie anders ich alles empfand, nickte er nur. Wahrscheinlich erging es ihm genauso.
»Willst du wirklich nach Italien?«, fragte ich ihn, als eine längere Stille eintrat.
»Ja.« Er sah mich an. »Erst als du von Freiheit geredet hast, ist mir klar geworden, was uns hier alles versagt bleibt. Wie begrenzt unsere Welt ist. Seitdem spuken mir alle möglichen Länder und Orte durch den Kopf, die ich gern sehen möchte.« Er schloss die Augen: »Rom … Paris …«
Solche Träume hatte ich nicht. Ich konnte nicht weiter denken als bis Sonntagabend. Und daran, was dann alles für immer zu Ende sein würde.
»Am Sonntag hat Franziska Geburtstag.« Ich nahm einen Schluck Bier. »Wir könnten Gudrun und Hermann fragen, ob sie zum Essen kommen. Als Absch…« Das Wort blieb mir im Halse stecken.
Rolf nickte.
»Und wegen Franziska natürlich.«
Ich fragte mich, ob meine kleine Schwester mir wohl fehlen würde. Und ich ihr. Gudrun ja, die würde mir fehlen. Und Marthe und Florian ebenso. Ob die beiden sich in zehn Jahren, falls die Mauer so lange stand, noch an mich erinnerten? Oder würde ich dann ein Onkel sein, der nur als Foto existierte?
Ich versuchte, an etwas Erfreuliches zu denken. An Heike. Daran, wie überrascht sie sein würde, wenn ich plötzlich vor ihr stand. Wir würden uns eine gemeinsame Wohnung suchen. Bestimmt könnte ich mir bald ein Auto leisten, sodass wir verreisen konnten. Wenn ich Appetit auf Bananen oder Apfelsinen hatte, würde ich die einfach im Laden kaufen. Und kein Uniform-Heini könnte mich je mehr demütigen. Ach ja, noch war das alles Zukunftsmusik.
Wieder trank ich von meinem Bier.
»Du grübelst zu viel.« Rolf prostete mir mit seiner Bierflasche zu. »Komm, lass uns eine Partie Schach spielen.«
SECHZEHN
Eigentlich hatte ich jeden Moment im Gedächtnis speichern, mir jedes Wort merken wollen. Und dann zogen die Tage wie im Rausch vorbei, ich konnte mich kaum konzentrieren und verlor jegliches Gefühl für Zeit und Raum. Es war, als ginge das Leben bereits ohne mich weiter.
Am Sonntagmorgen hatte ich mich noch einmal genau in meinem Zimmer umgesehen. Hatte die Kleider aufs Bett gelegt, die ich anziehen wollte. War kurz versucht gewesen, doch etwas als Andenken mitzunehmen. Hatte den Gedanken gleich wieder verworfen, weil es mich nur bedrückt hätte, etwas auszusuchen. Nicht einmal den Schuhkarton unter meinem Bett hatte ich aufgemacht, um mir noch einmal anzusehen, was ich in der Kindheit alles gesammelt hatte. Weder dem Bild von Heike, das sie mir geschenkt hatte, noch dem Schlüsselanhänger, den Florian für mich gebastelt hatte, schenkte ich einen Blick.
Stattdessen war ich ins Elternschlafzimmer gegangen und hatte die Schubladen von Mutters Nachttisch nacheinander aufgezogen und wieder zugemacht, ohne zu wissen, was ich suchte. Erst als ich es fand, wurde es mir bewusst. Das Foto meines Vaters. Als ich es aus dem Rahmen nehmen wollte, fiel ein anderes Bild, das dahintergesteckt hatte, auf den Bettvorleger. Es zeigte ebenfalls meinen Vater, stammte aber wohl aus dem Krieg und war ziemlich unscharf. Neben ihm war eine Holzhütte zu sehen und hinter ihm eine unbebaute Ebene. Vater lachte, das Gewehr in der Hand, in die Kamera. Aber es war eine andere Art Lachen als auf dem Bild, das ich kannte.
Ich schrak zusammen, als ich vom Flur her Stimmen hörte. Schnell steckte ich das lose Foto ein, legte den Rahmen in die Schublade und schloss sie wieder.
Gudrun und Hermann waren gekommen. Mit den Kindern. Ich ging in mein Zimmer und schob das Foto in das bereitliegende Hemd. Dann ging ich ins Wohnzimmer hinüber.
»Onkel Julian!« Florian freute sich mächtig, mich zu sehen.
»Mannomann, du bist ja schon wieder gewachsen!«, gab ich mich erstaunt.
Florian reagierte mit der Unbekümmertheit kleiner Kinder: Er stellte sich neben mich und legte die Hand auf seinen Kopf, um zu prüfen, bis wohin er mir reichte. Bis zum Nabel.
Daraufhin wollte natürlich auch Marthe zeigen, wie groß sie schon war. Sie reichte mir gerade bis zu den Hüften, darum hob ich sie hoch und hielt sie über meinen Kopf. Sie kreischte vor Vergnügen.
Als Rolf endlich eingetroffen war, setzten wir uns an den Esstisch. Ich mied seinen Blick. Was nicht auffiel, denn Franziska beanspruchte alle Aufmerksamkeit, indem sie mit viel Tamtam ihre Geschenke auspackte.
Nach dem Essen schauten sich Marthe und Florian mit ihrem Stereomat Bilder an, bis sie müde wurden und, auf dem Sofa aneinandergelehnt, einschliefen.
Gudrun, Hermann und Mutter unterhielten sich, aber ich bekam kaum etwas davon mit. Später half ich den Frauen beim Abwasch, während Vater, Rolf und Hermann es sich im Wohnzimmer gemütlich machten.
»Julian, könntest du am vierzehnten Oktober auf Marthe und Florian aufpassen?«, fragte meine Schwester auf einmal. Ich starrte sie völlig perplex an: Der vierzehnte Oktober war ein Datum, das für mich nicht existierte.
»Wir sind zu einer Feier eingeladen«, sagte Gudrun halb entschuldigend.
»Ach so, ja, kein Problem.«
Sie lächelte mich an und nahm Mutter den nächsten gespülten Teller ab. Mit hängenden Armen stand ich da, das Geschirrtuch in der Hand. Das Gefühl, außen vor zu sein und ohne Raum- und Zeitbezug irgendwo zu schweben, verstärkte sich.
Und es ließ nicht mehr nach. Als Hermann und Gudrun ihre Kinder auf die Arme nahmen und sich mit dem üblichen Wangenkuss verabschiedeten, spürte ich die Berührung ihrer Lippen überhaupt nicht. Und als ich mich umgezogen hatte, in meine Jacke schlüpfte und zu den Eltern sagte, ich würde bei Rolf übernachten, und sie meine Lüge ohne Argwohn schluckten, fühlte ich mich innerlich völlig hohl. Ich umarmte Mutter, gab Vater die Hand und sagte mechanisch: »Na denn, bis morgen.«
Schweigend gingen wir zu der Kneipe, in der ich Veronika eine Woche zuvor getroffen hatte. Und wir sagten auch nichts, als wir uns an einem Tisch gegenübersaßen und auf sie warteten.