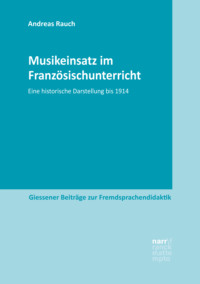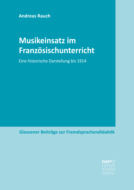Kitabı oku: «Musikeinsatz im Französischunterricht», sayfa 11
II. 2. 2 Wichtige Vertreter der naturgemäßen Methode und ihr Bezug zum Musikeinsatz
II. 2. 2. 1 A. F. Louvier
In den 1860er Jahren wurde die Anschauungsmethode durch den Direktor einer höheren Töchterschule in Hamburg, A. F. Louvier, neu begründet. Die Methode knüpft an die Versinnlichungsmethode1 der Dessauer Philanthropen an. Louvier setzte zur unmittelbaren Anschauung im Anfangsunterricht Gegenstände, Modelle und vorgespielte Aktionen ein.2 Er stellt in seiner Schrift Über Naturgemäßheit im fremdsprachlichen Unterricht3 sein „naturgemäßes“ und imitatives Lehrverfahren vor, das planmäßig und abgestuft ist:4
Motto: Sprachunterricht kann nie in der pestalozzischen Schule seine feste Grundlage finden – d. h. zu einer naturgemäßen Methode gelangen, wenn diese sich nicht stützt auf eine Erkenntnistheorie5 und eine Psychologie, die imstande ist, zugleich auch der Sprachentstehung im einzelnen Kinde, parallel gehend zu folgen.
Die „Naturgemäßheit“ steht der „Unnatur“ ungefähr ebenso schroff entgegen, wie „Erziehung“ (Entwicklung) der „Dressur“. So wie der Unterricht sich von seiner erzieherischen Pflicht entfernt, verfällt er erbarmungslos eben der Dressur, sei es in höherem oder geringerem Grade: ein Drittes giebt es nicht, und der Begriff „naturgemäß“ deckt sich mit dem Begriff “erziehlich“, wie „Unnatur“ stets der „Dressur“ innewohnt. Es läßt sich daher nicht verschweigen, daß jeder nicht naturgemäße Unterricht also zur Dressur entwürdigt wird.6
Louvier stellt drei Funktionen der Sprachenbildung dar, die im naturgemäßen Unterricht als Stufen aufeinander folgen:
1 „Anschauung“
2 „Ableitung“
3 „Elementare Logik“7
1) Die ersten beiden Jahre sind bei Louvier der empirischen Anschauung vorbehalten.8 Dabei ist „Anschauung“ für Louvier „keineswegs gleichbedeutend für den Begriff ‚Sehen’. Vielmehr ähnelt sie [die Anschauung, A. R.] der ‚Erfahrung durch die Sinne’“.9 Deshalb sollte der Lehrer Realia (womit reale oder modellhaft verkleinerte Gegenstände gemeint sind) in den Unterricht einbeziehen, um einen naturgemäßen Unterricht zu ermöglichen:
Der Lehrer hat die im Lehrbuche angeführten Gegenstände in die Klasse zu bringen, mit denselben die im Lehrbuch vorgeschriebenen Veränderungen vorzunehmen, und alsdann, aber erst dann den fremden Ausdruck an die Kinder in ganz ungezwungener Weise hinanzubringen und üben zu lassen. Dieser Ausdruck oder dieser Satz sagt aber sodann genau dasselbe, was als Gedanke bereits in den Kindern lebt, und muß deshalb sofort verstanden und vom Schüler gesprochen werden. Nie bringt die Lektüre etwas Neues oder Unverstandenes, wie im bisherigen Unterricht, weil sonst die deutsche Übersetzung erst den Sinn ergiebt, den die fremde Sprache nicht gab.10
2) In der Mittelstufe, also im Unterricht der beiden folgenden Jahresklassen „im dritten und vierten Jahre“11, folgt die Stufe der „Ableitung“.
Es handelt sich um „Begriffe abstrakter Natur, also abgeleitete Begriffe“, hierbei werden die in der ersten Stufe erlernten Begriffe im dritten und vierten Jahr dann „angewendet“.12 Jetzt lernen die Schüler u. a. die Konjugationen der Vergangenheit und grammatische und morphologische Strukturen kennen. Dabei sollen die Denkprozesse verfolgt werden, „die der Bildung neuer Wörter (Abstrakta) und neuer Formen (z. B. der Verbformen) zugrunde liegen.“13 Louvier beschreibt die Ableitung durch die „Erfahrung durch die Sinne“ exemplarisch wie folgt:
Hier muß es genügen, wenn ich aus den sinnlich-wahrnehmbaren, also durch Erfahrung erworbenen Begriffen: pauvre, bon, propre, beau, sain u. a., durch einen inneren, intellektuellen Vorgang die Abstrakta machen kann: pauvreté, bonté, propreté, beauté, santé u. a. – Dieser Vorgang aber ist der folgende: Das Kind wird durch Erfahrung dahin geführt, zu erkennen und zu sagen: der Tag ist schön, der Apollo ist schön, der Baum ist schön, der Gesang ist schön; sobald das Kind erkennt, daß schön (der Begriff) immer wiederkehrt, also aus der Vielheit eine Einheit wird, daß diese Einheit nur ein Merkmal hat, die Schönheit, in diesem Augenblick versteht der Schüler auch das Wort: la beauté, und mein Zweck für den Sprachunterricht ist erreicht. Nach demselben Gesetz entstehen die Abstrakta: pauvreté, bonté, propreté, santé, u. a., sogar mit derselben Endung té.14
3) In der dritten Stufe, im fünften Unterrichtsjahr, folgt schließlich die Stufe der „Logik“. Da sich nach Louvier die ersten beiden Stufen auf das Verstehen und Sprechen konzentrierten, also
der gesamte Sprachunterricht ein ausschließliches „Sprechen“ war, da alle Übung sich naturgemäß an das Hören und Sprechen, nie auf das Lesen (also ans Auge) richtete, so kann jetzt das dritte Hilfsmittel eingeführt werden, daß [sic, A. R.] ich nur sehr annähernd die „Logik“ nenne.15
Louvier beschreibt am Beispiel der Konjunktionen, wie abstrakte Begriffe, die nicht vom konkreten Begriff herzuleiten sind, durch fremdsprachliche Erklärungen vermittelt werden:
Weil, obgleich, während, denn, trotz u. s. w. sind nicht durch sinnliche Anschauung zu erfassen, weder im Begriff noch im Wort. Sie sind die Diener und auch die Geschöpfe einer Logik, die sich mit den Verhältnissen eines Gedankens zum anderen beschäftigen; sie sind zum Teil sogar die reinen Vertreter der reinen Verstandes-Kategorien16 (Kausalität), die sonst zwischen zwei Sätzen gar keinen Ausdruck fänden; sie sind, wie die Kategorien selbst transcendentaler Natur, und da die Anschauung hier versagt, eine begriffliche Ableitung nicht existieren kann, eine lautliche Ableitung sehr tief versteckt liegt, deshalb ist die logische Erfassung dieser Beziehungen zugleich die elementarste und die naturgemäße, und schon der so innerlich wichtigen Bindewörter wegen dürfte in einem vollständigen System nicht die Logik unter den sprachtreibenden Hilfsmitteln der Natur hinweggelassen werden.17
Im sechsten Jahr der Spracherlernung soll die Sprache
nunmehr selbst zum Objekt des Studiums gemacht werden: sie selbst wird zum Gegenstand der Betrachtung; nicht die Aneignung des fremden Ausdrucks ist das Ziel der nun folgenden Beschäftigung mit der Sprache, sondern der Inhalt ist es, d. h. der Schatz, den ein fremdes Volk in der Litteratur niedergelegt hat. Nicht die fremdländische Form wird gelernt, sondern ihre Abweichung vom Deutschen wird erkannt und erfaßt, es ergiebt sich eine Vergleichung zwischen dem Wesen der Muttersprache und dem der fremden; es gilt jetzt ferner eine annähernd freikünstlerische Übertragung desselben Gedankens aus der einen in die andere Sprache; denn beide sind nicht länger unbekannt; – es folgt endlich der erwachsene Schüler seinem Triebe nach Kritik, indem er an der erlernten fremden Sprache die Gesetzmäßigkeit folgernd erkennt […].18
Das (weitere) Studium einer bereits bekannten Fremdsprache als Objekt ist für Louvier die Kultur, und so folgt auf den naturgemäßen der kulturgemäße19 Unterricht. Louvier versucht, das Erlernen der französischen Sprache durch eine implizite Systematik einer Stufenfolge zu optimieren, wobei die lexikalischen und grammatischen Kenntnisse aufeinander aufbauen. Das Fehlen dieser Progression bei der naturgemäßen Versinnlichungsmethode der Philanthropen im 18. Jahrhundert bildet den Hauptunterschied zur direkten Methode des 19. und 20. Jahrhunderts.20 Bei Louviers sechsbändigem Lehrwerk basieren aber nur die beiden ersten Jahresbände auf der Anschauung.21
In Band 1 bringt der Lehrer Realia mit in die Klasse, wie beispielsweise das Modell einer kleinen Stadt (Lection 11):
Voilà une maison, voilà une église (üben!)
Qu’est-ce que cela? C’est une maison. Montre-moi la maison. Voilà la maison. Qu’est-ce que cela? C’est une église. Montre-moi une église. Voilà une église. Combien de maisons? Trois maisons. Combien de maisons? Deux maisons?
Combien de maisons? Une maison.22
In Band 2 werden Kurztexte wie kleine Lesestücke, Märchen, Anekdoten, Gedichte und Reime vorgestellt. Hierbei stehen Vokabelhilfen auf deutsch in Klammern und erinnern an die Interlinearversion der Hamilton-Jacotot-Methode.23
3. Le soir.
Petit enfant, déjà la brume (Dämmerung)
Autour de la maison s’étend (sich verbreitet):
On doit dormir quand vient la lune,
Petit enfant.24
Das Gedicht befindet sich mit am Ende des zweiten Bandes und ist wie das folgende Gedicht Le nom de Dieu ein Auszug aus der Comédie enfantine von Louis Ratisbonne. Es handelt sich um ein kindgemäßes Theaterstück mit Reimen, Gedichten und auch Liedelementen. Die Chanson du coquillage zum Schluss des Stücks wurde allerdings nicht bei Louvier abgedruckt.25
Im Band 326 findet man Lesetexte und landeskundliche Kurztexte, Band 4 enthält einige Gedichte Texte, Briefe, zwei Fabeln von La Fontaine, jedoch keine Lieder.27 Band 528 bietet längere historische Lesestücke, wobei Band 629 sich ausschließlich der Grammatik widmet und eine Anleitung für den Lehrer gibt. Die oben genannten Beispiele zeigen, dass alle Erklärungen und Lehrerhinweise in Louviers Lehrbüchern ausschließlich auf deutsch erfolgen. Damit besteht ein Widerspruch zwischen Louviers Theorie und seiner Unterrichtspraxis.30 Otto Wendt weist darauf hin,
daß sich das, was für das sieben- oder achtjährige Mädchen eignet, nicht ohne weiteres für den zwölfjährigen Schüler verwenden läßt. Immerhin lassen wir Louvier den Ruhm, die Mängel der rein grammatischen, mittelbaren Methode erkannt und Mittel und Wege gezeigt zu haben, durch die sich gewisse Ziele des ursprünglichen Unterrichts sicher erreichen lassen.31
II. 2. 2. 2 Ignaz Lehmann
Die unmittelbare Anschauung als Mittel zur Spracherlernung wurde in der Nachfolge Louviers von Felix Danicher in seiner Französischen Schreib-Lese-Fibel1 angewendet. Der Pfälzer Lehrbuchautor Ignaz Lehmann nutzte hingegen die mittelbare, auf Bilder beruhende Anschauung. Sein Lehr- und Lesebuch der französischen Sprache nach dem Anschauungsunterricht2 wurde von einigen Zeitgenossen als gelungene Realisierung einer Fremdsprachenlehrmethode3 betrachtet, die muttersprachenähnlich und „einsprachig“ ist. Lehmann war Vorsteher einer Knaben-Erziehungsanstalt in der Pfalz, also im Grenzbereich zu Frankreich. Sein 1868 erschienenes Lehrwerk teilt er wie Louvier seinen Stoff in eine Folge von sechs Stufen ein.4
Die erste Stufe nutzt die „directe Anschauung“5 , also unmittelbare Anschauung realer Gegenstände des Klassenzimmers. Der Lehrer zeigt auf diese Gegenstände und benennt sie in der Fremdsprache6 oder erklärt Vorgänge durch seine Mimik und Gestik. Danach wiederholen die Schüler das vom „Lehrer französisch Gesprochene […] laut, sei es einzeln, sei es im Chor, wobei wir nur die skrupulöseste Achtsamkeit auf die Aussprache empfehlen; unablässig und unermüdlich sei das Vorsagen, Verbessern, Nachhelfen, Wiederholen.“7 Erst danach wird das Buch geöffnet und „was dem Ohr und dem Munde geläufig geworden, auch dem Auge anvertraut.“8
Die zweite Stufe des Lehr- und Lesebuchs behandelt die mittelbare „Anschauung im Bilde“ anhand von Bildtafeln. Hierbei nutzt Lehmann selbstentworfene Bilder, die sich an den Winckelmannschen9 Jahreszeitenbildern orientieren. Lehmann hatte die 8 Xylographien bei der damals bekannten Verlagsbuchhandlung und xylographischen Anstalt Brend’amour in Düsseldorf in Auftrag gegeben, wobei auch sein Sohn Ernst Moritz an den Entwürfen beteiligt war.10
Die Jahreszeitenbilder stehen in direkter Beziehung zum täglichen Leben, wobei saisonale Tätigkeiten, Berufe und Handlungen dargestellt werden. Lehmanns sechs „Winke zur Beschreibung der Methode“11 erklären die Vorgehensweise, wobei ähnlich wie bei der ersten Stufe der direkten Anschauung verfahren wird, aber hierbei nicht anhand von Klassenobjekten, sondern Bildern:
Der Lehrer
1 benennt alle Gegenstände des Bilds und beschreibt die Tätigkeiten der Personen, welche Gegenstände vorhanden sind sowie deren Lage und Stellung. Danach sprechen die Schüler die Begriffe nach (einzeln, bank-, klassenweise, im Chor, solange bis diese Gegenstände „eben so geläufig in der französischen, wie in der deutschen Sprache benannt werden können.“12
2 Er geht näher ein auf „Kleidung, Theile, Miene […]. Alles so weit, als der Schüler davon durch die Annschauung Kenntniß nehmen kann.“ Dabei wird ausschließlich französisch gesprochen: „Nur wo Mißdeutung oder Nichtverstehen zu fürchten ist, bedient sich der Lehrer der Muttersprache.“13
3 Er gibt bei der zweiten Wiederholung weitere Erklärungen und überzeugt sich „durch französische Fragen, ob das Gehörte verstanden und behalten worden“ ist.
4 Er lässt die Fragen im Buch lesen und zuerst mündlich, dann schriftlich beantworten.
5 Er liest mit Schülern bereits längere, zusammenhängende Stücke. Einige Texte der folgenden Stufen werden jetzt bereits angewendet und „der Unterricht wechselt zwischen Anschauung im Bilde, Lesestücken und Gesprächen, Grammatik, Gedichten, Liedern und kleinen Aufsätzen ab […].“14
6 Er entscheidet über „die Verwendung der Noten und die Bemerkungen zu den durch den Druck ausgezeichneten Wörtern und Formen, sowohl was das Wie, als das Wann und Wieviel betrifft, bleiben dem Ermessen des Lehrers überlassen. Die Gedichte sind zum Theil memoriren zu lassen.“15
Hierbei erhalten Lieder erstmals eine (sinntragende) didaktische Funktion im Unterrichtsgang des Lehrer-Schüler-Gesprächs und fungieren parallel zur semantischen Bildfunktion, unterstreichen, illustrieren und festigen die Aussage der Bilder und (Induktions-) Texte.
Die „Dritte Stufe. Lectures Graduées et Causeries Enfantines.“ beinhaltet „Leichte, stufenmäßig geordnete Lesestücke und Gespräche.16 Lehmann schlägt Lesebuchtexte für einen systematischen Leseunterricht17 vor: „Das Lesestück wird so lange französisch gelesen, bis dies geläufig und ohne Fehler geschieht.“18 Allerdings erfolgt danach die (mündliche) Übersetzung ins Deutsche, anschließend „die Umsetzung der Erzählung in eine Conversation oder in Fragen, die der Lehrer oder ein Schüler an den anderen stellt,19 Umwandlung der Conversation in erzählende Rede, Nachahmung der Briefe.“20
Die Vierte Stufe. Gedichte und Lieder für Kinder. Poésies de l’Enfance et Morceaux de Chant.21 stellt Gedichte und Lieder vor, die anhand von Fragen und Gesprächen wie in den vorhergehenden Stufen erarbeitet werden. Die poetischen Stücke sollen „dazu genützt werden, um vorgerücktern Zöglingen die allgemeinsten Grundsätze und Regeln der französischen Dichtkunst anschaulich zu machen.“22 Die Gedichte werden „theilweise zum Memoriren, sämmtlich zur Lectüre und zur Conversation und für Gereiftere zum Ausarbeiten oder zur Nachahmung in (deutscher und französischer) Prosa“23 empfohlen. Interessanterweise ist der Text des 41. Gedichts Ma Germanie24 (Abb. 13, S. 184) identisch mit Frédéric Bérats bekanntem Volkslied Ma Normandie, das als prototypisches Lied25 in vielen Lehrbüchern und Liedersammlungen für den Französischunterricht verwendet wurde.
Der Text des 18. Gedichts Le Petit Pierre (Abb. 14, S. 185) ist Teil eines Erzählstranges über ehrliche Arbeit und Fleiß, Tugenden, die im Vorfeld durch die Fabeln von Lafontaine im Text 15. La Cigale et la Fourmi und 16. L’Abeille et la Fourmi illustriert worden sind. In verschiedenen Französischlehrbüchern wurde der beliebte Text mit Melodie abgedruckt.26 Der zugrunde liegende deutsche Text stammt von Ludwig Höltys Gedicht Der alte Landmann an seinen Sohn, in dem die preußischen Tugenden zusammengefasst wurden. Der Text war als Üb immer Treu und Redlichkeit27 Teil der obligatorischen Schulgedichte und -lieder. In den preußischen Lesebüchern, wie bei Wetzels für die Volksschule bestimmtem Berliner Schul-Lesebuch,28 das zehn Jahre vor Lehmanns Lehr- und Lesebuch der Französischen Sprache erschien, wurden die obligatorischen Schullieder mit Asterisk extra hervorgehoben:
Die mit * versehenen Stücke sind Texte von Schulliedern, welche nach der Verfügung des Königlichen Schul-Colegii der Provinz Brandenburg vom 20. Juni 1851 in den Schulen gesungen werden sollen. Die anderen Gedichte sind mit † bezeichnet.29
 Abb. 13:
Abb. 13:
41. Ma Germanie. In: Ignaz LEHMANN, Lehr- und Lesebuch der französischen Sprache. Nach der Anschauungs-Methode und nach einem ganz neuen Plane, mit Bildern, unter Benützung der neuesten und besten französischen und deutschen Jugendschriften bearbeitet. Mannheim: J. Bensheimer 1868, S. 306.
 Abb. 14:
Abb. 14:
18. Le Petit Pierre. In: Ignaz LEHMANN, Lehr- und Lesebuch der französischen Sprache. Nach der Anschauungs-Methode und nach einem ganz neuen Plane, mit Bildern, unter Benützung der neuesten und besten französischen und deutschen Jugendschriften bearbeitet. Mannheim: J. Bensheimer 1868, S. 287.
Im Rahmen der neusprachlichen Reformbewegung wurde dieses Lied in Französischlehrwerken mit anderen Liedern bzw. Texten und dem Frühlingsbild assoziiert.30 Lehmann verwendet zum Liedeinsatz die dreibändige Liedersammlung von Laurent Delcasso und Pierre Gross.31 Dabei hat er Auszüge des Avant-propos der Liedersammlung übernommen und, wie auch die Lieder selbst, teilweise adaptiert:
Note. L’Allemagne possède, pour les écoles primaires, toute une littérature lyrique du plus grand prix. Des mélodies à la fois simples et riches y sont associées à des paroles tour à tour graves ou légères, gaies ou mélancoliques, mais toujours morales.32 Les petits poëmes adaptés à la musique naïve et suave ont un charme de sentiment et une élévation de pensée qu’on ne rencontre pas d’ordinaire dans les chansonnettes françaises.
Dans toute l’Allemagne,33 on entend souvent, dans les villes et dans les campagnes, la jeunesse répéter en chœur, avec un accord remarquable ce couplets qui, sous une forme familière, prêchent l’amour du travail et des vertus privées, le goût des plaisirs champêtres, le dévouement à la patrie, la beauté de la nature, la grandeur et les bienfaits de Dieu.34
Von den 22 in Partitur unter der Rubrik Morceaux de Chant abgedruckten Volks- und Kinderliedern wurden bei Lehmann 13 Lieder im Rahmen der 2. Stufe im Abschnitt zur Anschauung im Bilde bei der Besprechung der Jahreszeitenbilder verwendet.35 Im Folgenden soll am Frühlingsbild das Zusammenspiel der verschiedenen Textsorten mit dem Liedeinsatz exemplarisch aufgezeigt werden (Abb. 15, 16, 17).
 Abb. 15:
Abb. 15:
Ignaz LEHMANN, Lehr- und Lesebuch der französischen Sprache. Nach der Anschauungs-Methode und nach einem ganz neuen Plane, mit Bildern, unter Benützung der neuesten und besten französischen und deutschen Jugendschriften bearbeitet. Mannheim: J. Bensheimer 1868, S. 309.
 Abb. 16:
Abb. 16:
Ignaz LEHMANN, Lehr- und Lesebuch der französischen Sprache. Nach der Anschauungs-Methode und nach einem ganz neuen Plane, mit Bildern, unter Benützung der neuesten und besten französischen und deutschen Jugendschriften bearbeitet. Mannheim: J. Bensheimer 1868, S. 97.
 Abb. 17:
Abb. 17:
Ignaz LEHMANN, Lehr- und Lesebuch der französischen Sprache. Nach der Anschauungs-Methode und nach einem ganz neuen Plane, mit Bildern, unter Benützung der neuesten und besten französischen und deutschen Jugendschriften bearbeitet. Mannheim: J. Bensheimer 1868, S. 102.
Auch das zweite Frühlingsbild (Abb. 15) wird bei Lehmann nach den 6 unterrichtsmethodischen „Winken“36 bearbeitet. Der Lehrer benennt dabei alle Gegenstände, Tiere und Tätigkeiten. Die Personen, Tiere, Objekte und Gegenstände sind mit Kennziffern bezeichnet, um im späteren Gespräch darauf einzugehen und nicht den Umweg über die Muttersprache zu nehmen. Als Bildgattung handelt es sich hierbei um einen Vorläufer der Abbildungen in den Bildwörterbüchern und des Bilder-Dudens, der später auch als Duden français herausgegeben wurde.37 Dadurch wird eine direkte Kommunikation in der Fremdsprache ermöglicht. Die (fremdsprachigen) Erklärungen enthalten Fußnoten mit Paraphrasierungen auf französisch und teilweise auf deutsch, wenn es nicht aus dem Kontext erschließbar ist. Darauf folgen Fragen, die gelesen, dann mündlich und schriftlich beantwortet werden.38
Die Vermittlung des neuen Vokabulars erfolgt induktiv im Lehrer-Schüler-Gespräch nach den Grundsätzen Vom Nahen zum Fernen, Vom Eigenen zum Fremden39, Vom bekannten Vokabular zu neuen Formen. Bei der Beschreibung des Bienenstocks40 wird beiläufig, gewissermaßen als inzidentelles Lernen,41 ohne bewusstes Einprägen das Lied Abeille42 vorgestellt, das den Schülern in deutscher Fassung als Kinderlied Summ, summ, summ bekannt ist. Lehmann gibt hierbei keinen Verweis auf das deutsche Lied. Es erfolgt kein direkter Übersetzungshinweis. Die Onomatopöien Bour, bour, bour und die Beziehung zu Abeille lassen jedoch sofort eine Assoziation43 zum deutschen, vertrauten, weil bekannten Lied zu. Diese wird durch die Melodie, die unter Stufe IV Morceaux de Chant abgedruckt ist,44 noch verstärkt. Die internalisierte Melodie des Kinderlieds erleichtert es den Kindern, das Lied im Chor zu singen. Das Chorsingen ersetzt hier das Chorsprechen.
Es folgen detaillierte enzyklopädische Informationen45 zu Abeille, die sowohl auf die Tradition der Enzyklopädisten verweisen als auch an die Philanthropen erinnern, wie beispielsweise die realienkundlichen Lehrbücher von Rochow oder Hauchecornes utilitaristische Verwendung von Realien in seinen Lectures pour la jeunesse.46 Im Laufe der Beschreibung und Besprechung von Le coq wird eine Verknüpfung mit dem Gesang kreiert und dadurch die Überleitung zum Kinderlied geschaffen:
Le coq chante la nuit comme le jour, aussi le regardait-on dans l’antiquité comme le symbole de la vigilance, et il est dans les campagnes encore aujourd’hui l’horloge du matin.
Certainement vous entendrez avec plaisir une chansonnette sur un de ces animaux fiers, qui a failli devenir la proie du rusé renard.“47
Warum wurde im Kinderlied aber die Gans durch den Fuchs ersetzt? Alle Schüler kennen dieses Volkslied. Es könnte am inoffiziellen National-Symbol des Hahns für Frankreich (coq < lat. GALLUS) liegen. Wahrscheinlicher ist jedoch wohl die Erklärung, dass keine Gans auf dem Bild vorhanden ist.
Mit der Übernahme des Kontrafakturverfahrens von deutschen Volksliedmelodien mit französischem Text nach Delcasso / Gross und deren Anwendung bei der Bildbesprechung steht Lehmann am Anfang einer Strömung, die im Rahmen der neusprachlichen Reformbewegung eine wichtige Rolle im Methodenstreit48 einnehmen wird.
Bereits ein Jahrhundert vor Ignaz Lehmann setzte der französische „reformatorisch angehauchte“49 Sprachmeister und „strebsame Lektor“ an der Universität Gießen François Thomas Chastel aus dem Deutschen ins Französische übersetzte Lieder nach dem Kontrafaktur-Verfahren unter Verwendung bekannter Melodien ein:
Auf alle Arten suchte er in seinen Schülern Liebe für das Erlernen seiner Muttersprache zu erwecken und zu erhalten, ihnen, vor allem den Anfängern, Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen.[…]. – Sicher auch zur Belebung des Unterrichts – es ist eben alles schon einmal dagewesen – begann er 1785, deutsche Gedichte und eine größere Anzahl Lieder ins Französische zu übertragen, so das „Rheinweinlied“ („Bekränzt mit Laub“) von M. Claudius und den Rundgesang des Grafen von Stollberg („Fröhlich tönt der Becherklang“). Da er „dasselbe Sylbenmaß beybehielt, welches die deutschen Originale haben, können diese Lieder französisch nach ebender Melodie gesungen werden, wie in der deutschen Sprache“. Auf dieselbe Art übersetzte er die „beliebten Kaplieder von Schubart“ („Auf, auf! Ihr Brüder!“ – „Auf, auf! Kameraden!“) und gab sie 1789 mit Noten für Klavier heraus. Ganz folgerichtig führten ihn diese Bestrebungen auch dazu, 1788 eine auserlesene Sammlung französischer Originallieder zu veröffentlichen.50
Wie schon Alwin Lehmann 1904 feststellte, sind „aber alle diese Bücher Chastels nicht mehr vorhanden“51 und konnten auch nach meinen Recherchen nicht gefunden werden.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.