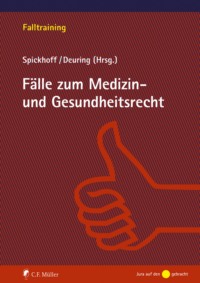Kitabı oku: «Fälle zum Medizin- und Gesundheitsrecht, eBook», sayfa 12
IV. Rechtswidrigkeit
Die Rechtsgutsverletzung indiziert grundsätzlich die Rechtswidrigkeit.[20] Vorliegend könnte sich dies durch eine rechtfertigende Einwilligung der P ändern. Fraglich ist, ob P wirksam eingewilligt hat.
Exkurs: Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung und Hierarchie der Entscheidungsmaßstäbe bei Einwilligungsfähigkeit bzw. Einwilligungsunfähigkeit
Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung:
1. Zulässigkeit der Einwilligung
Eine Einwilligung in eine Tötung ist unwirksam (§ 216 StGB). Bei einer Verletzung von Körper und Gesundheit ist – vorbehaltlich der Sittenwidrigkeitsgrenze (vgl. §§ 228 StGB, 138 BGB[21]) – die Einwilligung grundsätzlich zulässig. Sittenwidrig ist grundsätzlich die Einwilligung in eine Körperverletzung, die erhebliche körperliche Schäden anrichten kann. Eine solche negative Bewertung kann aber durch einen positiven oder jedenfalls einsehbaren Zweck kompensiert werden, sodass selbst bei schwerwiegenden Rechtsgutseingriffen der Bereich der freien Disposition des Rechtsgutsinhabers nicht überschritten wird, wenn ein positiv kompensierender Zweck hinzukommt, wie z.B. bei lebensgefährlichen ärztlichen Eingriffen, die zum Zwecke der Lebenserhaltung vorgenommen werden.[22]
2. Verfügungsberechtigung
Verfügungsberechtigt ist grundsätzlich der jeweilige Rechtsgutsinhaber, in manchen Fällen aber auch derjenige, dem die Rechtsmacht hierzu erteilt wurde (im Rahmen von Betreuungen (§§ 1896 ff. BGB) und Vorsorgebevollmächtigten (§ 1901c BGB) etwa der Betreuer bzw. Bevollmächtigte, ebenso Eltern für ihre nichteinwilligungsfähigen Kinder (§ 1626 ff. BGB), str. bei einwilligungsfähigen Kindern).[23]
3. Einwilligung in die verletzende Handlung zur Tatzeit
Die Einwilligung muss sich auf die verletzende Handlung zur Tatzeit beziehen.
4. Wirksamkeit der erklärten Einwilligung
Die Einwilligung muss überdies alle Wirksamkeitserfordernisse erfüllen, also vor der Tat von einer einwilligungsfähigen Person, freiwillig und nach vollständiger Aufklärung erklärt worden sein.
a. Erklärung vor der Tat
Die Einwilligung muss zur Wirksamkeit vor der Verletzungshandlung abgegeben werden.
b. Einwilligungsfähigkeit
Einwilligungsfähigkeit setzt die auf geistiger und sittlicher Reife beruhende Einsichtsfähigkeit und Urteilskraft voraus, die Bedeutung und Tragweite des Eingriffs und seiner Gestattung zu ermessen und seinen Willen hiernach auszurichten.[24] Einwilligungsfähigkeit ist nicht gleichzusetzen mit Geschäftsfähigkeit.
c. Freiwilligkeit
Die Einwilligung muss freiwillig sein, sodass die durch Gewalt, Zwang, rechtswidrige Drohung oder arglistige Täuschung herbeigeführte zustimmende Willensbildung nicht genügt.[25] Dann kann die Willensentschließung nicht mehr als Ausfluss einer eigenen wahren inneren Willensbildung des Betroffenen gelten.[26] Umstritten ist, welche Irrtümer die Wirksamkeit der Einwilligung tangieren. Der BGH führt aus, „einfache“ Irrtümer, die nach den Regeln des § 119 BGB zur Anfechtung von Willenserklärungen führen könnten, genügen nicht, um die Wirksamkeit der Einwilligung in Frage zu stellen. Auch berechtigen sie nicht zur Anfechtung der Einwilligung: Eine Anfechtung scheide schon deshalb aus, weil die Einwilligung keine Willenserklärung ist.[27] Ein Irrtum des korrekt aufgeklärten Patienten nehme der Einwilligung daher nicht die Wirksamkeit.[28] Teils wird weniger auf die Art des Irrtums (Motiv-, Erklärungs- oder Inhaltsirrtum) abgestellt, sondern vielmehr auf den Bezugspunkt: Relevant, d.h. zur Unwirksamkeit ipso iure führend, sind hiernach sog. rechtsgutsbezogene Irrtümer, also etwa Irrtümer über den Zweck einer ärztlichen Maßnahme.[29] Andere Autoren wiederum befürworten eine Anwendung der §§ 119 f. BGB.[30]
d. Aufklärung (sog. Selbstbestimmungsaufklärung), §§ 630d Abs. 2, 630e BGB
Voraussetzung einer jeden Einwilligung in einen medizinischen Eingriff ist eine vorangegangene wirksame Aufklärung.
(aa. Analoge Anwendbarkeit der §§ 630d Abs. 2, 630e BGB im Deliktsrecht)
Eine analoge Anwendung der Normen setzt voraus, dass eine planwidrige Regelungslücke besteht und die Interessenlagen vergleichbar sind.
Eine Regelungslücke besteht, da die Anforderungen an eine wirksame Aufklärung im Vertragsrecht kodifiziert wurden.
Auch sind die Interessenlagen vergleichbar: Als Kodifikation der Rechtsprechung zur Einwilligung in deliktische Handlungen betreffen die §§ 630d Abs. 2, 630e BGB eben diesen Bereich.[31]
Im Ergebnis sind die Regelungen über die Aufklärung, §§ 630d Abs. 2, 630e BGB im Rahmen deliktischer Ansprüche (analog) anwendbar.
bb. Person des Aufklärenden und Aufklärungsadressat
Grundsätzlich muss gem. § 630e Abs. 1 S. 1 BGB der Behandelnde selbst den Patienten aufklären. Eine Ausnahme davon sieht §§ 630e Abs. 4, 630d Abs. 1 S. 2 BGB für den einwilligungsunfähigen Patienten vor: Aufklärungsadressat ist dann der zur Einwilligung „Berechtigte“.
cc. Form
Die Aufklärung muss zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten eine bestimmte Form nach § 630e Abs. 2 BGB (analog) einhalten.
Die Aufklärung muss mündlich erfolgen, § 630e Abs. 2 Nr. 1 Hs. 1 BGB, ergänzend kann auch auf ausgehändigte Unterlagen Bezug genommen werden, § 630e Abs. 2 Nr. 1 Hs. 2 BGB.
Nach § 630e Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BGB muss die Aufklärung so rechtzeitig erfolgen, dass der Einwilligende seine Entscheidung über die Einwilligung wohlüberlegt treffen kann. Dabei wurden bewusst keine pauschalen Fristen festgelegt, um die notwendige Flexibilität nicht einzuengen.[32] Bei operativen Eingriffen soll nach der Gesetzesbegründung eine Aufklärung am Vortag des Eingriffs ausreichend sein.[33]
Die Aufklärung muss für den Empfänger zudem verständlich sein, § 630e Abs. 2 Nr. 3 BGB. Dabei müssen die ärztlicherseits mitgeteilten bzw. mitzuteilenden Informationen sprachlich wie inhaltlich an dessen Empfängerhorizont ausgerichtet sein.[34]
dd. Inhalt
Es muss über die für die Einwilligung wesentlichen Umstände und unter anderem die zu erwartenden Folgen und Risiken der Maßnahme aufgeklärt werden, § 630e Abs. 1 BGB. Die Aufklärung hat sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände zu umfassen, § 630e Abs. 1 S. 1 BGB. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie, § 630e Abs. 1 S. 2 BGB, und Behandlungsalternativen, § 630e Abs. 1 S. 3 BGB. Für den Patienten geht es dabei stets darum, sich zwischen Optionen zu entscheiden, ob zwischen verschiedenen Formen der Behandlung oder zwischen der einzig möglichen und dem Nichtstun.[35] Zur Ermöglichung einer selbstbestimmten Patientenentscheidung muss der Arzt dem Patienten die hierfür notwendigen Entscheidungsprämissen vermitteln.[36]
Insbesondere hat der Arzt die Pflicht, dem Patienten eine allgemeine Vorstellung von der Schwere des Eingriffs und den spezifischen Risiken zu vermitteln. Maßgeblich für die Frage, ob über ein bestimmtes Risiko aufgeklärt werden muss, ist, ob das betreffende Risiko dem Eingriff spezifisch anhaftet und es bei der Verwirklichung die Lebensführung des Patienten besonders belasten kann. Bei einem dringlich indizierten Eingriff muss die Aufklärung unter Umständen weniger umfassend ausfallen als bei einem aufschiebbaren, § 630e Abs. 3 BGB e contrario.[37] Dagegen ist aber nicht über jede entfernt liegende Möglichkeit eines Risikos aufzuklären.[38] Die Rechtsprechung beurteilt die Aufklärungspflichtigkeit eines Risikos anhand der Dringlichkeit und der Aufschiebbarkeit des Eingriffs, anhand von Vorkenntnissen des Patienten, der medizinischen Indikation, der Schwere und der Sichtbarkeit der Folgen sowie der Häufigkeit der Realisierung eines Risikos.[39]
ee. Keine Entbehrlichkeit der Aufklärung
Der Patient kann auch auf die Aufklärung verzichten, § 630e Abs. 3, 2. Alt. BGB, bzw. diese kann aufgrund besonderer Umstände entbehrlich sein, § 630e Abs. 3, 1. Alt. BGB.[40]
Hierarchie der Entscheidungsmaßstäbe: [41]
Maßgeblich für das Vorgehen des Arztes ist bei volljährigen einwilligungsfähigen Personen ausschließlich deren Willen, also deren Einwilligung nach dem eben dargestellten Schema, gleich wie unvernünftig ihr Wille sein mag (Grenze aber: Sittenwidrigkeit).[42]
Ist der Patient nicht einwilligungsfähig, ist zunächst danach zu fragen, ob eine Patientenverfügung (§ 1901a BGB) die Situation erfasst. Ist dies der Fall, muss sich der Arzt an diese Verfügung halten.[43]
Liegt keine Patientenverfügung vor, die die Situation erfasst, ist nach § 630d Abs. 1 S. 2 BGB die Einwilligung des „hierzu Berechtigten“ einzuholen. Dies ist zunächst der vom Patienten Bevollmächtigte (siehe § 1901c BGB zur Vorsorgevollmacht) bzw., wurde niemand bevollmächtigt, schließlich ggf. der von Gesetzes wegen eingesetzte Betreuer (§§ 1896 ff. BGB).[44]
Auf die mutmaßliche Einwilligung des Patienten (§ 630d Abs. 1 S. 4 BGB) kann nur als allerletzter Maßstab zurückgegriffen werden, nämlich dann, wenn nicht abgewartet werden kann, dass der Patient wieder aufwacht und selbst einwilligt, wenn auch keine Patientenverfügung vorliegt und auch niemand vom Patienten bevollmächtigt wurde, und wenn der Eingriff zudem so dringlich ist, dass selbst eine Betreuerbestellung nicht mehr möglich ist.[45]
Bei Minderjährigen sind bei Einwilligungsunfähigkeit die Eltern zur Einwilligung berechtigt (§§ 1626, 1629 BGB), wobei sie ihre Entscheidung am Kindeswohl auszurichten haben (§ 1627 S. 1 BGB). Ist der Minderjährige selbst einwilligungsfähig, ist umstritten, ob der Minderjährige allein in Behandlungen einwilligen kann oder ob er zusätzlich die Zustimmung seiner gesetzlichen Vertreter benötigt (Co-Konsens).[46]
1. Einwilligung
a) Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung
P kann, da sie selbst über ihren Körper dispositionsbefugt ist, in ärztliche Behandlungen, also auch in die Vergabe von Medikamenten, einwilligen. Auch sind insbesondere an ihrer Einwilligungsfähigkeit und der Freiwilligkeit ihrer Einwilligung keine Zweifel anzumelden.
b) Insbesondere: Ordnungsgemäße Aufklärung, §§ 630d Abs. 2, 630e BGB
Allerdings ist fraglich, ob P ordnungsgemäß aufgeklärt wurde, §§ 630d Abs. 2, 630e BGB analog. Ist dies nicht der Fall, ist die Einwilligung der P unwirksam.
aa) Analoge Anwendbarkeit der §§ 630d Abs. 2, 630e BGB im Deliktsrecht
Die Regelungen die Aufklärung, §§ 630d Abs. 2, 630e BGB, sind im Rahmen deliktischer Ansprüche analog anwendbar (siehe Kasten).
bb) Person des Aufklärenden und Aufklärungsadressat
Nach § 630e Abs. 1 S. 1 BGB analog muss der Behandelnde selbst oder eine dazu befähigte Person (§ 630e Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB) den Patienten aufklären. Vorliegend klärte F die P als Patienten auf und verordnete auch das Medikament als Behandlungsleistung. Die Person des Aufklärenden und des Aufklärungsadressaten entsprechen mithin dem von § 630e Abs. 1 S. 1 BGB – hier in analoger Anwendung – definierten Grundfall.
cc) Form
Die Aufklärung muss zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten mündlich, rechtzeitig und verständlich, § 630e Abs. 2 BGB analog, erfolgen. Dies ist vorliegend zu unterstellen.
dd) Inhalt
Es muss über die für die Einwilligung wesentlichen Umstände und unter anderem über die zu erwartenden Folgen und Risiken der Maßnahme aufgeklärt werden, § 630e Abs. 1 BGB. Es besteht also eine Pflicht des Arztes, dem Patienten eine allgemeine Vorstellung von der Schwere des Eingriffs und den spezifischen Risiken zu vermitteln.
Vorliegend stellt sich die Frage, ob eine Pflicht der F bestand, über das Infarktrisiko gem. § 630e Abs. 1 S. 1 und S. 2 BGB analog aufzuklären. Maßgeblich für den Umfang der Aufklärung sind verschiedene Aspekte, wie die Dringlichkeit des Eingriffs, Aufschiebbarkeit, Vorkenntnisse des Patienten, medizinische Indikation, Schwere und Sichtbarkeit der Folgen sowie die Häufigkeit eines Risikos (siehe Kasten). Für eine Aufklärungsbedürftigkeit ist anzuführen, dass das Infarktrisiko als typisches Risiko des Antikonzeptionsmittels bekannt war und P der Risikogruppe (über 30 Jahre alt und Raucherin) angehörte. Das Risiko war für den Eintritt des Hirninfarkts also gerade bei Einnahme dieses Medikaments nicht derart unwahrscheinlich, dass darüber nicht aufgeklärt werden hätte müssen. Vielmehr handelte es sich um ein für dieses Medikament spezifisches Risiko. Die Verordnung des Präparats war überdies nicht von besonderer Dringlichkeit. Schließlich sind die möglichen Folgen einer Verwirklichung des Risikos bereits allgemein wie auch konkret für die betroffene P als sehr schwerwiegend einzustufen. So kann ein nicht erkannter wie nicht adäquat behandelter Schlaganfall zum Tode führen. Auch anderweitige Folgen eines Hirninfarktes (Sprachstörungen etc.) beeinträchtigen die weitere Lebensführung des Betroffenen in erheblichem Maße. Bei einer Gesamtschau der Abwägungskriterien hätte die F über das Risiko eines Hirninfarkts aufklären müssen.
Fraglich ist, ob dieser Aufklärung schon durch die Nennung des Risikos in der Packungsbeilage nachgekommen wurde. Freilich kann ein Arzt nicht über alle in der für gewöhnlich sehr umfangreichen Packungsbeilage genannten Risiken aufklären, da dies das Aufklärungsgespräch unangebracht ausdehnen würde. Vorliegend gehört die P aber zu einer sehr konkret benannten Risikogruppe einer schwerwiegenden Komplikation. Es kann gerade nicht davon ausgegangen werden, dass der Patient die in einer Packungsbeilage genannten Risiken zur Kenntnis nimmt. Denn bei einer lebensnahen Betrachtung lesen wohl die wenigsten Patienten die Informationen aufmerksam durch, zumal der P das Medikament vorliegend verschrieben wurde und sie somit von einer gefahrlosen Einnahme ausgehen durfte. Nur wenn P von F ordnungsgemäß, mithin auch über das Infarktrisiko, aufgeklärt worden wäre, hätte sie von ihrem Selbstbestimmungsrecht in freier Entscheidung Gebrauch machen können und die bestehenden Risiken entsprechend abwägen können. Auf dieser Grundlage hätte P sodann eine Entscheidung über die Medikation oder das Einstellen des Rauchens treffen können.
Die Aufklärung genügt im Ergebnis folglich nicht den Voraussetzungen der §§ 630d Abs. 2, 630e BGB analog.
c) Zwischenergebnis
Mangels ordnungsgemäßer Aufklärung ist die erklärte Einwilligung in die Maßnahme wirkungslos.
2. Mutmaßliche Einwilligung, § 630d Abs. 1 S. 4 BGB analog
Die Verletzungshandlung der F könnte durch eine mutmaßliche Einwilligung gem. § 630d Abs. 1 S. 4 BGB analog gerechtfertigt sein.
Exkurs: Voraussetzungen der mutmaßlichen Einwilligung
(1. Analoge Anwendung des § 630d Abs. 1 S. 4 BGB im Deliktsrecht)
§ 630a Abs. 1 S. 4 BGB kann im Deliktsrecht analog angewendet werden, da es sich ohnehin um die Kodifikation der Rechtsprechung zum Deliktsrecht handelt.
2. Keine Möglichkeit der Willensbildung/-äußerung des Betroffenen
Beispiele: Patient bewusstlos, im Zustand der Einwilligungsunfähigkeit und weder Patientenverfügung angefertigt noch Vorsorgevollmacht erteilt[47]
3. Dringliche und unaufschiebbare Maßnahme (Notfall mit Gefahr in Verzug)
Eine Maßnahme ist dringlich und unaufschiebbar, wenn weiteres Zuwarten das Leben oder die Gesundheit des Patienten gefährden würde, weil:[48]
| - | ein Unfall geschehen ist; |
| - | eine Operationserweiterung notwendig ist, da z.B. weitere Krankheitsherde entdeckt wurden, die schnell entfernt werden müssen → Aber Achtung! Der Arzt muss die Entstehung von Situationen, die eine mutmaßliche Einwilligung notwendig machen können, nach Möglichkeit vermeiden. Wenn schon vorher die ernsthafte Möglichkeit einer Operationserweiterung besteht, dann muss der Arzt hierzu schon vorsorglich eine Einwilligung einholen. Wenn gewartet werden kann, bis der Patient wieder bei Bewusstsein ist, muss auch dies abgewartet werden und der Patient dann aufgeklärt und die Einwilligung eingeholt werden. |
Auf eine mutmaßliche Einwilligung kann nicht rekurriert werden, wenn zwar der Patient voraussichtlich länger bewusstlos sein wird, aber die Zeit ausreicht, um im Wege einer einstweiligen Anordnung nach § 300 FamFG einen vorläufigen Betreuer zu bestellen.[49]
4. Übereinstimmung mit dem mutmaßlichen Willen des Rechtsgutsträgers
Problematisch ist stets die Bestimmung des mutmaßlichen Willens. Den Wünschen den Patienten muss so weit als möglich Rechnung getragen werden. Wenn sich etwa der Patient in anderen Zusammenhängen ablehnend gegenüber bestimmten Maßnahmen geäußert, darf sich der Arzt darüber nicht hinwegsetzen. Fehlen jedoch Anhaltspunkte bzgl. des wirklichen Willens, muss anhand eines objektiven Maßstabs entschieden werden (Abwägung Nutzen/Risiko). Die Entscheidung des Arztes ist dabei zu respektieren, wenn sie sich im Rahmen des objektiv Vertretbaren hält.[50]
a) Analoge Anwendung des § 630d Abs. 1 S. 4 BGB im Deliktsrecht
§ 630d Abs. 1 S. 4 BGB kann im Deliktsrecht analog herangezogen werden.
b) Keine Möglichkeit der Willensbildung/-äußerung des Betroffenen
Wichtigste Voraussetzung der mutmaßlichen Einwilligung als Ausdruck der strengen Subsidiarität gegenüber einer geäußerten Einwilligung ist die fehlende Möglichkeit der Bildung und Äußerung eines eigenen Willens des Betroffenen.[51] Daran fehlt es vorliegend bereits. Die P war bei Verordnung des Medikaments bei vollem Bewusstsein und hätte (bei ordnungsgemäßer Aufklärung) in die Maßnahme einwilligen können.
c) Dringliche und unaufschiebbare Maßnahme
Es handelte sich auch nicht um eine dringende oder unaufschiebbare Maßnahme.
d) Zwischenergebnis
Eine mutmaßliche Einwilligung scheidet vorliegend eindeutig aus.
3. Hypothetische Einwilligung, § 630h Abs. 2 S. 2 BGB analog
Von der mutmaßlichen Einwilligung zu unterscheiden ist der in § 630d BGB nicht eigens aufgegriffene Einwand der hypothetischen Einwilligung.[52] Erwähnt wird dieser ausschließlich in § 630h Abs. 2 S. 2 BGB als Form der Beweiserleichterung, kann aber nach (strafrechtlicher) Rechtsprechung einen Rechtfertigungsgrund darstellen[53] bzw. im Rahmen der vertraglichen Haftung der Kategorie des rechtmäßigen Alternativverhaltens zugeordnet werden.[54] Durch den Einwand der hypothetischen Einwilligung macht der Arzt geltend, der Patient hätte auch bei ordnungsgemäßer Aufklärung in den Eingriff eingewilligt. Dieser Einwand dient einerseits dazu, eine missbräuchliche Berufung auf fehlende oder unzulängliche Aufklärung zu begegnen, muss aber andererseits auch gewährleisten, dass auf diese Weise nicht das Selbstbestimmungsrecht des Patienten unterlaufen wird.[55]
Exkurs: Voraussetzungen der hypothetischen Einwilligung
(1. Analoge Anwendung des § 630h Abs. 2 S. 2 BGB im Deliktsrecht)
2. Keine den Voraussetzungen des § 630e BGB genügende Aufklärung
3. (Hypothetische) Einwilligung des Patienten auch bei (hypothetischer) ordnungsgemäßer Aufklärung
→ Mehrstufiges Beweisverteilungssystem

[Bild vergrößern]
a) Analoge Anwendung des § 630h Abs. 2 S. 2 BGB im Deliktsrecht
§ 630h Abs. 2 S. 2 BGB kann im Deliktsrecht analoge Anwendung finden.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.