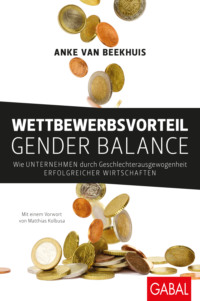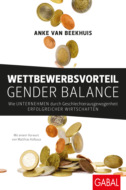Kitabı oku: «Wettbewerbsvorteil Gender Balance», sayfa 4
Wie Mama und Papa – die Macht der Sozialisierung
Ich bin mit zwei älteren Brüdern groß geworden und habe hautnah erlebt, wie es ist, als Mädchen »schubladisiert« zu werden. Meine Brüder bekamen sich täglich in die Haare und trugen dies handgreiflich aus. Das war für alle Beteiligten völlig normal. Doch ging ich einmal meinen Brüdern wortwörtlich »an die Gurgel«, war das sofort Gesprächsthema Nummer eins in der Familie. Obwohl meine Mutter ihr Leben lang berufstätig war und als selbstbewusste Frau auftrat, wurde mir durch die Frauen in meiner Familie vermittelt, wie ich zu sein habe: »Lerne kochen und wie man Haus- und Gartenarbeit erledigt. Es ist wichtig, dass du das kannst«, war eine oft gehörte Aussage. Als Achtjährige erhielt ich zu Weihnachten dann auch von meiner Tante ein Kochgeschirr mit dem Hinweis: »Du wirst das später benötigen.« In Salzburg und Oberösterreich war vor 30 Jahren die »Aussteuer« noch üblich: Junge Frauen bekamen Hand- und Geschirrtücher sowie Bettwäsche für den zukünftigen eigenen Haushalt. Mit zwölf Jahren verweigerte ich jedes Geschenk dieser Art und emanzipierte mich von den Frauen in meiner Familie.

»Jungendinge« und »Mädchendinge«
Es war damals auch außergewöhnlich, wenn Mädchen mit Autos spielten und aufmüpfig waren und Burschen mit dem Puppenwagen durch die Gegend fuhren. Oder noch schlimmer: Wenn Jungs Nagellack auftrugen oder sich als Mädchen verkleiden wollten. Und auch heute noch steckt in uns das klassische Rollenbild, das eine Frau und ein Mann zu verkörpern haben. Natürlich hat sich das über Jahre verändert und die Grenzen verschwimmen ein wenig. Aber die eiserne Regel »Mädchen sind rosa und Jungs sind blau« hält sich hartnäckig. Nicht, dass daran etwas schlecht wäre – aber Menschen werden so in Rollen gedrängt und dabei sozialisiert. Dies wiederum führt dazu, dass man sich nur innerhalb bestimmter Stereotype bewegt, ohne das »andere« überhaupt jemals auszuprobieren. Oder wann haben Sie das letzte Mal als Mann Nagellack aufgetragen? Oder als Frau Fliesen verlegt? Noch nie? Dann wäre es an der Zeit, den klassischen Käfig der Pink-Blau-Rollensozialisierung zu durchbrechen.
Sehen Sie sich einmal Ihren Alltag an: Was leben Sie Ihren Kindern als klassische Rolle vor? Die Mutter kocht, putzt, bügelt, organisiert Urlaube, Freunde, Feste und Familie. Der Vater kümmert sich um das Auto, die groben Arbeiten im Haushalt, die elektronischen Geräte und alles Technische. Nur Klischees? Viele Familien funktionieren so. Und haben Ihre Eltern es schon genau so gehandhabt wie eben beschrieben? Meine haben es. Ich wurde in klassischen Rollenmustern groß. Aber nicht nur ich, sondern viele meiner Freunde, die diese Muster heute an ihre Kinder weitergeben. Diesem Drang kann man nur schwer widerstehen, wenn man etwas über 20 Jahre oder länger als »richtig« vorgelebt bekommen hat. Man hinterfragt auch ganz selten bewusst, ob es das ist, was man eigentlich selbst möchte. In meinem Buch »Wer sich selbst findet, darf´s behalten!« spreche ich genau von dieser Problematik. Was wollen wir? Was sollten wir wollen? Was sollten wir aus Sicht der anderen leben? Es ist immens schwer, aus der Sozialisierung auszubrechen.
Ich spreche aus Erfahrung. Heute – so meine Überzeugung – bin ich in keinem klassischen Rollenbild mehr verankert. Deshalb bekomme ich regelmäßig die Frage gestellt, wie das Leben als »berufstätige Mutter mit Kleinkind« denn so ist? Ich muss oft sehr früh raus, bin regelmäßig im Flieger unterwegs. »Was sagt denn da Ihr Mann dazu?« – das fragen mich übrigens Männer und Frauen. Mein Mann und ich leben teilweise gelernte Rollenmuster und teilweise nicht. Warum? Weil ich nicht alles ablegen möchte, was ich gelernt habe. Weil ich auch akzeptiert habe, dass es gut ist, die Alltagsarbeit in Expertise und Leidenschaft aufzuteilen.
Glauben Sie mir, ich habe auch gelernt, manchmal einfach »Blondine« zu sein. Es ist einfacher und weniger anstrengend, so durchs Leben zu gehen. Wenn ich zu schnell mit dem Auto unterwegs war oder ich etwas nicht erledigen will, ist es manchmal hilfreich (und legitim), sich dumm zu stellen und dem Klischee zu entsprechen. Manche Männer kennen diesen Kniff ja auch, wenn sie sich beispielsweise beim Bügeln so lange besonders ungeschickt anstellen, bis die Frau sie erlöst. Aber niemand von uns hat das »Schraubenzieher-Gen« oder das »Bügel-Gen« als Erbe mitbekommen. Dieses Können (bzw. Nichtkönnen) ist sozialisiert und hat nichts mit unserem Körper oder unserem Gehirn zu tun. Wir wurden in diesen klassischen Rollen trainiert – tagtäglich aufs Neue. Einerseits durch Vorleben, andererseits durch Vorzeigen und Mitmachen. Männer, die gut kochen können, erzählen oft von einer Mutter, die sie immer wieder hat mitkochen lassen. Frauen, die – wie ich – mit einem Vater groß geworden sind, der auch einem Mädchen gezeigt hat, wie man handwerklich tätig ist, wissen, wie sie mit einem Schraubenzieher oder Hammer umgehen. Mein Vater hat mich im Alter von fünf Jahren bereits auf Baustellen mitgenommen. Und mein Onkel hat mir gezeigt, wie man an einer Hobelbank arbeitet. Es war kein Wunder, dass ich schließlich einen technischen Beruf gewählt habe. Da der technische Bereich für mich keine »Hürde«, sondern etwas Vertrautes war, stellte ich mich den Herausforderungen gerne und selbstbewusst. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an ein Gespräch mit einem Manager:
Er sagte: »Wir Männer sind anders. Das liegt in unseren Genen. Ich sehe das bei meiner Tochter.« »Wie sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen?«, fragte ich ihn. Seine Antwort: »Ich war mit meiner Tochter am Flughafen oder bin mit ihr auf Bahnhöfe gegangen, um Züge zu beobachten. Sie hat das überhaupt nicht interessiert.« »Interessiert sich denn Ihre Frau für Technik, Autos, Züge und Flugzeuge oder Roboter? Programmiert Ihre Frau zuhause den Fernseher oder andere technische Geräte?« »Nein«, sagte er. Und ich fragte: »Was macht Ihre Frau?« Es folgte eine Aufzählung klassischer Rollenaufgaben. »Mit wem verbringt Ihre Tochter mehr Zeit?« »Mit meiner Frau.« Also fragte ich ihn zum Schluss: »Glauben Sie jetzt immer noch an die Gene?« Seine Antwort lautete: »So habe ich das noch nicht betrachtet.«
Vorgelebte Rollenbilder und die Folgen
Was wir unseren Kindern vorleben, nehmen sie an. Einmal mit dem Vater zum Flughafen zu fahren oder Züge anzusehen, wird nicht reichen, um das Interesse der Tochter daran zu wecken. Nimmt aber die Mutter ein Buch mit Fahrzeugen, Werkzeugen oder anderen Dingen zur Hand und erklärt Zusammenhänge, setzt das etwas in Gang. Meistens verhalten sich Frauen aber so: »Du, die Eisenbahn baust du lieber mit dem Papa, der kennt sich da richtig gut aus.« Das gilt übrigens auch umgekehrt: Da schicken Väter das Kind, wenn es ums Kochen geht, zur Mutter.
Ein weiteres Gespräch zu diesem Thema, an das ich mich erinnere, fand mit einem Vorstandsmitglied eines Unternehmens statt. Er meinte, wir sollen beim Recruiting von Frauen in der Technik auf einen wichtigen Aspekt Rücksicht nehmen: »Achten Sie auf Frauen, deren Väter Techniker sind oder deren Mütter einen technischen Beruf ausüben.« Diese Strategie fand ich schon damals naheliegend und clever. In der Praxis sind diese Filter aber leider nicht immer auf die Schnelle anzuwenden.
Dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, gilt auch für Ehrgeiz, Erfolg und Verantwortung – klassische »Führungskriterien«. Wissenschaftler der Universität Bonn haben einen Erklärungsansatz dafür: Ausschlaggebend ist die Vererbung von Risikobereitschaft und Vertrauen. Auch hier gilt: Was habe ich vorgelebt bekommen? Das Verhalten der Eltern wird unweigerlich übernommen, weil es tagtäglich (vor-) gelebt wird. Ob jemand mutig durchs Leben geht oder Risiken eher scheut, hat mit seinem familiären Hintergrund zu tun – das bestätigen auch neue Studienergebnisse des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) der Universität Bonn. Demnach bringen risikofreudige Eltern auch risikobereite Kinder hervor. Auch die Bereitschaft, Mitmenschen zu vertrauen, wird »vererbt«. Vor diesem Hintergrund erklären die WissenschaftlerInnen, warum Kinder ökonomisch erfolgreicher Eltern ebenfalls häufig erfolgreich sind: »Jede ökonomische Entscheidung ist riskant – ob es nun darum geht, Aktien zu kaufen, ein Haus zu bauen oder auch nur ein Studium aufzunehmen«, betont IZA-Forschungsdirektor Armin Falk. »Auf der anderen Seite hat Geschäftserfolg auch mit der richtigen Portion Vertrauen zu tun. Wenn Kinder ihren Eltern in puncto Risikofreude und Vertrauen ähneln, dann werden sie sich auch in ökonomischen Fragen häufig ähnlich entscheiden wie diese.« Umgekehrt könne der »Vererbungseffekt« aber auch die Zugehörigkeit zur vielzitierten »Unterschicht« zementieren. Laut Falk werden die genannten Charaktereigenschaften nach folgendem Prinzip weitergegeben: Eltern prägen den Charakter ihrer Sprösslinge, die wiederum einen Lebenspartner wählen, der ihnen ähnelt: Diese beiden Effekte tragen dazu bei, dass sich Einstellungen, wie Risikobereitschaft oder Vertrauen, über Generationen hinweg auf hohem Niveau halten. Kurz: Risikofreudige Frauen haben meist auch risikofreudige Ehemänner. Auch in puncto Vertrauen gleichen einander Ehepartner weitgehend, legen Falks Untersuchungen nahe. Die WissenschaftlerInnen räumen allerdings ein, dass ihre Daten keine befriedigende Antwort auf die Frage geben, inwieweit die Weitergabe von Risikobereitschaft und Vertrauen genetisch bedingt oder durch die Erziehung geprägt ist.
Ich gehe noch einen Schritt weiter: Eltern »übermitteln« auch ihr Netzwerk und ihre Kontakte an ihre Kinder. Meine Tochter lernt andere Menschen kennen, als ich kennenlernen durfte. Akademiker geben andere Kenntnisse an ihre Kinder weiter als Eltern, die einen handwerklichen Beruf ausüben. Das eine ist dabei nicht besser oder schlechter als das andere. Es ist nur anders. Kinder bekommen neben den klassischen Rollenbildern andere Lebensaspekte mit auf den Weg. Wenn Recruiting diese Faktoren berücksichtigen könnte, wären manche Positionen vielleicht besser besetzt.
Die Studie vom IZA bestätigt auch, dass es Kindern aus Arbeiterfamilien ungleich schwerer fällt, erfolgreich zu werden. Simples überspitztes Beispiel: Wenn ich zu einem großen Galadinner komme und nicht weiß, was ich mit vier Messern und vier Gabeln machen soll, muss ich mir das erst aneignen. Wenn ich das aber von klein auf mitbekomme, ist dieses »Wissen« eine Selbstverständlichkeit. Ähnlich ist es im Umgang mit »wichtigen« Menschen: Wurde mir demütiges Verhalten gegenüber ÄrztInnen und AnwältInnen vorgelebt, muss ich vermutlich erst lernen und mich wahrscheinlich auch dazu überwinden, mit ihnen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Bin ich allerdings mit solchen Autoritäten groß geworden, habe ich vermutlich auch später kaum Schwierigkeiten, Gespräche mit Vorstandsvorsitzenden zu führen.
Rollenbilder halten sich meist ebenso hartnäckig: Gesellschaftlich toleriert werden in der Regel nur Mütter, die erst wieder zu arbeiten beginnen, wenn ihr Kind drei Jahre alt ist. Das Gegenteil ist der Fall, wenn sie es schon vorher in eine Kinderkrippe geben und vielleicht auch noch einem Vollzeitjob nachgehen. Solche Mütter sind oft als »Rabenmütter« verschrien. Solche Frauen sind deshalb immer noch die Ausnahme und nicht die Norm. Männern, die zu Hause beim Kind bleiben, geht es nicht anders. Sie bekommen oft zu hören, sie seien »Weicheier«.
Mein Mann und ich teilen uns die Erziehung unserer Tochter. Er geht öfter zu Kinderveranstaltungen als ich, weil es für ihn beruflich einfacher ist. Oft findet er sich dort aber als einziger Mann unter lauter Frauen wieder. Gehe ich einmal zu einer solchen Veranstaltung und lerne andere Mütter kennen, fühle ich mich »anders« – nicht zugehörig. So würden sich wohl die meisten Männer fühlen. Mein Mann scheint hingegen mehr Teil dieser Gruppe zu sein als ich. Für uns beide funktioniert dieses Lebensmodell, was nicht bedeutet, dass es für jeden optimal ist. Darum geht es letztlich aber auch nicht, sondern darum zu verstehen, wie Sozialisierung unser Verhalten beeinflusst und unseren Handlungsspielraum einengt.
Während meiner Zeit in Amsterdam durfte ich erfahren, was es bedeutet, andere Rollenbilder zu leben. Frauen und Männer denken dort nicht »typisch Frau« oder »typisch Mann«, wie es in Deutschland oder Österreich verstanden wird. Es ist dort selbstverständlich, dass Frauen vier Kinder haben und Vollzeit arbeiten – und Männer das ebenso tun. Das Leben wird generell anders betrachtet: Es gibt Arbeitszeit und Familienzeit. Anwesenheit in der Firma ist nicht oberste Priorität, um den Job erledigen zu können. Dänen oder Franzosen handhaben das übrigens ähnlich.
Die meisten Frauen sehen Gesundheit als Wohlbefinden. Männer sehen es eher als Funktionsfähigkeit. Daher gehen Männer oft erst dann zum Arzt, wenn sie nicht mehr »funktionieren«.
Wenn Männer oder Frauen krank sind, werden auch hier klassische Rollenbilder sichtbar. Laut einer Studie im Auftrag der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind Männer mittlerweile zwar recht gut informiert, was die Vorsorge anbelangt, doch nur 40 Prozent der Befragten aus allen Altersgruppen und Bildungsmilieus gaben an, auf Früherkennung zu setzen. Bei den Frauen waren es dagegen gut 67 Prozent. Dr. Kasten Müssig, stellvertretender Direktor der Klinik für Endokrinologie und Diabetologie an der Uniklinik Düsseldorf, stellt dazu fest, dass die klassischen Rollenbilder immer noch sehr lebendig sind. Viele Eltern reden über Bilder, wie »der starke Mann, den nichts umhaut«, und der auf gar keinen Fall Schwäche zeigen darf. Mädchen dürfen weinen und Schwäche zeigen – egal ob aus Frust oder Schmerz. Krankheiten werden daher von den meisten Männern unbewusst mit »Schwäche« gleichgesetzt. Ärztliche Hilfe anzunehmen, bedeutet also, ein »Schwächling« zu sein.
Frauen hingegen haben keine Probleme damit, zum Arzt zu gehen, und kümmern sich weitaus intensiver um ihre Vorsorgeuntersuchungen. Die meisten Frauen sehen Gesundheit als Wohlbefinden. Männer sehen es eher als Funktionsfähigkeit. Daher gehen Männer oft erst dann zum Arzt, wenn sie nicht mehr »funktionieren«. Rechtzeitig zur Kontrolle zu gehen, würde für den Mann bedeuten, dass er verletzbar ist. Dieser Unterschied zeigt sich zum Beispiel auch bei Diabetikern: Mädchen messen regelmäßiger ihren Blutzucker und achten somit mehr auf ihre Gesundheit. Jungs beugen sich eher dem Gruppendruck. Es gilt eher als uncool, regelmäßig auf gesunde Ernährung und Blutwerte zu achten. Da dieses Verhalten lebensbedrohlich ist, sterben fünfmal mehr Jungen als Mädchen an Diabetes. Auch der Buchautor Björn Süfke berichtet über diesen auffälligen Verhaltensunterschied: Männer gehen aus drei Gründen zum Spezialisten, erklärt er: wenn sie von ihrer Frau gedrängt werden (wife mandated), vom Gericht dazu verdonnert werden (court mandated) oder ihr Hausarzt sie bezüglich einer weiteren Untersuchung zum Spezialisten schickt.
Eine weitere Erkenntnis der Müssig-Studie bestätigt ein bekanntes Klischee: Männer neigen aus Furcht vor der Nicht-Funktionsfähigkeit ihres Körper dazu, Krankheiten schlimmer zu empfinden als Frauen. Die unterschwellige Botschaft lautet: »Ich kann nichts machen, ich bin krank und deshalb auch nicht stark.« Dieses Gefühl führt zu höherem Schmerzempfinden. Gleichzeitig sind Männer anfälliger für Grippeinfektionen und dadurch tatsächlich häufiger krank als Frauen.
Eltern könnten ihren Söhnen zeigen, dass Schmerz zugelassen werden kann, anstatt den Zwang zum Funktionieren vorzuleben.
Das gesellschaftliche Rollenbild sieht so aus: Mann geht arbeiten und nicht zum Arzt. In Deutschland wurden deswegen sogar Kampagnen gestartet, die Männern den Gang zum Doktor schmackhaft machen sollen. Ein Slogan hat mir ganz besonders gefallen. Dieser soll männliche Jugendliche bezüglich Auffälligkeiten in ihrem Genitalbereich sensibilisieren: »Achte auf deine Nüsse.« In einer anderen Kampagne rufen Ärzte mit dem Slogan »Es wäre Zeit für eine große Hafenrundfahrt« zur Darmspiegelung auf.
Auch hier beginnt ein Umdenken am besten bei der Erziehung: Eltern – hier ganz besonders die Väter – könnten ihren Söhnen zeigen, dass Schmerz zugelassen werden kann, anstatt den Zwang zum Funktionieren vorzuleben. Dann würden wir irgendwann nicht mehr in einer gespaltenen Gesellschaft leben, in der die einen zur Vorsorge gehen und ihre Muskeln von Shiatsu-Therapeuten geschmeidig machen lassen, um noch mit 90 auf den Berg zu gehen. Und die anderen besuchen den Arzt nur alle zehn Jahre, weil die starken Schmerzen beim Urinieren irgendwann nicht mehr auszuhalten sind. Was ich krass finde: Jene, die unserem Leistungs- und Rollenbild entsprechend immer funktionieren sollen und die Familie ernähren müssen, werden immer kränker. Und jene, die zu Hause sind, um sich um die Kinder zu kümmern, werden immer gesünder, tragen aber wenig zum Familienumsatz bei. Nicht falsch verstehen: Ob Job oder Haushalt, beides ist gleichwertig – aber diese Diskrepanzen zerreißen eine Gesellschaft.
Sehr oft erzählen mir Unternehmen, es gebe zu wenige Technikerinnen. Woher kommt das eigentlich? Klar ist laut Wissenschaft, dass die Eignung für technische Berufe nur zu einem Teil mit Hormonen, Gehirnstruktur und körperlicher Eignung zu tun hat. Für Technik gibt es aber eine ähnlich definierte Rolle wie für Führungspositionen – die derzeit leider vor allem mit männlichen Verhaltensweisen assoziiert wird.
In Polen, Frankreich und in skandinavischen Ländern gibt es einen höheren Anteil an Technikerinnen, Frauen in typisch männlichen Berufen oder auch Führungsfrauen. Dort ist das fast normal. Und ich hoffe, Sie werden jetzt nicht behaupten, dass Polinnen ein anderes weibliches Gen haben als ich. Oder dass Holländerinnen andere körperliche Voraussetzungen besitzen als deutsche Frauen. Wir denken auch hier in Mustern und geben das unseren Kindern vor.
Eine Zeit lang kursierte in den sozialen Netzwerken ein Video, in dem ein Mann einen Freund auf einen Kaffee einlädt. Nach einem kurzen Gespräch sagt der Gastgeber, dass er schnell das Geschirr abwäscht und noch die Wäsche in die Waschmaschine geben möchte. Der Gast sieht ihn erstaunt an: »Ich helfe meiner Frau auch ab und zu, aber Dank bekomme ich dafür keinen.« Diese Aussage irritiert wiederum den Hausherrn: »Meine Frau braucht keine Hilfe, sie braucht einen Partner. Ich helfe nicht meiner Frau, das Haus zu putzen. Ich lebe hier, daher putze ich. Ich helfe nicht meiner Frau beim Kochen. Ich esse hier, daher koche ich. Ich helfe nicht meiner Frau, das Geschirr zu waschen, sondern ich wasche es, weil ich es benutze. Ich helfe nicht meiner Frau mit den Kindern. Da es auch meine Kinder sind, gehe ich dieser Aufgabe nach. Ich helfe nicht meiner Frau, die Wäsche zu waschen. Da es auch meine Wäsche und die meiner Kinder ist, wasche ich auch. Ich bin kein Helfer im Haus. Ich bin der Partner meiner Frau und ein Teil der Familie.« Der Gastgeber ist nicht mehr zu stoppen und fährt fort: »Irritiert dich das, mein Freund? Nur weil du einmal den Flur gesaugt hast, erwartest du ein Lob? Warum? Wann hast du deiner Frau das letzte Mal gedankt, dass sie kocht, die Wäsche wäscht oder sich um die Kinder kümmert? Vielleicht dachtest du, das wäre ihr Job, und vielleicht muss das aus deiner Sicht auch alles gemacht werden, ohne dass du dafür etwas tust. Hilf deiner Frau, indem du ein guter Partner bist und nicht nur ein Gast, der nachhause kommt, um zu essen, zu schlafen und seine Bedürfnisse zu befriedigen wie in einem Hotel.«
Dieses Gespräch zeigt – wenngleich auf plakative Weise –, dass die echte Veränderung zu Hause beginnt, indem wir unseren Töchtern und Söhnen den wahren Sinn einer Partnerschaft zeigen. Als Eltern sind wir dafür selbst verantwortlich, die alten Rollenstereotype aufzubrechen. Wenn wir diese Verantwortung nicht übernehmen, wird sich auch in Unternehmen nichts verändern. Viele Frauen beschweren sich bei mir über starre männliche Strukturen. Ich frage dann meistens nach, wie sie zu Hause Partnerschaft leben, denn das gesellschaftliche Denken wird in den eigenen vier Wänden geprägt – und nicht im Büro.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.