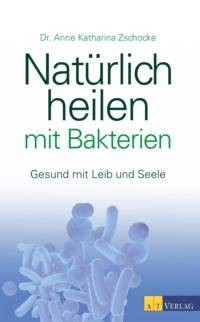Kitabı oku: «Natürlich heilen mit Bakterien - eBook», sayfa 6
Das bedeutet aber auch, dass Einzeller, losgelöst aus ihrer botenstoffgetränkten Gemeinschaft, genau diese Regulation und Kommunikation verlieren. Wenn Signale bei nur wenigen Bakterien eine Aktivität auslösen, sind alle Vorgänge, die gemeinschaftlich gesteuert werden, »unproduktiv«.109 Und bar jeder Gemeinschaft entsteht Chaos. Trotzdem hat man auf solche Zustände die Erkenntnisse der Bakteriologie aufgebaut. Züchtet man Bakterien isoliert heran, »hören« sie nur noch die Signale von ihresgleichen und aus dem angebotenen Nährboden im Labor. Mit der Folge, dass sie ein künstliches, quasi ein »narzisstischeres« Verhalten an den Tag legen als dieselben Bakterien in natürlicher Mischkultur.
Damit sind die im Labor gefundenen Aussagen zu Bakterien als »Krankheitserreger« nicht auf das Leben übertragbar. Das gilt nicht nur für die Mikrobiologie im 19. Jahrhundert, sondern genauso heute. Man darf aus Mikrobeneigenschaften im Labor nie auf ihr Verhalten woanders schließen, denn ungestört leben Mikroben immer mit der Korrektur durch die größere Gemeinschaft zusammen.
Ernährung als »Gespräch« mit den Bakterien
Die Verständigung der Bakterien beschränkt sich nicht nur auf die charakteristischen Botenstoffe, die von Einzellern abgegeben werden. Vielmehr dient jegliche Substanz als Signal, das ihnen irgendetwas »erzählt«. Also auch Bruchstücke von Pflanzenresten, synthetischen Stoffen, Mineralien, Gase, Flüssigkeiten, im Klartext: unsere Nahrung, Kleidung, Kosmetik, Medizin, Körperpflegemittel, Wasser und Atemluft und alles sonst. Alle Vitamine und Hormone, Spurennährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Aromamoleküle können Signalwirkung auf die Bakterien haben. Wir können gar nicht nicht mit ihnen kommunizieren. Mit jedem Molekül unserer Welt gehen wir beständig mit unserem Mikrobiom in Kontakt.
So gibt es bakterielle Botenstoffe aus der Klasse der »Furanone«, die der Verständigung zwischen Bakterienarten untereinander dienen, zugleich aber auch in Obst wie Erdbeeren und Pampelmusen, Ananas, Buchweizen und Tomaten vorkommen. Sie finden sich als Aromastoffe in gekochten und fermentierten Lebensmitteln wie Bier und Sojaprodukten,Käse und Wein, sie entstehen je nach Herstellungsweise beim Rösten von Kaffee – und: Vitamin C ist ebenfalls ein Furanon.
Diese Kommunikation geschieht wechselseitig. Bakterielle Signalmoleküle werden über Haut und Schleimhäute in die Blutbahn aufgenommen, wirken dort und kreisen durch den Körper. Einige von ihnen zählen zu den Nervenbotenstoffen, die im Nervensystem und Gehirn wirken. Was sie wann, wo und wie tun, weiß man noch nicht. Vor Kurzem hat man aber entdeckt, dass ein Botenstoff, den man bislang bloß aus der Verständigung von Bakterien untereinander kannte, beim Menschen für eine Regulation der Herzfrequenz zuständig ist. So sprechen unser Herz und unsere Bakterien bereits eine gemeinsame Sprache.110
Umso schlimmer ist es, wenn wir mit antibakteriellen Mitteln dazwischenplatzen. Da Antibiotika ja angereicherte Signalbotenstoffe von Bodenpilzen wie Penicillium notatum sind (siehe Seite 35, 44), torpedieren sie isoliert, multipliziert, verändert, synthetisch modifiziert und nachgebaut jede angemessene Kommunikation.
Bakterielle Resistenzen sind daher nichts anderes als die naturgegebene Antwort der Mikroben auf unsere Art, mit ihnen zu »reden«. Wollen wir die gigantischen Probleme lösen, die daraus folgten, liegt es an uns, uns anständiger und kooperativer mit ihnen zu »unterhalten«. Von vor 3,8 Milliarden Jahren bis vor wenigen Jahrzehnten, als der Mensch auf diesbezügliche Abwege geriet, waren sie dies auch überall auf der Erde gewohnt. Schließen wir also Frieden und finden wir zur aufrichtigen Zusammenarbeit mit der größten Biomasse in der Erde zurück!
Der Mensch als Zellengemeinschaft im Kreislauf des Lebendigen
Der Urlebensraum der Erde ist also eine kooperativ geordnete Einzellergemeinschaft, die im beständigen Fluss Materie aufnimmt und abgibt und dabei in ihrem Inneren nach Bedarf Stoffe verändert. In der Zelle und im Biofilm geschieht ein Stoffwechsel. Außerhalb der Zelle finden chemische Reaktionen statt, in ihr lebendige. Dadurch kommt es zu Entwicklungsprozessen. Es entwickelten sich schließlich Bakterien, die Sauerstoff abgaben,[5] der sich im Laufe von Jahrmillionen über der Erde anreicherte. Als neuer Raum entstand die sauerstoffreicheAtmosphäre mit der schützenden Außenhülle aus Ozon. Bakterien nutzten diesen Sauerstoff und entwickelten die »Atmung«. Größere Einzeller nahmen vor etwa zwei Milliarden Jahren kleinere Einzeller mit der Fähigkeit zur Atmung in sich auf.111 Nachkommen dieser einst in die Zelle aufgenommenen Bakterien sind die Mitochondrien, die in jeder Körperzelle in uns die Zellatmung bewirken.[6]
Auch sie kommunizieren, insbesondere mit dem Zellkern. Eigenständige Gene ermöglichen ihre unabhängige Verdoppelung in der Zelle, und sie werden mit der Eizelle der Mutter auf die Kinder vererbt. Ihre Aktivität in der Zelle hängt von Lebensqualitäten wie Ernährung, Bewegung, Hormonen und Sauerstoffversorgung ab.112 Da Mitochondrien die Energie für die Körperzellen zur Verfügung stellen, sind sie besonders wichtig für ein gesundes Leben, und offenbar gehen Mikrobiom-Erkrankungen mit Mitochondrienstörungen Hand in Hand.113 Sind die Mitochondrien in den Darmschleimhautzellen geschwächt, zum Beispiel durch ständige Minderdurchblutung bei Leistungssport, wegen Giftbelastung oder wegen Stress und Anspannung im Bauch, kommt es leichter zu einem Leaky Gut (siehe Seite 119f.).
Aus der Symbiose von Bakterien wurden also Zellen mit Zellorganellen und mit Zellkern.[7] Vor etwa einer Milliarde Jahren begannen gemeinschaftliche Zellbereiche, sich zu differenzieren, woraus sich Organe und Gewebe entwickelten. Aus Einzellern wurden Mehrzeller und die ganze Vielfalt zunächst an einfachen Meerestieren, dann an Pflanzen, Säugetieren und schließlich der Mensch. Alle Lebewesen, die wir heute mit bloßem Auge sehen können, sind aus der einstigen Symbiose von Bakterien hervorgegangen. Und seither, über all die Milliarden Jahre, blieben die Einzeller ihre treuen lebensnotwendigen Begleiter. Sie leben auf ihren Oberflächen und inneren Grenzflächen, wirken im Energiehaushalt, Stoffwechsel und in der Abgrenzung zwischen Fremd und Eigen. Sie vermitteln unermüdlich das Gesamtbild eines Organismus an alle seine Organe.
Erst dadurch, dass jedes »höher«entwickelte Lebewesen beständig in seine bakterielle Vorfahren und Begleiter lebendig eingebettet ist, kann es als komplexes Individuum auf der Erde leben. Was einst als Gemeinschaft der Einzelzellen vorausging, blieb in zahllosen kleinen Symbiosen zwischen Bakterienzellen und Körperzellen bestehen.
In der Vergangenheit haben wir uns nur anhand unserer kernhaltigen Körperzellen als Mensch identifiziert. Wir sahen uns als einen Gewebeverbund aus Organen, Blutzellen, Organzellen, Nervenzellen und so weiter. Die Bakterien haben wir dabei übersehen. Dieses unvollkommene Menschenbild dürfen wir jetzt gründlich revidieren: Wir sind nicht allein. Die Einzeller gehören dazu. Wir sind eine große Gemeinschaft, jeder von uns in sich und mit jedem anderen von uns. Wir stehen über die zahllosen Mikroorganismen in uns in einem bakteriellen Strom des Lebens, den wir aufnehmen, unterschiedlich lange in uns tragen und wieder ausscheiden. Dabei verändern wir sie in uns und sie uns. Was uns zum Individuum macht, ist unsere Gestalt. Und auch sie ist beständiger Wandlung anheimgegeben, denn ständig erneuern sich alle Körperzellen. Etwa alle neun Tage in Magen und Lungenbläschen, alle anderthalb Tage im Dünndarm, alle zehn Tage im Dickdarm, alle zwanzig Tage in der Leber, alle zwei Wochen auf den Lippen, alle drei Wochen unter den Sohlen, alle acht Wochen in der Harnblase – weiche Gewebe rascher, harte langsamer.[8] Im Gesunden sterben alte Körperzellen in genau der Geschwindigkeit ab – oder werden wie in den Knochen abgebaut –, wie neue Zellen nachwachsen. Fällt diese Fließgeschwindigkeit aus dem Lot, kommt es entweder zu Zerfall oder zur Wucherung, was beides krank macht. Das gilt auch bei unseren Mikroorganismen. Wir nehmen sie auf, sie leben in uns, wir geben welche ab, und dies geschieht gesunderweise in einem ständigen Gleichgewichtsfluss. Auch wenn dieser nicht fließt, werden wir krank.
Der Mensch ist ein Wesen im Fluss des Lebens, im Kreislauf des Lebendigen, im Kreislauf der Einzeller aus Boden-Pflanze-Nahrung-Luft-Wasser-Ausscheidung – eingebettet in den Rest der Welt. Ständig nimmt der Mensch in seinen Körper auf: Nahrung, Wasser und Luft. Er scheidet Atemluft, Harn, Schweiß und Stuhl aus. Und er nimmt mit all diesem Bakterien auf und gibt wieder welche ab. Er ist über die Bakterien in einem ständigen Dialog mit seiner Umgebung. Erst sie ermöglichen ihm, als gleichbleibendes und sich zugleich entwickelndes Individuum in dichter Verbindung zur Umgebung flexibel in den wechselnden Lebensumständen dieser Welt zu stehen.
Diese Gleichzeitigkeit von Bleibendem und Veränderung ist schwer zu erfassen, sie hat etwas Transzendentes. Am ehesten lässt sie sich mit der Welle in einem Bach vergleichen, die als Wellenform stehen bleibt und doch ständig von frischem Wasser durchflossen ist.
Bakterien in der Atemluft
Dass wir Bakterien mit dem Essen aufnehmen und dass sie üppig im Darm leben, ist nun schon lange bekannt. Dass wir Bakterien mit dem Stuhl ausscheiden, auch. Die Mengenangaben schwanken zwischen der Hälfte und einem Drittel des Stuhlgewichtes.
Dass die Atemluft voller Bakterien ist, und dies je nach Ort, Jahreszeit und Witterung verschieden ist, beschrieb man bereits 1877.114 Im Jahr 2015 konnten Forscher der Universität Oregon nun zeigen, dass die Ausatemluft jedes Menschen seine typischen Bakterien enthält.115 Das ist in sehr praktischer Weise für die Gesundheit wichtig. Schon immer hat man von »Tröpfcheninfektion« gesprochen, wenn Mikroben über die Luft von Mensch zu Mensch übertragen wurden. Und man hat Krankenzimmer gut gelüftet. In Krankenhäusern mit frischer Luftzufuhr herrschte erfahrungsgemäß schon immer eine angenehmere Atmosphäre als bei Vollklimatisierung.
Jetzt weiß man, dass jeder Mensch eine so persönliche Bakterienwolke um sich trägt, dass man ihn anhand der Bakterien, die er in einem Raum hinterlässt, sogar identifizieren kann.
Man findet seine Bakterienzusammensetzung nach einer kurzen Zeit in der Luft und auch auf den Oberflächen in der Umgebung. Mit jedem Atemzug und jedem Luftzug, selbst wenn wir still sitzen, geben wir eine bakterielle Signalwolke hinaus in die Welt, in der wir leben. Und wir atmen die bakterielle Welt »mit Haut und Haaren« ein. Was wir »Ausstrahlung« eines Menschen nennen, ist also tatsächlich voller Leben. Man hat ermittelt, dass ein Mensch etwa eine Million biologische Teilchen pro Stunde nach außen abgibt, darunter vor allem Bakterien.116 Jeder prägt, wo immer er oder sie ist, seiner Umgebung die eigenen Mikroben auf. Folglich tragen wir auch die Verantwortung für die Bakterienwelt, die wir ständig um uns her verteilen.
In einem Neubau finden sich nach wenigen Tagen die typischen Bakterien der neuen Bewohner wieder, und jeder Besucher mischt etwas dazu.117 Atembakterien gestalten die Raumatmosphäre mit, die in einer Wirtschaft dann anders ist als in einer Kirche. Jedenfalls war das Leben früher bakteriell gar nicht so ungesund. Ein offenes Feuer, wie es im Küchenherd und Stubenofen üblich war, reinigte unentwegt die durch die Flammen hindurchziehende Luft. Ein gestampfter Lehmboden mit Mikroben konnte dank Bodenpilzen ein übermäßiges Bakterienwachstum hemmen. Auch das »Räuchern« eines Raumes mittels Weihrauch und Ähnlichem kann die Mikrobenzusammensetzung verändern.
Die Luft, die wir einatmen, ist natürlich nach der Art des Ortes zusammengesetzt, an dem wir uns befinden. In einer Großstadt findet sich eine andere Luftmikrobenmischung als im Hochgebirge. In »Luftkurorte« fährt man ja deshalb zur Genesung, weil die Luftzusammensetzung dem Menschen Heilung bringt. Bislang hat man dabei noch nicht so sehr an die Luftbakterien gedacht. Vielleicht entwickelt man in Zukunft mikrobiologische Luftkurortqualitätskriterien. Jedenfalls kann man eine positive Bakterienbelebung der Luft therapeutisch nutzen118 (siehe Seite 271).
Die private Raumluft ist also immer sehr persönlich. Forscher aus den USA und Dänemark stellten anhand von Staubproben aus 1200 unterschiedlichen Haushalten fest, dass die Zusammensetzung der Pilze durch die äußere Umgebung geprägt wird, die der Bakterien mehr von den jeweiligen Bewohnern.119 Dabei spielte die Anzahl der zusammenlebenden Personen eine Rolle und das Verhältnis von Männern zu Frauen. Auffällig war, dass die Mikrobenvielfalt sofort zunahm, sobald Haustiere in der Nähe waren. Das direkte Zusammenleben von Mensch und Tier fördert also eine mikrobielle Vielfalt.
Die Ergebnisse bestätigen, was Ärzte vor Jahren schon mit der »Hygiene-Theorie« vermuteten: dass nämlich Einzelkinder mehr krank sind, als wenn sie mit Geschwistern ihr Zimmer teilen. Ähnliches berichtete eine Ärztin von einem Lazarettschiff im Vietnamkrieg. Obwohl aus Platznot mehrere Kranke in jedem Bett lagen, fanden sich in Böden und Betten bei einer Hygiene-Untersuchung bloß gewöhnliche Alltagsbakterien.120 Allein die Mischung hatte für eine Regulation gesorgt. Der heutige Verlust an Mikrobenvielfalt liegt also nicht nur an Desinfektion, schlechter Ernährung und antibiotischen Aktivitäten, sondern auch an der Singlekultur. Das Empfinden von »Einsamkeit« bekommt tatsächlich noch eine ganz andere Dimension. Jedenfalls gab den Menschen das Leben in einer bäuerlichen dörflichen Landwirtschaft mit Tieren, Garten- und Feldbebauung eine gesunde Mikrobenvielfalt in der Hofgemeinschaft. Und wer weiß: Vielleicht tat die Nähe der Menschenmikroben auch der tierischen Bakterienvielfalt gut?
Dass Zimmerpflanzen die Raumluft und deren Zusammensetzung positiv verändern, ist bereits länger bekannt. Aber auch die Art von Architektur und Lüftung spielen eine Rolle. In künstlich klimatisierten Räumen findet sich weniger Bakterienvielfalt als bei Lüftung durch Öffnen der Fenster. Es entsteht eine separierte Luftmikrobenmischung, und die Unterschiede zur Mikrobiota[9] der Außenluft ist erheblich. Dasbedeutet, dass jemand, der sich länger in einem klimatisierten Raum aufhält, sei es ein Gebäude, ein Flugzeug oder ein Zug, bei dessen Verlassen schlagartig gänzlich anderen Mikroben ausgesetzt ist. Diese Abtrennung der Atemluft vom Außenmikrobiom ist der Gesundheit abträglich. Man hatte bisher die Vorstellung, in Krankenhäusern könnten »Keime« aus der Außenluft die Genesung stören. Man stellte jedoch fest, dass bei gefilterter Klimaanlagenluft tatsächlich mehr »Krankheitskeime« in den Krankenzimmern zu finden waren. Auch eine zu geringe Luftfeuchtigkeit verringert die gesunde Vielfalt zulasten der Menschen.121 Da der Mensch sein Mikrobiom zum Gutteil mit der Luft teilt,122 sollte bei einer mikrobiologischen Therapie immer auch die Umgebung mitbehandelt werden. Dafür kann ein Versprühen von Bakterien sehr hilfreich sein (siehe Seite 271ff.).
Bakterien im Trinkwasser
Trinkwasser ist nicht etwa so bakterienfrei, wie man bis vor Kurzem glaubte. Als man bei einem schweizerischen Forschungsinstitut123 mit der aus der Blutzellzählung bekannten Durchflusszytometrie[10] reines Trinkwasser betrachtete, das definitionsgemäß bakterienfrei sein sollte, entdeckte man auf einmal große Mengen kleinster Bakterien. Bisher hielt man Bakterien im Leitungswasser für schädlich und kontrollierte die Reinheit des Trinkwassers damit, ob daraus auf Nährböden Bakterien wuchsen. In Deutschland dürfen höchstens bis zu einhundert koloniebildende Einheiten[11] pro Milliliter enthalten sein und gar keine E. coli und Enterokokken, die gewöhnlich aus Verdauungsprozessen stammen. Durch die neue Methode stellte man jedoch die bis zu zehntausendfache Bakterienanzahl fest – von solchen, die sich bisher bloß nicht künstlich kultivieren ließen. Das revolutioniert unsere bisherige Vorstellung von reinem Wasser völlig. Es kommt offenbar eher darauf an, welche Bakterien im Wasser sind. Vielleicht ist destilliertes Wasser deshalb ungenießbar, weil ihm die mikrobielle Lebendigkeit fehlt?
Bisher hat man eine Biofilm-Bildung in Trinkwasserleitungen gefürchtet. Jetzt stellte man fest, dass es völlig normal ist, wenn sich in neuen Wasserleitungen aus stabilem Material binnen Wochen bis Monatenein Biofilm als Innenauskleidung entwickelt, der sich schützend auf die innere Oberfläche legt und einen gesunden Wasserdurchfluss erlaubt. Die Bakterien vermehren sich darin nur dann, wenn das eingespeiste Wasser organische Kohlenstoffe enthält. Und die können paradoxerweise gerade dann entstehen, wenn Huminstoffe im Wasser durch Chlor- oder Ozonbehandlung bioverfügbar gemacht werden, was das Wasser ja eigentlich reinigen soll. Sie entstehen auch durch lösliche Kunststoffrohranteile.124
Offensichtlich ist das, was wir bislang als »Wasserqualität« und »Wasserbelebung« bezeichnet haben, in Wirklichkeit ein Anhalt für die Bakterienlebendigkeit im Wasser, für ein fließendes Wassermikrobiom. Nimmt man ein solches Wassermikrobiom an, so hat jedes Wasser sein eigenes Mikrobiom, auch jedes Gewässer. Ein Mikrobiom reagiert auch auf Einträge von Antibiotika – wie sie aus Kläranlagen in Flüsse gelangen – und kann mithilfe von Mikroorganismen saniert werden, wie es mit den Effektiven Mikroorganismen gelingt. Da auch der Wasserhaushalt des Menschen ein wesentliches Element seines Organismus darstellt, sind wir mit der Wasseraufnahme und der Ausscheidung von Harn und deren Bakterien in dieses wässrige Mikrobenleben der Erde hineingestellt – mit der Möglichkeit, es zu gestalten.
Das konfrontiert uns mit der atemberaubenden Erkenntnis, dass es unmöglich ist, dem, was wir den Mikroben tun, irgendwohin auszuweichen. Wasser fließt überallhin, in ewigen Kreisläufen. Was es mit sich trägt, kann an jede Stelle der Erde gelangen. Aus der Quelle zum Menschen, aus dem Menschen in Erde, Flüsse und Meer, aufgenommen in die Wolken, wo man festgestellt hat, dass die Bakterien das Wetter mitbilden, indem ihre Aktivität Wärme bildet, die Regentropfen entweder schweben oder fallen lässt.[12]125 Hinabgeregnet in die Erdoberfläche, aufgenommen dort vom Lebendigen, hinabgesickert in die Tiefe des Untergrunds und wieder aufgestiegen in einer Quelle … Heilige Wege … Die Erde ist lebendiger, als viele meinen. Auch die Luft trägt Einzeller überallhin, im Kleinen beim Atemzug, beim Sprechen, bei geöffnetem Fenster, sowie im Großen, und vermischt sie überall. Sie steigen in die Höhe der Atmosphäre, und Winde blasen sie umher. Man geht von 2,2 Milliarden Tonnen Staub aus, die jährlich durch die Erdatmosphäre verfrachtet werden, und jedes von Wüstenstürmen von Kontinent zu Kontinent getragene Staubkorn kann Milliarden von Mikroben mit sich tragen.126 Wir und die Mikroben der Welt sind eins.
[1] Grundmatrix aus Polysacchariden, die »extrazelluläre polymere Substanz«, EPS.
[2] Stromatolithen, Gesteinsbildungen aus Biofilmen, sind die ältesten Fossilien der Erde, die man gefunden hat.
[3] Anaerob: ohne Sauerstoff lebend.
[4] Ein »Quorum« war in der römischen Politik die Mindestzahl von Mitgliedern, die im Senat für eine Abstimmung erforderlich waren. Das englische sensing leitet sich vom lateinischen sensus für »Wahrnehmung, Gefühl, Verstand« ab.
[5] Vor circa drei Milliarden Jahren die Cyanobakterien.
[6] Bei Pflanzen die Photosynthese praktizierenden Chloroplasten.
[7] Alle Lebewesen der Erde werden nach ihrer Gensubstanz in Domänen unterteilt: die Prokaryoten ohne Zellkern und die Eukaryoten, zu denen der Mensch zählt, mit Zellkern. Im Zellkern wird die genetische Information von einer Doppelmembran eingehüllt.
[8] Diese Anhaltswerte schwanken und sind abhängig von Alter, Konstitution und Gesundheitszustand. Binnen weniger Jahre haben sich alle Zellen eines Körpers erneuert.
[9] Als »Mikrobiota« bezeichnet man die Zusammensetzung der Bakterienarten in einem Lebensraum.
[10] »Zyt-« ist ein Wortbildungselement mit der Bedeutung »Zelle« (vom griechischen kýtos für »Höhlung, Wölbung«). Das Wort metreĩn heißt »messen, zählen«. Bei der Zytometrie wird eine Flüssigkeit beobachtet, während sie zügig durch eine feine Glaskapillare strömt.
[11] KBE, Messgröße zur Ermittlung der Bakterienzellzahlen durch Kultivieren eines Ausstrichs auf einer Nährstoffplatte.
[12] Wetterbildende Mikroben sind überwiegend pflanzlichen Ursprungs. Werden Wälder abgeholzt, wirkt dies daher über die Mikroben auf das Klima. Von kranken Pflanzen können Bakterien abgegeben werden, die Eiskristalle in Wolken bilden.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.