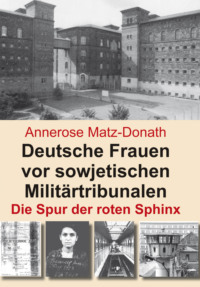Kitabı oku: «Deutsche Frauen vor sowjetischen Militärtribunalen», sayfa 2
Dass sie vor ein Sowjetisches Militärgericht gestellt werden würde, ahnte sie damals nicht. Zwar gehörte es längst zum Alltag, dass immer wieder Menschen verschwanden – spurlos, völlig und absolut spurlos! Das wußte jeder. Doch was mit diesen Menschen geschah, das lag völlig im Dunklen. Es machte die Angst noch größer – eine Angst, die keinem fremd war, der damals ‚drüben‘ lebte.
Tatsächlich wartete auf alle Verhafteten eine brutale ‚Untersuchungshaft’, danach harte Urteile der Sowjetischen Militär-Tribunale. Das konnte Todesstrafe bedeuten. Viele Jahre Gefängnis und Zuchthaus waren es in jedem Falle. Vielleicht bedeutete es auch Transport nach Sibirien, Zwangsarbeit in den Bergwerken dort oder riesige Bäume fällen in den Wäldern der Taiga.
Auch für Helga Söntgen lautete der Spruch auf fünfundzwanzig Jahre „Arbeitsbesserungslager“, wie das schöngefärbt hieß. Für Spionage. Nun gilt Spionage überall auf der Welt als verfolgungswürdige Straftat. Spione werden in allen Ländern gejagt. Hätte die junge Frau da nicht lieber rechtzeitig an ihre Mutterpflicht denken sollen, ehe sie …? Aber was hatte sie denn getan?
„Ja – mein ‚Fall‘? – Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die Neiße unsere Grenze zu Polen geworden und damals, 1950, hatte die Regierung in Warschau sie doch total dicht gemacht. Wer jetzt noch aus Polen raus wollte, mußte es heimlich versuchen, nachts durch den Fluß.
Immer wieder kamen welche durch die Neiße, Deutsche natürlich, die nicht Polen werden wollten. Solche habe ich aufgenommen, das war mein ‚Spionageverdacht‘. Denn da hätten ja können Spione dabei sein, sagten die STASI und die Russen. Aber … wenn einer hinfällt, dann hilfst du ihm doch auch aufstehen ? Und wenn einer naß durch die Neiße kommt und du hast dein Heim, dann hilfst du demjenigen doch!?“
Aus der Gruppe der einander fremden Flüchtlinge, denen Frau Söntgen für eine Nacht ein trockenes Obdach gegeben hatte, wurde in den Papieren von STASI und NKWD eine veritable Spionage-Organisation. Die Menschen waren bei einer Personenkontrolle weiter drin im Land ohne gültige DDR-Ausweise betroffen worden. Ihren Wunsch, unter Deutschen in Deutschland zu leben, bezahlten sie nun mit einer langen Freiheitsstrafe als Spione und Agenten.
Nach sechs Jahren kehrte Helga heim, mittellos und gesundheitlich aufs Tiefste erschöpft. Doch schon lange wartete auf sie kein Zuhause mehr, um sie aufzunehmen. Den Mann, den sie liebte, hatte sie für immer verloren, und ihr Kind sagte ‚Vater‘ und ‚Mutter‘ zu fremden Leuten.
Irene Kunze hatten die Jahre tiefster Sorge um das Ergehen der Kinder zum Glauben der eigenen Kinderzeit zurückgeführt. Wohl war sie unter Diakonissen aufgewachsen.
„Aber Diakonissen sind auch nicht immer fromm und lieb, sondern oft sehr hart. Vor allem bedenken sie oft nicht, dass Kinder feine, empfindliche Seelen haben. Deshalb mochte ich die alle nicht, die mich erzogen haben, und war gern bereit, die Kirche zu verlassen, als mein Mann mir das vorschlug.
Heute? Heute meine ich, das Wenigste, was wir tun können, ist, uns zu Gott zu bekennen. Auch wenn ich – ich meine, ich gehe niemals zur Kirche, schon früher nicht. Denn ich bin ein Ostfriese. Ehe wir den Mund aufkriegen, ist der Pfarrer fertig mit seiner Predigt. Ich bin außerdem ein Einzelgänger.“
Nicht schnell mit den Worten zur Hand sein, das ist eine Sache, sich in schweigender Demut zu üben eine andere. Doch Irenes ergebenes Dulden hatte einen gewichtigen Grund:
„Einmal, in der Haft, hat mir Irms Thormann, die ich sehr mochte, gesagt: ‚Irenchen, du bist mir manchmal schon zu sanft. So … so untergeben darf man nicht sein!‘ Und ich habe ihr nicht geantwortet. Ich hätte es vielleicht sagen sollen: Wenn du deine Kinder so weggenommen kriegst und vier Jahre nicht weißt, wo sie denn nun sind … Ja, dann sitzt du da, nicht, und betest nicht mehr für dich, sondern nur noch für deine Kinder – seit Bautzen habe ich wieder gebetet, seitdem ich dort das mit Mutti Hessmann miterlebt habe …“
Es war in Bautzen gewesen, 1946, oben im großen Saal in Haus Zwei, in dem damals die Frauen lagen. Da lernte Irene Kunze Frau Hessmann kennen und freundete sich sehr mit ihr an. Denn beide trugen als Mütter das gleiche Leid. Muttchen Hessmann, wie alle sie nannten, stammte aus Siebenbürgen.
„Die Hessmanns waren schon auf der Flucht nach Deutschland gewesen, als die Front sie überrollte. Die Russen verhafteten sie, schmissen den Mann auf einen Lastwagen, sie auf einen anderen. Damit keiner flüchten konnte, saßen obendrauf auf den Gefangenen die Soldaten mit ihren groben Stiefeln. Wo Hessmanns Sohn geblieben war? Der kleine Junge war verschwunden. Nun verzehrte Muttchen Hessmann sich nach ihrem einzigen Kind.
Die Siebenbürgerin war fromm katholisch. Einmal sagte sie mir: ‚Frau Kunze, ich bitte jeden Abend die Gottesmutter, dass sie mir ein Zeichen schickt!’
Wir haben natürlich gelächelt und genickt, und auf meinem Bett habe ich gedacht, na, also … da ist auch die Gottesmutter überfordert. Wie soll sie in diesen Käfig eine Nachricht bringen?
Eines Tages kommt eine Neueinlieferung. Wir waren noch nicht so viele, paßten alle noch in den einen Saal. Immer, wenn eine Neue kam, stellten wir uns im Kreis um sie herum, und die Neue ging dann von einer zur anderen und schüttelte Hand um Hand. So auch diesmal. Mutti Hessmann stand wie immer neben mir und sagt ihren Namen: Hessmann, Anni Hessmann. Die Neue will schon weiter, streckt schon mir die Hand entgegen, da stockt sie plötzlich und sagt: ‚Wie heißen Sie? Hessmann? Kommen Sie aus Siebenbürgen?’ Ja. Und dann erzählt die Neue, dass sie durch Wien getrieben worden sind, von den Russen eingefangen – ja, durchgetrieben so in Fünfer-Reihen. Und da ist ein Wiener Sängerknabe rumgelaufen – in diesem Anzug, den die trugen – und ist immer neben den Frauen hergelaufen, hat gerufen, ‚Ich bin … ich heiße Wolfi Hessmann. Und wenn Sie meine Mutter sehen, sagen Sie ihr, dass ich lebe!’
Da … also Mutti Hessmann fiel gleich in Ohnmacht. Und ich bin auf mein Bett gegangen, habe gedacht, wenn es IHN aber doch gibt … !?
Das war erschütternd. Ja, erschütternd ist es für mich selbst heute noch, dass mir die Tränen kommen, wenn ich davon erzähle! Denn es war so unwahrscheinlich, was da geschah – unter lauter armen Plennies. Ein Gotteswunder, ein wirkliches, nicht? Denn die Fremde wußte ja nicht, die stutzte, stotterte nun … Ein Wunder war es ja schon, dass sie den Namen des Jungen überhaupt richtig verstanden und ihn nicht vergessen hatte!
Um Mutti Hessmann in ihrer Ohnmacht haben sich die anderen gekümmert. Ich bin von meiner Matratze lange nicht heruntergekommen, da oben, auf der zweiten Lage, wo ich schlief.
Wie die Neue das gesagt hat, habe ich immer wieder gedacht: Wenn es IHN aber doch gibt? Und ich habe angefangen, mein ganzes Leben zu überdenken. Wenn es IHN aber doch gibt? Die Frau hat Hilfe gekriegt, nun will ich mal für meine Kinder beten. Und dann – ich war ja religiös erzogen. Ich kannte ja den Satz von den Sünden der Väter, die auf die Kinder kommen. Ich dachte, was habe ich schon groß getan, aber wenn ich schuldlos mit schuldig geworden bin, mein Mann vielleicht schuldig gewesen ist und ich eben, weil ich ihn so blind liebte, mitschuldig, dann, lieber Gott, habe ich gebetet, dann will ich ja alles auf mich nehmen. Aber bitte, verschone die Kinder! Ich will alles ertragen, alles machen, ohne zu klagen! Aber hilf den Kindern. Und das hat er ja auch getan. Die waren ja zu Hause, nicht?
Ich bin ein sehr gläubiger Mensch geworden – aber ich hätte in der Haft nie mit jemandem darüber gesprochen!“
Vier Jahre, vier lange Jahre der Angst und der Not hatte Irene ausharren müssen, bis sie 19502 – im ersten Brief von zu Hause – endlich Gewißheit erhielt: ihre Kinder waren vor russischem Zugriff gerettet worden. Die Nachricht erschien ihr wie eine Gebetserhörung.
„Es war doch ganz kurz vor Hilles sechstem Geburtstag gewesen, als sie mich verhaftet hatten. Zu diesem Geburtstag hatte meine Schwester es geschafft, ein Päckchen über die Grenze zu schicken. So erfuhr meine Putzhilfe, wo die Großeltern wohnten. Sie schrieb nach Wilhelmshaven, dass ich nachts geholt worden war und dass sie die Kinder abholen sollte. Das hat meine Schwester auch unverzüglich getan, kurz, ehe die Russen nach den Kindern fragten.“
Der Florian
Weshalb war Irene Kunze nun eigentlich „abgeholt“ worden, wie man damals landläufig sagte? Eines Tages hatte eine flüchtige Bekannte sie angesprochen: Sie habe doch noch von ihrem gefallenen Mann Zivilanzüge im Schrank. Ob sie damit nicht einem helfen könne, der kein Zuhause mehr habe?
„‚Wir haben da so einen Ritterkreuzträger’, sagte die Frau, ‚der lag mit seiner kaputten Uniform im Wald, den mußten wir fast nackt ausziehen, der braucht Anzüge!’ Und so gab ich der Frau dann die gesamte zivile Kleidung meines Mannes mit. Denn was sollte ich noch damit? Ja. Und so kam ich an den Florian. Unter diesem Namen hat er sich vorgestellt, und so haben wir ihn auch genannt, Florian Sowieso. Den Nachnamen habe ich schon lange vergessen. Ritterkreuzträger – ob er das war, weiß ich wirklich nicht. Spielte ja auch keine Rolle. Denn wer hilft nicht einem Menschen in Not?“
Ein solcher Fall und eine solche Bitte waren damals in der Tat nichts Ungewöhnliches. Vielen Menschen war Haus und Heim im Bombenhagel untergegangen. Wer aus den verlorenen Gebieten im Osten und Süden Deutschlands stammte, konnte ja gar nicht mehr nach Hause. Auch dass dieser Florian anfing, Irene zu besuchen, schien unverfänglich. Ob es das wirklich war, darüber denkt sie heute noch manchmal nach:
„Vor allem an ein Erlebnis erinnere ich mich sehr deutlich. Es wurde damals doch immer nur vorübergehend geheizt. Ich hatte den Küchenherd angemacht, um zu kochen, als der Florian kam. ‚Hu‘, sagte er, ‚ist es kalt!‘ Es war ja auch kalt, es war eisiger Januar. Ja, sagte ich, auch der Herd geht gleich aus. Da nahm er einen Küchenstuhl, stellte den auf den Herd und setzte sich drauf. Das machte mich stutzig – irgendwie kam es mir seltsam vor. So östlich – wie bei den Russen. Aber als mir das richtig zum Bewußtsein kam – später, in der Zelle erst, als ich viel Zeit zum Grübeln hatte – da war es zu spät.
An den Ritterkreuzträger – nein, daran habe ich schon damals nicht geglaubt. Aber ob der Florian nicht ein Spitzel war?“
Durch Florian hatte Frau Kunze auch zwei andere junge Frauen kennengelernt, Ursel Liebner und Hanna Schumann, die sich dann mit ihr zusammen vor dem sowjetischen Kriegsgericht wiederfanden:
„Ursels Eltern hatten ein Lokal, eine altdeutsche Gaststube mit einem kleinen Hotel dabei. Hanna und ihre Eltern wohnten damals dort. Hanna half in der Küche aus, wo auch für Russen gekocht werden mußte. Ursel hatte während des Krieges in Frankreich studiert. Sie war gerade erst nach Hause zurückgekommen.
Die beiden jungen Frauen waren befreundet. Und Florian – ja, irgend jemand hatte ihn auch zu Ursels Eltern gebracht. Die hatten ihn aufgenommen und er kriegte da auch was zu essen. So kamen wir alle an ihn, und über ihn wurden wir auch miteinander bekannt. Denn einmal, als die beiden Mädchen ihn suchten, fiel ihnen ein, er hätte meine Adresse genannt. So kamen sie bei mir an, Ursel mit einem Hund, einem Riesenschnauzer so groß wie ein Kalb.
Die beiden fanden es so gemütlich bei mir, dass sie immer wieder kamen und mit den Kindern spielten. Die waren ja wirklich goldig damals, im süßen Alter von zwei und fünf.“
Auch Ursel Liebner und Hanna Schumann, für die Florian zum Schicksal geworden ist, begannen nach ihrer Verhaftung an seiner Identität zu zweifeln. Hanna Schumann heute:
„Es war Silvester 1945. Da kam ein angeblicher Offizier, Ritterkreuzträger, wie er sich ausgab, aus Beuthen in Schlesien. Uns hat er erzählt, er hätte der Irene Kunze eine Nachricht ihres gefallenen Mannes gebracht. Er brachte zwei junge Frauen mit, Thekla Sommer und Erni Kaiser, die inzwischen verstorben ist. Auch Ursel Liebner lebt übrigens heute nicht mehr. Beiden Frauen hatte der Mann, der sich mit Vornamen Florian nannte, versprochen, sie in den Westen zu bringen. Doch vorerst waren alle drei in Suhl gelandet. Sie wohnten in Liebners Fremdenzimmern und aßen in der Gaststube unten. Liebners fütterten alle drei mit durch.
Am Silvesterabend saßen wir Hausbewohner alle im Gastzimmer beisammen. Da sagte dieser bewußte Offizier, es würde nun alles wieder gut werden. Der Russe werde wieder rausziehen. Und wir würden wieder frei werden. Wenn wir mit dem Westen gingen, würde uns nichts passieren. Ja, das hat er so erzählt. Aber was sollten wir schon dazu sagen? Von irgend etwas Politischem war sonst gar nicht die Rede.“
Bei einer Routine-Razzia gegen Jahresende 1945 hatten russische Soldaten auch das Lokal und die Fremdenzimmer durchkämmt. Einer hatte dabei an Hanna Schumanns Armbanduhr zu viel Gefallen gefunden und sie eingesteckt.
„Ja, da hatte also einer meine Uhr mitgenommen. Und jetzt, bald nach dem Sylvesterabend, erscheinen eine Russin und zwei Russen mit Revolvern bei uns. Ursel Liebner hatten sie schon im Hause erwischt und holten nun auch mich aus der Wohnung raus. ‚Anziehen! Kurz mitkommen zur Kommandantur!’ Ich denke, das ist wegen meiner Uhr. Und die Liebners und meine Eltern waren ganz erstaunt, sagten: ‚Was ist denn los da im Hausflur?’
Diese Russin nahm eine Mappe mit all meinen Zeugnissen und Schuldokumenten mit. Wir wurden gar nicht gefragt. Und dann haben sie bei Liebners ausgeräumt! Alles mögliche, was die so an Wertgegenständen hatten.
Wir sollten mit zur Kommandantur. Und kommen runter, da steht schon ein Auto, ein größerer Wagen, und wir zwei da rein. Und wie wir auf den Gefängnishof kommen, in Suhl, da steht dort – im Gefängnishof – schon alles voller Menschen. Der Hund von Liebners ist dem Wagen nachgelaufen bis zum Gefängnis. Das hat man uns hinterher erzählt, als wir nach vielen Jahren nach Hause kamen. Der Hund ist noch tagelang von der Wohnung zum Gefängnis gelaufen und hat uns gesucht.
Ja, dann waren wir also weg, Irene Kunze, Erni Kaiser, Ursel Liebner, Thekla Sommer und ich auch. Auch die junge Hedda Böhler gehörte dazu, eine 16-Jährige, deren Großvater der älteste Kommunist unseres Ortes war. Selbst da haben sie nicht Halt gemacht. Nur der Mann, der sogenannte Florian, der war weg.
Wir wurden nach Schmalkalden geschafft. Dort landeten wir in einem Keller. Vier Wochen weiter wurden wir nach Weimar gebracht. Da war das große Tribunal – und wir waren plötzlich eine illegale Organisation. Dabei war nichts gewesen, als dass wir am Silvesterabend im Lokal zusammengesessen hatten, und der sagte ‚Nun wird alles wieder gut’. Pro-westlich eben. Das war es. Aber wir haben uns nie zusammengetan. Es hat nie eine Zusammenkunft gegeben – nur den einen einzigen Abend am Silvestertag.“
Zwei Frauen – zwei Seiten einer Alltagsgeschichte jener Zeit, so banal wie nur irgend eine. Vor dem Tribunal hörte sich alles plötzlich ganz anders an. Frau Kunze fand sich wieder als Haupt einer Verschwörung – als „Eckmann“, wie sie selbst es beschreibt, zu der sich dreizehn junge Frauen und Mädchen zusammengefunden haben sollten. Manche, wie Hedda Böhler, waren kaum dem Kindesalter entwachsen. Nur sieben stammten aus Suhl, und die meisten sahen sich vor dem Tisch des Tribunals zum allerersten Male. Der angebliche Frontsoldat, dem alle Familien geholfen hatten, war nicht dabei. Und so verstärkte sich der Verdacht, dass er ein Spitzel des NKWD gewesen war. Manche Deutsche verdienten sich seinerzeit in der Sowjetischen Besatzungszone auf solche Weise eigene Straffreiheit für politische Verstrickungen – oder auch nur ein Stück Speck zum trockenen Brot. 3.083 Deutsche zählte, wie man heute weiß, das Spitzelnetz des NKWD schon im Frühjahr 1946. Dazu über 100 Russen und Polen, die schon Anfang 1945 geworben worden waren.
Mehr als 3.000 Spitzel gegen weniger als 17 Millionen Menschen – das war ungeheuer viel, wenn man es mit der Zahl der Denunzianten vergleicht, die in der Nazizeit für die GESTAPO tätig waren: es waren 3.000 bis höchstens 5.000 Personen gegen rund 80 Millionen gewesen. Die STASI in der späteren DDR sollte es gegen 16 Millionen Bürger sogar auf 173.000 ‚inoffizielle Mitarbeiter’ bringen. Ein absoluter Rekord!
Doch zurück zu Irene Kunze. Sie hatte angeblich auch noch einem amerikanischen Freikorps angehört und 150 Russen umgebracht. Dabei hatte sie weder mit einem Amerikaner noch mit einem Russen je auch nur ein Wort gewechselt. In ihrer Hohenecker Gefangenenkarte ist auch nur eine „Mitgliedschaft in faschistischer Untergrundorganisation“ vermerkt.
Irene war nicht die einzige SMTerin, der in den Vernehmungen ein solcher Massenmord angelastet wurde, ohne dass er später als Grund der Verurteilung in den Akten erschien. Ein „amerikanisches Freikorps“ gab es natürlich auch nur in der Phantasie der Vernehmer. Die Anklage machte also nicht allzuviel Sinn. Aber kam es vor sowjetischen Gerichten je darauf an? Irene Kunze:
„Mein Vernehmungsoffizier hat gewußt, dass das alles nicht stimmen kann. Natürlich hat der das gewußt. Aber die kriegten ihre Urteile doch immer fertig – gleich mit Begründung. Das war doch alles schon vorher fertig, haben sie mir jedenfalls von allen Seiten gesagt …“
Der ganze Fall also nichts als eine Provokation, der Phantasie des NKWD entsprungen? Was der russische Historiker Michail Semirjaga inzwischen dazu veröffentlicht hat, legt eine solche Vermutung nahe. Semirjaga war seinerzeit Mitarbeiter der Sowjetischen Militär-Administration in Karlshorst. Über die Lage dort am Ende des Jahres 1945 hält er fest:
„Es häuften sich Fälle von terroristischen Aktionen (…). So wurde es jedenfalls in einem der Rapporte der Führung der Inneren Truppen des NKWD in Deutschland behauptet.
Derartige Ereignisse können in Einzelfällen durchaus vorgekommen sein. Aber sie stellten (…) keine ernsthafte Bedrohung dar. Jedenfalls haben weder ich noch meine Kollegen jemals von solchen Vorfällen gehört. Schon wenige Wochen nach Abschluß der Kampfhandlungen trugen wir keine persönlichen Waffen mehr und fühlten uns völlig sicher. (…)
Aber die Erkenntnis, dass in der Besatzungszone eine im großen und ganzen entspannte Lage herrschte, entsprach nicht den Intentionen General Serows und seiner Untergebenen, die nach einiger Zeit wieder begannen, Alarm zu schlagen. So wurde im Dezember vermerkt, dass (…) ‚eine gravierende Aktivierung der anglo-amerikanischen Aufklärung vor sich ging’.“
General I.A. Serow war als Stellvertreter des obersten NKWD-Chefs Berija in Moskau Chef des NKWD in Deutschland – in der Sowjetischen Besatzungszone. Ihm lag daran – auch das spricht Michail Semirjaga deutlich aus –
„zu demonstrieren, wie wichtig und notwendig es sei, in der sowjetischen Zone über starke Kräfte des NKWD/ Innenministeriums zu verfügen.“
Und so scheute der NKWD kein Mittel, Belege für seine Unentbehrlichkeit und für die Wirksamkeit seiner Tätigkeit beizubringen.
Eine „erhöhte anglo-amerikanische Aufklärungstätigkeit“ also wollten diese Organe um die Jahreswende 1945/46 festgestellt haben. Um die gleiche Zeit, im April 1947, tauchten auch in der Presse der SBZ Schwindelmeldungen über „englische Freikorps“ auf – so seinerzeit im privaten Tagebuch eines Journalisten festgehalten. Kann man es danach noch als Zufall betrachten, dass die Hausfrau Irene beschuldigt wurde, mit den Engländern zu konspirieren?
Am Vollzug der Todesstrafe, die der Vernehmer ihr bündig vorausgesagt hatte, kam sie – begnadigt – gerade noch vorbei. Aber wie viele zitternd-schlaflose Nächte bis zu der Gewißheit, sie dürfe weiterleben!
Und so verlief die Gerichtsverhandlung:
„Es kamen russische Offiziere. Der oberste von ihnen hatte so viele Orden auf der Brust, dass das Blech richtig klapperte. Und er hatte zwei scharfe Hunde neben sich … Ich sehe mich noch da stehen, wie er sagt: ‚Sie sind … im Freikorps, Sie haben 150 Russen …‘ – Ich dachte, die wollten mich veralbern, ich habe wirklich gedacht, die machen einen Witz! Und da sagte er, weil ich so lächelte und ihn anguckte, da sagt er: ‚Haben Sie das verstanden?‘ Ich sage ‚Nein, das habe ich gehört, aber verstehen kann ich das nicht. Es gibt kein Freikorps.‘ – Und ich wollte noch sagen: ‚Ich habe noch nie mit einem Russen gesprochen.‘ Aber dazu kam ich gar nicht. Der ging hoch! Wie ein Wilder! Und die Hunde, so ganz kurz an der Leine, die hatte ich vor der Brust! Diese gefletschten Zähne und diese Augen … !
Da sagt er noch einmal: ‚Verstehen Sie es?‘ Und ich habe vor Angst gesagt: ‚Ja, ich verstehe.‘ – ‚Und unterschreiben Sie?‘ – ‚Ja, ich unterschreibe.‘ – Die Viecher hätten mich gefressen! Die waren ja auf Menschen dressiert!
Scharfe Schäferhunde, ja. Die hatten alle Schäferhunde damals, und die liefen ja auch immer neben uns her. Ich weiß noch – zu Fuß durch die Stadt wurden wir getrieben, nach Bautzen auf dem Transport. Später, in Bautzen, da haben sie solche Hunde mal hinter einem Gefangenen hergeschickt. Er hatte einen Fluchtversuch gemacht, und sie brachten ihn fast stückweise wieder zurück. So was Grausiges hatte ich noch nie gesehen. Ich konnte erst gar nicht begreifen, was es mit diesem armen Blutfetzen da auf sich hatte, den sie auf einer Pritsche vorbeigeschleppt brachten. Da hat die Angst mich nachträglich noch einmal so richtig gepackt!“
Dazu noch einmal Hanna Schumann, die ebenfalls verurteilt worden war – zu zehn Jahren:
„Zehn Jahre – wie ich das getragen habe? Indem ich sagte, das ist ein erlogenes Urteil. Das trifft auch die anderen unverdient, also trage ich es mit.
Ich bin ein Mensch, der sagt, man muß hinnehmen, was gegeben wird. Und wenn es zu unrecht geschehen ist, dann gibt das mir eine innere Ruhe, und ich sage: Ich kann schwören, ich bin kein Freikorps-Anhänger oder irgend etwas gewesen! Und dann ist bei mir ein Strich. Da hört es auf. Ich kann nicht hassen.“
Zehn Jahre Zwangsarbeit waren seinerzeit die höchste zeitliche Strafe. Auch Todeskandidaten wie Irene Kunze erhielten diese zehn Jahre, wenn sie begnadigt wurden.
Irenes Fall-Kameradin Hanna gehörte zu denen, die schon im Januar 1954 nach Hause gehen durften – anläßlich der ersten großen SMTer-Amnestie, die in Moskau erlassen worden war. Auch dazu gibt es wieder eine wahre, bezeugte Geschichte. Eine Haftkameradin, die alle kannten, Raisa Dittrich, spielt darin eine Rolle:
„Manchmal war es unheimlich mit Raisa, was sie so sagte! Wir machten Rundgang im Hof, da sagt sie: ‚Seht Ihr da oben die Saatkrähen auf der Wetterfahne, oben auf dem Turm? Guckt mal, wo die hinzeigen! Eine sitzt so, eine sitzt nach dem Osten, eine nach dem Westen’. Sagt sie. ‚Nun wartet mal ab. Da tut sich was!’ Und es war nur wenige Tage später, wir waren in der Schneiderei, da holt sie uns ans Fenster und sagt: ‚Da drüben werden Sachen abgeladen. Frauenbekleidung’. Sagt sie. ‚Und nun kommen wir bald nach Hause!’
Und wir kommen von der Schicht in den Saal zurück. Da sagt sie zu mir: ‚Hanna’, sagte sie zu mir, ‚laß die Schuhe gleich an. Die rufen dich heute noch.’ Ich sage: ‚Na schön, ich lasse die Schuhe noch an.’ Habe nachgegeben, um sie nicht zu reizen oder zum Widerspruch rauszufordern. Sie war ja oft ein bißchen exaltiert. Und es dauert nicht lange, da geht die Tür auf: ‚Strafgefangene Schumann, kommen Sie mit!’ Ich wurde nach vorne geholt, in die Verwaltung. Und da sagte der Kommandant: ‚Was würden Sie sagen, wenn Sie in wenigen Tagen entlassen würden?’ – Sage ich: ‚Ich lege keinen Wert drauf. Die letzten zwei Jahre von meinen zehn schaffe ich auch noch.’ Sagt er: ‚Da können wir aber nichts tun, das ist ein Gnadenerlaß aus der Sowjetunion.’ Da sage ich: ‚Na, dann muß ich ja gehen!“
Die – scheinbare – Bereitwilligkeit, freiwillig und ohne Not noch zwei weitere Zuchthausjahre durchzumachen, ist erklärungsbedürftig. Mit solchen Schalmeientönen – „Was würden Sie sagen, wenn …“ – begann in der Regel die Anwerbung zu Spitzeldiensten. Hannas brüske Antwort sollte jedem solchen Angebot die Grundlage nehmen.
Als Hanna Schumann dann aus der Verwaltung zurückkam:
„Totenstille im ganzen Saale. Alle starrten mir schweigend entgegen. Als ich alles erzählt hatte, noch immer kein Laut! Weil die Raisa das vorausgesagt hatte. Sie hat viele Dinge uns gesagt, wo wir immer nicht glauben wollten. Aber dann geschah es doch.
An dem Tag war ich die Einzige, die rausgeholt worden ist- wie Raisa vorhergesagt hatte.“
Wenig später als Hanna Schumann wurde auch Irene Kunze entlassen. So hatte auch sie acht Jahre ihrer „Strafe“ verbüßt – zuerst im Zuchthaus Bautzen, dann im sowjetischen ‚Speziallager’ Sachsenhausen, dem alten nationalsozialistischen KZ. Seit 1945 standen beide Orte ja unter sowjetischem Regime. Als Irene 1950 mit allen anderen SMT-er auf deutschem Boden an die Volkspolizei der DDR übergeben wurde, folgten auch für sie weitere schwere Jahre in Hoheneck, der offiziellen ‚Sonderstrafanstalt’ für SMT-erinnen, in dem das gleiche besonders grausamen Regime im Schwange war, wie es in den politischen Männerzuchthäuser galt. Dort, in Hoheneck, war es auch, wo Irene Kunze nach vier Jahren völliger Ungewißheit endlich erfahren hatte, dass ihre Kinder im Westen in Sicherheit waren.