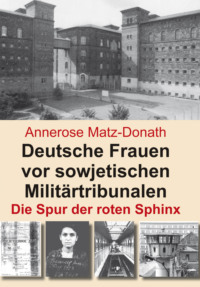Kitabı oku: «Deutsche Frauen vor sowjetischen Militärtribunalen», sayfa 8
Der Fall Kubowski folgte einem klassisch gewordenen Muster. Vielleicht wurde er sogar überhaupt zum Modell für den Menschenfang, den NKWD und STASI bis weit in die DDR-Zeit hinein in Westberlin betrieben. Immer hatten dabei westliche „Schlepper“ die Hände im Spiel. Um die Opfer ohne Anwendung von Gewalt über die Grenze zu bringen, nutzten sie private oder berufliche Kontakte. Etwa so:
Eine Einladung wurde organisiert. Anlässe dieser oder jener Art fanden sich immer. Manchmal – am Tage – goß man dem Opfer dabei ein Betäubungsmittel ins Glas, um es leichter über die Grenze schaffen zu können. Manchmal – abends – genügte auch schon ein anderer, einfacher Trick, der „Zielperson“ habhaft zu werden. Der Vorschlag zum Beispiel, sie nach der Feier mit dem Auto nach Hause zu bringen. In einer Zeit, in der auch im Westen erst wenige Leute über einen privaten Wagen verfügten, nahm jeder solch freundliches Angebot gerne und ohne Argwohn an. Noch unverfänglicher wurde die Sache, hatte man das Opfer schon zur Veranstaltung hingefahren. In deren freundlichem Ausklang ließ sich im Auto leicht angeregt plaudern. So wurden, besonders im Dunkeln, die Passagiere der Fahrtroute gar nicht gewahr – bis an der Grenze ein Schlagbaum hochging und harte Fäuste sie aus dem Wagen zogen.
Genau so war es Jutta ergangen. Nur mit einem Unterschied: Nicht sie war die „Zielperson“ gewesen. Die Entführung galt einem leitenden Westberliner Redakteur, der auf dem Sprung nach Westdeutschland stand. Dort wartete auf ihn eine führende politische Position. Juttas Unglück war es, dass sie in solcher Begleitung einen festlichen Abend verbrachte und ihn mit diesem Kollegen gemeinsam verließ. Doch obgleich sie nur ein „Zufalls-Fang“ war, war von wieder nach Hause dürfen auch für sie keine Rede. Auch ihre Schwangerschaft stimmte niemanden milder.
Vier Monate hungerte sie und fror wie alle andern, bis sie vors Tribunal kam. Dann – die Entbindung stand kurz bevor – wurde sie nach Hoheneck abgeschoben. Die Geburt war so schwer, dass sie Mutter und Kind fast das Leben gekostet hätte.
Das Baby wurde am 26. März 1950 geboren. Es gehörte, kaum vier oder sechs Wochen alt, zu denen, die dem ersten „Hohenecker Kinderraub“ zum Opfer fielen. Mehr als zwei Jahre kämpfte Juttas Familie dann, bis sie endlich die Kleine zu sich holen durfte. Als das Kind endlich seine leibliche Mutter kennenlernte, war aus dem Säugling ein kleines Mädchen geworden, das gerade zur Schule kam. So sehr die Mutter auch jahrelang um das Herz ihres Kindes kämpfte – lebenslang blieb die Beziehung kalt und das Verhältnis bis übers Grab hinaus schwer gestört.
Jutta Kubowskis Geschichte ist hier nach den Erinnerungen ihrer langjährigen Haftkameradin und Freundin Betty Prüfer und nach Unterlagen der DDR aus den Jahren 1951/52 – heute im Bundesarchiv – erzählt. Denn Jutta lebt nicht mehr. In den HOHENECKER PROTOKOLLEN aber hat sie vor Jahren schon ausführlich berichtet, wie man sie an der Grenze aus dem Wagen zerrte und zum Weitertransport in eine andere Limousine stieß. Schwere Armee-Pistolen im Rücken halfen dabei nach. Eine wurde ihrem Kollegen über den Schädel gezogen. Blutüberströmt hat sie den, der ihr unfreiwillig zum Schicksal wurde, damals zum letzten Male gesehen.
Jahrelang haben NKWD und STASI immer wieder gewaltsam Menschen aus dem Westen nach Ostberlin entführt. Das Berliner Museum am „Checkpoint Charly“ hat die Zahlen gesammelt. Bis 1993 waren dort für die Zeit zwischen 1945 und 1950 beweisbare 600 Fälle notiert. In den folgenden Jahren bis 1967 wurden noch einmal 273 Menschen aus dem Westen verschleppt. Mindestens zwanzig davon ereilte dies Schicksal, obwohl es bereits die Mauer gab, die Berlin in zwei Teile zerschnitt. Fast 900 Opfer illegaler, völkerrechtswidriger Praktiken also – soweit die Fälle bekannt geworden sind und registriert werden konnten.
Nicht alle, die diesem organisierten Menschenraub zum Opfer fielen, kamen wenigstens mit dem Leben davon. Dr. Walter-Erich Linse wurde das Glück der Heimkehr nicht zuteil. Linse war Abteilungsleiter im UFJ, wie man den „Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen der Sowjetzone“ abgekürzt nannte. Flüchtlinge aus der Sowjetzone hatten diesen Ausschuß in Westberlin gegründet, um in der SBZ Verfolgten und ihren Angehörigen beizustehen. So übermittelte – um einen in den Akten der DDR dokumentierten Fall herauszugreifen – am 20. Februar 1951 der UFJ dem Chef der Sowjetischen Kontrollkommission in Karlshorst, Armee-General Tschuikow, folgendes Schreiben:
„Verschiedene und immer häufiger werdende Fälle gaben uns Veranlassung, am 14. Februar 1951 folgende Information dem Rundfunk und der Presse bekanntzugeben:
‚Die Leitung der politischen Strafanstalt in Bautzen hält es nicht für nötig, die Angehörigen vom Tod eines Inhaftierten zu unterrichten. Nach den Ermittlungen des ‚Untersuchungsausschusses Freiheitlicher Juristen’ beschränkt sie sich einfach darauf, Briefe und Pakete als unzustellbar zurückzusenden.
Weder die Hauptverwaltung der sogenannten Volkspolizei noch die Kanzlei des ‚Staatspräsidenten’ Wilhelm Pieck oder das Innenministerium pflegen Rückfragen zu beantworten.
Da wir annehmen, dass es sich bei diesem offenbar böswilligen Verhalten deutscher Dienststellen der DDR um eine Maßnahme handelt, mit der die sowjetische Kontrollkommission keinesfalls einverstanden sein kann, bitten wir, für Abstellung dieser Mißstände Sorge tragen zu wollen.“
Schon wenige Wochen später gab es darauf eine interne Reaktion der „Hauptverwaltung Volkspolizei“, in deren Verantwortung die Verwaltung der Haftanstalten lag. Wenigstens Familien in Westberlin und Westdeutschland konnten nun hoffen, über den schlimmsten Fall in Zukunft korrekt informiert zu werden. Bis dahin wurde der Tod von Inhaftierten den Angehörigen nur angezeigt, wenn diese ausdrücklich eine solche Bescheinigung angefordert hatten. Doch welcher Angehörige hätte das Herz gehabt, in aller Angst der Ungewißheit, zwischen Hoffen und Bangen um das Leben eines geliebten Menschen, sogleich ein solches Papier zu verlangen? Einen zuverlässigen Anhaltspunkt, dass jemand verstorben war, hatte ja nicht einmal das rohe Verfahren geboten, das der Brief des UFJ beschreibt. Hätte eine solche Rücksendung nicht auch auf einer Verlegung oder einfach auf einem bürokratischen Fehler beruhen können? Wer fordert da sogleich eine Todeserklärung an?
Dennoch blieben – im Prinzip – die Behörden der DDR dabei, die Regel sei „bürgerlich“ und „überlebt“, „dass der Lebende den Gerichten, der Tote aber der Familie gehört“. Deshalb wurden die Leichen von in der Haft verstorbenen SMTern weiterhin stillschweigend eingeäschert. Die Urnen verblieben zuerst bei den Krematorien, wurden teilweise auch namenlos verscharrt. Später, seit September 1950, nahmen die Strafanstalten die Asche zurück. In Hoheneck wurde der Dachboden der Verwaltung zum Urnen-Depot. Noch 1990, nach dem Zusammenbruch der DDR, kugelten dort die sterblichen Überreste von Menschen in blechernen Gefäßen herum, als wären es Abfallbehälter.
Unter denen, für die Dr. Linse und der UFJ sich eingesetzt hatten, war mindestens eine der Frauen auf Hoheneck, Leonore Schwitter. Ihre schon betagte Mutter hatte in der Sorge um ihre verhafteten Kinder 1950 beim UFJ Rat gesucht. Neben der Tochter waren auch beide Söhne, Studenten, verschwunden. Bei ihrem Besuch in Westberlin hatten Spitzel die alte Dame fotografiert. Als sie nach Rostock zurückkam, warteten da schon die Häscher. Die Sechzigjährige wurde zu fünfundzwanzig Jahren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt – für angebliche „Spionage“. Ohne Rücksicht auf ihr hohes Alter und ihre schwache Gesundheit wurde sie wirklich in die eisigen Weiten des russischen Ostens geschleppt. Erst im Oktober 1955 kam sie als „begnadigter Kriegsverbrecher“ wieder nach Hause – mit dem gleichen Transport wie die junge Claudia Mühlstein, die man 1950 in Westberlin eingesackt hatte. Dabei hatten bis zu ihrer gewaltsamen Deporation beide Frauen sowjetischen Boden niemals betreten. Dass sie von „Spioninnen“ nun gar zu „begnadigten Kriegsverbrecherinnen“ herabsinken mußten, was machte das schon, da sie sich weder der Spionage noch irgendeines anderen Verbrechens schuldig wußten?
Doch zurück zum Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen, dem UFJ. Ins Visier hatten ihn die russischen Kommunisten schon bei seiner Gründung genommen. Seit die STASI existierte, observierte auch diese sein Wirken. Auf verschlungenen Wegen kam manche Zufallsmeldung hinzu wie die folgende vom 31. März 1951:
„Probst Grüber lernte bei einer Festlichkeit in Westberlin eine Frau kennen, die ihm mitteilte, dass sie Kassiber aus Waldheim bearbeitet, die bei der ‚Vereinigung der Freiheitlichen Juristen‘ in Berlin-Zehlendorf, Lindenthaler Allee, eingehen.
Vorstehendes gab Herr Mund hier bekannt, da Probst Grüber ihm dies zur Kenntnis gab.“
Probst Grüber war der Beauftragte der Evangelischen Kirche bei der Regierung der DDR. Schon mit seiner Beschreibung der – angeblich! – so guten Lebensverhältnisse im KZ Sachsenhausen im Dezember 1949 verdiente er sich die dauernde Verachtung aller ehemaligen Sachsenhauser. Angeblich – wenn man der Aktenlage vertrauen will! – soll Grüber später jedoch jahrelang bemüht gewesen sein, das Los der kurz darauf -1950 – in deutsche Zuchthäuser überstellten Menschen zu erleichtern.
Pfarrer Mund – mit dem Rang eines „Volkspolizei-Kommandeurs“ – war von der Regierung der DDR zur „geistlichen Betreuung“ der SMT-Gefangenen eingesetzt worden. Sein Wirken gehört auch ins Kapitel Hoheneck, über das man heute im Bundesarchiv vieles nachlesen kann und über das noch zu berichten sein wird.
Den Juristen Linse, der im UFJ zu den aktivsten Köpfen zählte, kostete sein Einsatz für andere Verfolgte das eigene Leben. 1952 ließen STASI und NKWD ihn entführen – durch vier Berufsverbrecher, deren Namen inzwischen lange bekannt sind.
Der Fall erregte damals die Öffentlichkeit weit über die deutschen Grenzen hinaus. Doch alle Proteste, auch internationale Interventionen, verliefen im Sande. Allenfalls wurden Frager mit perfiden Lügen bedient. Die Sowjets waren gar dreist genug, den Amerikanern die Verantwortung für Linses Verschwinden zuzuschieben. Schließlich habe der Vorfall sich ja im amerikanischen Sektor zugetragen!
Wenig später erklärte der damals höchste Repräsentant der Sowjetunion in der DDR, General Tschuikow, definitiv, „ein gewisser Linse“ befinde sich nicht in sowjetischem Gewahrsam. Damit waren in Moskau und Ostberlin zum Fall Linse die Akten geschlossen. Für immer? Die Geschichte hat es anders gewollt. Auch diese politischen Lügner und Henker von damals holte schließlich die Wahrheit ein.
Die SMTer, für die sich Linse einst eingesetzt hatte, vergaßen ihn nicht. So stellte nach Öffnung der russischen Gerichtsarchive ein deutscher Workuta-Häftling in Moskau den Antrag, dem Fall Dr. Linse nachzuforschen. Jetzt wehrte keiner mehr ab. Der so lange Verleugnete wurde posthum rehabilitiert. Das war – am 8. Mai 1996 – nach 44 Jahren die erste sichere Auskunft über sein Geschick.
Walter-Erich Linse, so ist nun dokumentarisch bezeugt, war am 23. September 1953 – sechzehn Monate nach seiner Entführung – durch das „Militärtribunal der Einheit 48240“ zum Tode verurteilt und noch am gleichen Tage erschossen worden – als schuldloses Opfer „politischer Repression“, wie der russische Terminus in den Rehabilitationsdokumenten lautet.
Von den Hoheneckerinnen kann keine aus eigenem Erleben berichten, wie der „Fall Linse’“ sich damals, im Juli 1952, zugetragen hatte. In den frühen 50er Jahren saßen die Frauen alle noch in strengster Isolierung auf ihrer verfallenen Burg. Deshalb hier ein Bericht aus dem HAMBURGER ABENDBLATT, das am 12. Juli 1996 anläßlich Linses Rehabilitierung noch einmal die Vergangenheit beschwor:
„Rückblende in das Berlin der vierziger und fünfziger Jahre. Eine geteilte Stadt, aber noch mit offenen Grenzen. Es war kein großes Problem, vom Westteil Berlins in den sowjetisch besetzten zu kommen und umgekehrt.
Damals arbeitete in Westberlin der 1949 gegründete ‚Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen’, eine Menschenrechtsorganisation. Sie kümmerte sich unter anderem um Männer und Frauen, die vom sowjetischen Geheimdienst oder vom Staatssicherheitsdienst der DDR verhaftet worden waren.
Sehr oft waren diese Menschen einfach verschwunden. Niemand in den Amtsstuben der DDR oder der sowjetischen Besatzungsmacht wollte etwas wissen. Die verzweifelten Angehörigen stießen auf eine Mauer des Schweigens.
Dr. Walter Linse, 1903 in Chemnitz geboren, 1949 nach Westberlin geflüchtet, war Abteilungsleiter im Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen. Es läßt sich leicht denken, dass alle Mitglieder dieser Institution wegen ihres Eintretens für verhaftete, verfolgte und unterdrückte Menschen zu den erklärten Feinden der Kommunisten zählten. Walter Linse haßten sie besonders. Und getreu der These Lenins, wonach nur schlechte Revolutionäre es nicht verstünden, illegale Kampfmethoden mit den legalen zu verknüpfen, gingen sie gegen ihn vor.
Am Morgen des 8. Juli 1952 machte sich Linse wie gewöhnlich auf den Weg zu seiner Dienststelle. Auf der Straße bat ihn ein kräftiger Mann um Feuer. Arglos wollte Linse sein Feuerzeug ziehen, als er plötzlich von seinem Gegenüber gepackt und zu einem nahestehenden Auto gezerrt wurde. Dort befanden sich noch drei andere Männer. Linse wehrte sich verzweifelt. Doch der Übermacht war er nicht gewachsen. Er wurde in den Wagen gestoßen, und ab ging’s in rasender Fahrt Richtung Grenze.
Der Fahrer eines anderen Autos hatte den Überfall beobachtet und nahm die Verfolgung auf. Er wurde von den Entführern beschossen. Eine Kugel traf seinen Wagen. Außerdem warfen die Verfolgten spitz zugefeilte Eisenstücke auf die Straße. Der andere Wagen mußte deshalb die Verfolgung abbrechen. Unter dem bereits geöffneten Schlagbaum an der Grenze hindurch entkamen die Entführer.
Der Vorfall, längst nicht die erste, aber die spektakulärste und dazu eine beobachtete Entführung, löste im freien Berlin eine Welle der Empörung aus. Vor dem Schöneberger Rathaus versammelten sich an die 20.000 Berliner zu einer Kundgebung. Bürgermeister Ernst Reuter sprach zu ihnen. ‚Jetzt muß unsere Geduld ein Ende haben,’ rief er zornig aus. Die Vereinten Nationen wurden eingeschaltet, internationale Rechtsanwaltsorganisationen protestierten, der Bundestag trat zu einer Sondersitzung zusammen – alles blieb ergebnislos.
Die DDR und die Sowjetunion erklärten, von Linse nichts zu wissen. Die Sache habe sich schließlich im amerikanischen Sektor von Berlin ereignet, hieß es zynisch. Da könne man keine Auskunft geben.
Ein Jahr später wurde der Gewohnheitsverbrecher Kurt Knobloch bei einem geplanten Einbruch in Westberlin verhaftet. Bei den Verhören stellte sich heraus, dass er zu den vier Entführern Linses gehörte. Eine kriminelle Bande war dazu vom Staatssicherheitsdienst der DDR angeheuert worden. Die Namen der drei anderen waren Harry Bennewitz, Herbert Krüger und Kurt Borchard. Letzterer, ein Berufsringer, war der Mann, der Linse in das Auto gezerrt hatte. Weil dessen Füße noch aus dem Wagen ragten und deshalb die Autotür nicht geschlossen werden konnte, schoß Bennewitz Linse in beide Beine. Jeder aus der Bande war vom Staatssicherheitdienst Ostberlins mit 1000 Mark entlohnt worden.
Knobloch wurde wegen Freiheitsberaubung zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Doch von dem Entführten fehlte weiterhin jede offizielle Nachricht.“
1960 schien es einmal, als sollte sich endlich das Dunkel um Walter Linses Schicksal lichten. Dem Deutschen Roten Kreuz war aus Moskau ein Walter Linse als am 15. Dezember 1953 in der Sowjetunion verstorben gemeldet worden. Doch ein anderer Walter Linse war angeblich gemeint. Es soll ein deutscher politischer Häftling gewesen sein, der 1953 in der berüchtigten sibirischen Strafregion Workuta gestorben wäre. Nur seltsam, daß der angebliche Namensvetter im gleichen Jahre gestorben sein soll wie der echte Walter-Erich Linse. Und nur drei Monate trennen das Datum vom nun bekannten Todestag im September 1953.
Walter Linse hilft die Rehabilitation nicht mehr. Sie dokumentiert nur einen der aufsehenerregendsten Menschenraubfälle im geteilten Berlin der fünfziger Jahre. Und sie ist ein weiterer Beleg, mit welchem Zynismus sowjetische und deutsche kommunistische Organe jahrzehntelang schwerste Verbrechen begangen – und geleugnet haben!
Den Paragraphen, auf Walter-Erich Linses Rehabilitationsbescheid, ist zu entnehmen, wofür er sterben mußte: Für „Spionage und Bildung einer illegalen Organisation“. Damit war seine offizielle Tätigkeit in Westberlin gemeint.
Ist Dr. Linses Todestag nun auch bekannt, so weiß doch keiner den Ort, an dem er begraben liegt – wenn ihm denn überhaupt eine eigene Stätte der letzten Ruhe vergönnt worden ist. Deshalb sei ihm an dieser Stelle ein ehrendes Denkmal gesetzt.
Recherche ins Abseits
Eine andere junge Deutsche aus dem Westen, Maria Bergmann, Journalistin, war ihren Häschern freiwillig in die Arme gelaufen. Keine Rede davon, dass sie Kommunisten verteufelt hätte. Die hatten damals übrigens noch Sitz und Stimme im Deutschen Bundestag in Bonn. Weltoffen und ohne Vorbehalte wie der größte Teil der jungen Generation, zu der sie gehörte, setzte sie aber auf saubere Recherche. So nahm wiederum ein Schicksal seinen Lauf:
„Jeder Redakteur kriegt ja Pressedienste. Und es gab keinen Pressedienst, in dem nicht über die fürchterlichen Zustände in der Ostzone geschrieben worden ist. Massenhaft! Ob das wirklich wahr sein konnte? Da habe ich gesagt, da fahre ich hin. Das will ich wissen. Ich habe gedacht, selbst wenn es stimmen sollte – ich komme aus einer verfolgten Familie, was soll mir passieren? Keiner von uns ist Nazi gewesen. Zwei Familienmitglieder sind im KZ umgekommen, in Dachau. Also habe ich mich dann um Reisepapiere bei unseren Besatzungsbehörden bemüht. Man brauchte für eine solche Reise ja Ausweise von der Besatzungsmacht. Hat ewig gedauert, natürlich. Ich habe also meine Papiere gekriegt, bin da hingefahren. Und nach vierzehn Tagen war ich schon verhaftet.“
In Leipzig, der Stadt der Drucker, begann sie mit ihrer Nachfrage:
„Ich hatte mir alle meine Presseausweise mitgenommen, von allen Stellen, für die ich gearbeitet habe. Darunter war auch ein französisches Umfrage-Institut – so etwas wie Allensbach, bloß eben für Frankreich. Für Allensbach habe ich übrigens auch gearbeitet und für eine Schweizer internationale Jugendzeitung, die in vier Sprachen herauskam.
Dass das für den Osten alles todgefährliche Tätigkeiten waren, wußte ich natürlich nicht. Naiv, wie du bist hier im Westen, hast du keine Ahnung, was die da drüben für Gedanken in ihrem Hirn bewegen. Dieser Ausweis nämlich, dass ich für dieses französische Institut gearbeitet habe, das war es. Spionage!
Wie sie auf mich gestoßen sind? Das weiß ich nicht. Ich bin, wie es ein Journalist eben macht, zu damals wichtigen Stellen gegangen. Auch zu großen Druckerei-Betrieben. Und zu Zeitungen, vielen Zeitungen. Zu denen bin ich gegangen, habe gesagt – von Kollege zu Kollege – ‚Ihr habt doch Pressedienste. Laßt mich da mal gukken, was ihr da eigentlich habt.’ Da war sicher einer drunter, der mich dann geliefert hat. Und plötzlich war ich weg vom Fenster.“
Durch den offiziellen Zimmernachweis der Stadtverwaltung hatte sich Frau Bergmann in Leipzig Quartier besorgt. Eines Tages, als sie nach Hause kommt, fängt eine Hausbewohnerin sie auf der Treppe ab:
„‚Gehen Sie nicht rauf, die Polizei ist oben.’- ‚Na’, sage ich, ‚ich habe doch nichts zu verbergen!’ Da sagt sie: ‚Ich kann es Ihnen nur sagen. Wer bei uns abgeholt wird, der verschwindet, den sieht man nicht mehr.’ Da habe ich gesagt, ‚Ja, das soll mal mir passieren. Ich bin ja aus dem Westen. Und jeder Mensch weiß, wo ich hingefahren bin.’ Also hat sie gesagt: ‚Ja, tun Sie, was Sie wollen. Aber ich habe es Ihnen gesagt.’
Ich bin also hoch gegangen. Da waren zwei deutsche Polizisten. ‚Mit Ihren Papieren stimmt was nicht. Wir müssen Sie abholen’, haben sie gesagt. Also habe ich mein Zeugs genommen und bin losmarschiert. Bei der Polizei war das Zimmer voller Russen – und weg war ich.
Ein Schock war die ganze Sache für mich nicht. Denn ich habe gar nicht für möglich gehalten, was dann passierte. Ich habe mir gesagt, mir können sie doch überhaupt nichts tun! Mich kennt da drüben, im Westen, Hinz und Kunz. ‚Was denken Sie, was da passiert, wenn Sie mich jetzt hier verschwinden lassen!’ habe ich denen noch gesagt. Tja. Die haben sich einen Dreck drum gekümmert.
Im Westen rauschte tatsächlich der Blätterwald. Aber das war’s dann auch schon.
Wie sie drüben überhaupt erfahren haben, was mit mir war? Na, zuerst merkten sie, dass ich nicht wiederkam.
Und dann – ich war in einem deutschen Gefängnis. Zuerst in der Windscheidtstraße in Leipzig bei den Russen im Keller, in den ehemaligen Kohlenkellern der Villen dort. Muffig, kein Fenster -furchtbar! Und mit Kübel statt WC. Grausig war das da unten! Später haben sie mich dann in das normale Gefängnis getan.
Also, ich mußte zum Verhör. Der Wachtmeister holte mich ab, brachte mich in die Zelle zurück und ging dabei mit mir nicht die Jakobsleiter – die Treppe in der Mitte vom Zellenhaus – hoch, sondern das abgetrennte gemauerte Treppenhaus rauf. Und sagt zu mir: ‚Sie sind doch von drüben?’ Und fragt mich genau nach meinem Wohnort aus. ‚Ach’, sagt er dann, ‚jetzt geben Sie mir mal die Hand.’ Ich habe gedacht, mein Gott, was will der von mir. ‚Versprechen Sie mir in die Hand, dass Sie nicht Spionin sind’, sagt er da plötzlich. ‚Das kann ich Ihnen leicht versprechen. Ich bin das nicht. Ich bin Journalistin’, habe ich ihm gesagt, ‚und ich wollte hier ganz normal recherchieren. Und das legen die mir als Spionage aus.’ Da sagt er, ‚Ja, ich wollte das bloß wissen.’
Und dann hat er doch veranlaßt oder es selbst gemacht: Das Gefängnis in Leipzig hat doch tatsächlich die Lebensmittelmarken, die es damals noch gab, in meinem Wohnort angefordert. So haben die erfahren, wo ich bin. Und dann ging es los. Dann ging es los! Dann haben sie geschrieben, ich bin in Leipzig verhaftet, weg und so.
Damals lebte mein Vater noch, im August 1948. Aber er war schon schwer krank – nicht zuletzt durch die Torturen, die er bei den Nazis durchgemacht hatte. Als ich 1956 nach acht Haftjahren endlich zurückkam – es war auch im August –,da habe ich ihn noch wiedergesehen. Aber wenige Wochen später ist er dann gestorben. Als hätte er nur auf meine Rückkehr gewartet.“
Freiwillig, wie Maria Bergmann, war auch Lydia Gärtner in ihr Unglück gefahren – mit dem eigenen Lastzug dazu, ihrem einzigen, schwer erworbenen Besitz. Mit ihrer Freiheit verlor sie auch diese Habe. Nach langer Haft stand dann auch sie – wie die meisten ihrer Leidensgenossen und Leidensgenossinnen – vor dem Nichts.
Lydia war ein Mädchen ganz besonderer Art. Deshalb muß man ihre Geschichte auch von Anfang an erzählen.
Sehr früh schon hatte sie die Mutter verloren, und unter der Herrschaft der strengen Stiefmutter hing oft der Haussegen schief. So wartete Lydia schon als kleines Mädchen sehnsüchtig auf das Erwachsenwerden:
„Wenn ich doch nur erst groß wäre, habe ich immer gedacht. Wenn ich doch frei wäre. Frei! Eines Abends brachte mein Vater einen Fernfahrer mit nach Hause, dass der sich mal aufwärmen und eine Tasse Kaffee trinken sollte. Ich hörte durch die Tür, wie die Männer sich unterhielten. Ein schwerer Beruf, ja. Aber man ist frei, sagte der Mann. Da kriegte ich ganz große Ohren. ‚Man ist frei’. Ich hörte nur ‚frei!’ Also, wenn man frei sein will, muß man Fernfahrer werden, schloß ich. Wenn mir Verwandte sagten, frei könne man auch anders sein, glaubte ich ihnen nicht.
Im letzten Schuljahr mußten wir dann einen Aufsatz schreiben, was wir einmal werden wollten. Natürlich habe ich ‚Fernfahrer’ hingeschrieben. Die Lehrerin war konsterniert. Sie wußte gar nicht, was das war. Mein Vater mußte in die Schule kommen, und da erfuhr er von seinem Glück.“
Alle Versuche, der Tochter die Idee aus dem Kopfe zu bringen, blieben vergeblich. Mit sechzehn fuhr sie tatsächlich ihren ersten Lastzug – ohne Führerschein. Da gab der Vater nach und genehmigte ihr eine Lehre als Automechaniker. Für Mädchen war das damals mehr als ungewöhnlich. Aber Lydia erwies sich als technisches Naturtalent. Den Führerschein Klasse Drei konnten auch damals schon 18jährige machen. Doch die Fahrerlaubnis Klasse Zwei für Lastzüge war nur Männern vorbehalten. Nur bei Frauen und Töchtern von Fuhrunternehmern, Arbeitgebern der Branche, waren Ausnahmen möglich.
Lydia war mittlerweile zwanzig geworden. Da verlor sie die Geduld, weiter auf ein Wunder zu warten, und nahm die Sache selbst in die Hand. Sie reiste nach Berlin, suchte das Ministerium für Verkehr und verlangte kühn, den Verkehrsminister zu sprechen. Den bekam sie zwar nicht zu Gesicht. Doch ihre Energie machte soviel Eindruck, dass sie die verlangte Sondergenehmigung erhielt. Bald chauffierte sie wirklich große Lastzüge übers Land und fuhr und fuhr und fuhr, bis der Krieg zu Ende war.
Die von Bomben zerschlagenen und demontierten Werke hatten nun nichts mehr zu transportieren. Sie brauchten keine Fernfahrer mehr. Was also tun?
„Ja, selbständig habe ich mich da gemacht. Es standen ja nach dem Krieg so viele Fahrzeuge rum, von der Wehrmacht. Da hatte ich mir einen 120er Mercedes genommen. Und in Nikolassee stand irgendwo ein Feuerwehrauto, herrenlos. Diese beiden Fahrzeuge habe ich zusammengebaut und habe mir einen Lastwagen daraus gemacht. Mein alter Meister hat mir dabei geholfen, mein alter Chef hat mir Reifen zur Verfügung gestellt. Das mußte ich dann natürlich alles bezahlen. Ich habe es abgestottert, 7.500 Mark an das Bewirtschaftungsamt für Bergungsgut. So hieß die Stelle damals, die zuständig war.
Und dann bin ich gefahren. Die Russen hatten damals die Transporthoheit in und um Berlin. Und so hatte ich einen Propusk, einen Passierschein mit meinem Bild, mit der Unterschrift von General Schukow, dem Chef der Obersten Sowjetischen Militärverwaltung in Karlshorst. In Russisch stand da drauf: ‚Der Chauffeur Lydia Gärtner ist berechtigt, in der Sowjetischen Okkupationszone zu fahren und zu laden. Sämtliche Ladung ist bestimmt für die Sowjetische Militäradministration in Karlshorst.’ Das galt für jeweils ein Vierteljahr und wurde immer wieder erneuert.
Aber die Berliner mußten ja auch etwas zu essen haben. Es war ja noch vor der Blockade. Da kümmerten sich die Russen noch um Lebensmittel für Berlin. Wir brachten also alles nach Karlshorst, und die verteilten es dann irgendwie. Es war wenig genug. Die Aufträge an die Fahrer aus allen Sektoren Berlins gab jeden Morgen ein ‚Kapitan’, ein Hauptmann, namens Bernstein.“
So weit lief alles gut und schön. In Zehlendorf, im Sektor der Amerikaner, hatte Lydia bei zwei älteren Damen ein schönes Zimmer gefunden. Die Arbeit machte ihr Freude. Doch dann kam der 26. November 1947:
„Abends halb elf wurde ich angerufen. Ich kam gerade aus dem Kino. Es war das erste Mal, dass ich im Kino war nach dem Krieg. Es war ein russischer Film. ‚Der Mittelstürmer’ hieß er. Das werde ich nie vergessen! Es klingelt also das Telefon, ich soll sofort nach Frankfurt an der Oder kommen, Zucker laden. So etwas ist oft passiert, die Russen haben sehr gern nachts gearbeitet. Am Tage war Ruhe. Und nachts ging das Radio und war Licht überall. Gegessen haben sie morgens um neun, mittags um drei und abends um neun. Das weiß ich noch, weil ich auch später, nachher in Sachsenhausen, oft die Offiziere habe fahren müssen.
Also ich habe mir nichts dabei gedacht, bin natürlich losgefahren, ich Esel, und habe mich in Frankfurt gemeldet wie gewohnt. Da kommt ein Offizier auf mich zu und fragt, von welchem Amerikaner ich den Auftrag hätte, bei ihnen zu arbeiten. Da sage ich: ‚Na, von keinem! Das haben Sie doch angeordnet. Ich will überhaupt nicht hier arbeiten!’- ‚Ach, Sie wollen bei uns nicht arbeiten? Was haben Sie denn gegen uns?’- Ich sage: ‚Ich habe nichts gegen Sie, überhaupt gegen keinen Menschen’, sage ich. ‚Aber’, so er – und ja, also wenn ich nicht die Wahrheit sagen würde – ich hätte nämlich zwei Russen zur Flucht verholfen.
Wenn ich das wenigstens gemacht hätte! Dann wüßte ich, warum sie mich eingesperrt haben. Dann hätte ich mir gesagt, du hast halt Pech gehabt. Aber du hast vielleicht zwei Menschen glücklich gemacht. Nun war das so: Es handelte sich um zwei ehemalige russische Kriegsgefangene, die in deutsche Gefangenschaft gekommen waren. Die kannte ich aber gar nicht. Von der einrükkenden sowjetischen Truppe wurden die ganz schlecht behandelt. Ganz schlecht! Die haben denen gesagt, ihr habt es vorgezogen, euch in deutsche Gefangenschaft zu begeben, statt euch das Leben zu nehmen. Statt nun zu sagen: ‚Gott sei Dank, Jungens, wir haben euch wieder, ihr seid noch gesund, nun macht, dass ihr zu euren Familien kommt’ – wie es bei uns wäre. Aber nein. Jedenfalls habe ich gesagt: ‚Ich kenne überhaupt niemanden. Ich kenne niemanden außer dem Kapitan Bernstein.’ – ‚Der ist Jude!’ zischte da der Dolmetscher böse. Und da sage ich: ‚Ja, das weiß ich nicht’. Ich wußte es zwar, das sagt ja der Name schon. Ich sage, ‚ich weiß es nicht, und für mich sind alle Menschen gleich.’ Und ich würde wirklich keinen kennen – was ja auch zutraf. Wenn ich nicht die Wahrheit sagen würde, müßten sie mich eine Nacht einsperren, hieß es plötzlich. ‚Na,’ sage ich, ‚na, dann müssen Sie mich eben eine Nacht einsperren!’ Da habe ich aber dran geglaubt, dass es wirklich nur eine Nacht sein würde. Sagt der Offizier noch, ‚Morgen holen wir Sie wieder!’ Zur Arbeit, sollte das heißen. Von wegen! Ich habe meinen Lastzug nicht mehr wiedergesehen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.