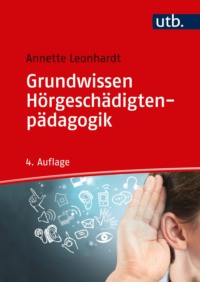Kitabı oku: «Grundwissen Hörgeschädigtenpädagogik», sayfa 6
■ Bereits Schumann (1929, 13) verwies auf erhebliche Abweichungen in den Durchschnittszahlen unterschiedlicher Länder. Beispielhaft sei auf folgende Angaben verwiesen:
– Niederlande (1869): 3,35 Taubstumme auf 10.000 Einwohner
– Luxemburg (1922): 5,98 Taubstumme auf 10.000 Einwohner
– Schweiz (1870): 24,50 Taubstumme auf 10.000 Einwohner
– USA (1890/1910): 6,5/4,48 Taubstumme auf 10.000 Einwohner.

Abb. 23: Schwerbehinderte mit Taubheit bzw. Schwerhörigkeit als schwerster Behinderung pro 100.000 der Bevölkerung 2001 (Streppel et al. 2006, 8)
Aus allen Statistiken wurde deutlich, dass Hörschädigungen keine seltenen Ausnahmeerscheinungen sind, schon rein quantitativ verdienen sie größere Beachtung.
Bei den Angaben des Statistischen Bundesamtes (Tab. 8 und 9) ist zu beachten, dass hier nur Menschen mit Hörschädigung erfasst sind, die nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannt sind. Demzufolge ist von einer weit größeren Anzahl Betroffener auszugehen.
Statistik: Kinder und JugendlicheWie bereits ausgeführt, enthält die Gesamtgruppe der Menschen mit Hörschädigung nur einen vergleichsweise geringen Teil im Kindes- und Jugendalter. Die grundsätzliche Problematik der sehr unterschiedlichen Zahlenangaben verschiedener Statistiken bleibt auch hier bestehen.
Eysholdt (2015) betont, dass es in Deutschland keine genauen Studien über die Prävalenz kindlicher Schwerhörigkeit (es werden hier offensichtlich alle kindlichen Hörschädigungen, also auch die Gehörlosigkeit, gemeint) gibt, abgesehen von epidemiologisch angreifbaren Untersuchungen von Patienten-Interessenverbänden. Schätzungen über die Anzahl von Kindern mit Hörschädigung in sonderpädagogischen Einrichtungen belaufen sich auf etwa 80.000 Kinder, über deren Hörverlust und Altersverteilung wenig bekannt ist.
Nach einer Analyse aktueller angloamerikanischer Studien beziffert Eysholdt (2015) die Inzidenz angeborener Hörschädigung mit 1:10.000. Hinzu kommen erworbene Formen kindlicher Hörschädigungen, die Hirnreifung und Spracherwerb stören (können). Das Risiko für kindliche Hörschäden von 50 dB Hörverlust (und darüber hinaus) kann pauschal mit 1:1.000 angesetzt werden. Gross et al. (1999) sprechen in diesem Zusammenhang von einer Häufigkeit kindlicher Hörstörungen zwischen 0,9 und 13 %. Um die Datenlage zu verbessern, begann man mit dem Aufbau eines „Deutschen Zentralregisters für kindliche Hörstörungen (DZH)“. Das Zentralregister entstand 1994 als ein drittmittelfinanziertes Projekt und hat 1996 damit begonnen, Kinder mit persistierenden (bleibenden) Hörschäden flächendeckend in der Bundesrepublik zu erfassen. Es befindet sich an der Klinik für Audiologie und Phoniatrie am Universitätsklinikum Benjamin Franklin (Berlin) und hat sich zur Aufgabe gestellt, mit Hilfe eines Patientenregisters eine möglichst realistische Darstellung der epidemiologischen, sozialdemographischen und medizinischen Situation von Kindern mit Hörschädigung zu geben. Nach 20 Jahren waren 14.239 Kinder und (mittlerweile) Erwachsene erfasst. Für die Geburtsjahrgänge 1985 – 1989 (Kohorte I, n=922) betrug das durchschnittliche Alter bei Diagnosestellung 6,2 ± 4,4 Jahre, für die Geburtsjahrgänge 2010 – 2014 (Kohorte II, n=1.123) 1,3 ± 1,3 Jahre und für die Geburtsjahrgänge 2015 – 2017 (Kohorte III, n=230) 0,4 ± 0,3 Jahre (Kugelstadt et al. 2017). Diese Entwicklung betraf am deutlichsten geringgradige Hörschäden, also jene mit weniger als 40 dB Hörverlust. Das Alter bei Diagnosestellung und die Zeit bis zur therapeutischen Versorgung konnten also deutlich reduziert werden.
Probst (2008b, 181) nennt für Hörschäden von relevantem Ausmaß eine Häufigkeit von ca. 1 von 1.000 Neugeborenen bei der Geburt. In den folgenden Lebensjahren steigt die Zahl der Kinder mit bleibenden Hörschäden um 50 – 90 %. Im Schulalter sind dann etwa zwei von 1.000 Kindern betroffen. Nicht eingerechnet sind hier vorübergehende Hörstörungen, die im Kleinkind- und Vorschulalter (insbesondere durch Mittelohrentzündungen) gehäuft vorkommen. Eysholdt (2015, 435) verweist aus medizinischer Sicht darauf, dass eine „Schwerhörigkeit im Kindes- und Jugendalter als relativ häufige Erkrankung angesehen werden“ muss.
Die Tabellen 10 – 12 stellen – trotz der gegenwärtig noch immer bestehenden Schwierigkeiten – den Versuch dar, dem Leser ein ungefähres Bild über die Häufigkeit des Vorkommens von Hörschäden im Kindes- und Jugendalter zu vermitteln. Ein völliger Verzicht auf derartige Zahlenangaben wird nicht möglich sein, da sie z. B. als Grundlage für sozialpädiatrische, schulpolitische oder organisatorische Maßnahmen genutzt werden müssen.
Tab. 10: Angaben zum Anteil hörgeschädigter Kinder und Jugendlicher in der BRD
| Literatur | betrachtete Population | Anteil der betrachteten Population | Bezugspopulation |
| Krüger (1982, 38) | kindliche Hörstörungen | 3 – 5 % | alle altersgleichen Kinder und Jugendlichen |
| Krüger (1991, 27) | mittel- bis hochgradig schwerhörige und gehörlose Kinder | 0,1 – 0,5 % | alle Gleichaltrigen |
Tab. 11: Angaben zum Anteil gehörloser Kinder und Jugendlicher (geordnet nach dem Erscheinungsjahr der zitierten Literatur; Anmerkung: Die Publikation von Bach 1995 [inzwischen in 15. Auflage], aus der Heese zitiert wurde, scheint seit Jahren nicht neu bearbeitet worden zu sein)
| Literatur | betrachtete Population | Anteil der betrachteten Population | Bezugspopulation |
| Sander (1973, 60) | gehörlose Schüler der Klasse 1 – 10 | 0,05 % | altersgleiche Schul-pflichtige |
| Pöhle (1990, 42) | gehörlose Kinder | 0,044 % | Gesamtheit der Schulpflichtigen |
| Krüger (1991, 27) | gehörlose Schüler | 0,04 % | alle Gleichaltrigen |
| Pöhle (1994, 23) | Gehörlose | 0,04 – 0,05 % | Geburtsjahrgang |
| Biesalski (1994, 53) | hochgradig hörgeschädigte Kinder, die Sprache spontan nicht erlernen können | 0,03 – 0,04 % | Kinder von 1 bis 12 Jahren |
| Heese (1995, 87) | gehörlose Kinder und Jugendliche | 0,05 % | Schulpflichtalter |
| Wisotzki (1998, 36) | gehörlose Kinder und Jugendliche | 0,04 % | schulpflichtige Bevölkerung |
Tab. 12: Angaben zum Anteil schwerhöriger Kinder und Jugendlicher (geordnet nach dem Erscheinungsjahr der zitierten Literatur; Anmerkung: Die Publikation von Bach 1995 [inzwischen in 15. Auflage], aus der Jussen zitiert wurde, scheint seit Jahren nicht neu bearbeitet worden zu sein)
| Literatur | betrachtete Population | Anteil der betrachteten Population | Bezugspopulation |
| Sander (1973, 66) | sonderschulbedürftige Schwerhörige der Klassen 1 – 10 | 0,25 – 0,30 % | altersgleiche Schulpflichtige |
| Jussen (1974, 211) | sonderschulbedürftige Schwerhörige im Grundschulalter | 0,25 % | altersgleiche Schulpflichtige |
| Pöhle (1990, 43) | schwerhörige und im Sprachbesitz ertaubte Kinder, die die Schwerhörigenschule besuchen | 0,11 % | Gesamtheit der Schulpflichtigen |
| Jussen (1995, 115f) | schwerhörige Kinder und Jugendliche | 4 – 6 % | alle Kinder und Jugendliche |
| sonderschulbedürftige schwerhörige Kinder und Jugendliche | 0,25 % | schwerhörige Kinder im schulpflichtigen Alter | |
| Biesalski (1994, 53) | mittelgradig schwerhörige Kinder | 0,5 – 1 % | Kinder von 1 – 12 Jahren |
| leichtgradig schwerhörige Kinder (zumeist schallleitungsbedingte Hörstörungen) | 3 – 4 % | Kinder von 1 – 12 Jahren |
Die Tabellen können ein ungefähres Bild der Anzahl der Kinder mit Hörschädigung vermitteln. Im Schuljahr 2015/16 besuchten ca. 45 % aller sich im Schulalter befindlichen Kinder und Jugendlichen mit Hörschädigung die allgemeine Schule (nach KMK 2016a, b) – für die die sonderpädagogische Begleitung sichergestellt werden muss. Nicht erfasst werden von genannten Statistiken all jene Kinder, die zwar hörgeschädigt sind, aber ohne sonderpädagogische Begleitung – zum Teil sogar unerkannt – allgemeine Einrichtungen besuchen. So verweist Claußen (1995, 19) auf eine erhebliche Dunkelziffer von Kindern, die nicht als schwerhörig bekannt werden.
Rechnet man den Personenkreis mit einseitigen und geringen beidseitigen Hörschäden hinzu und beachtet man, dass zum Vorkommen zentraler Hörstörungen kaum Zahlen vorliegen, muss die insgesamte Zahl von Kindern und Jugendlichen mit Hörschädigung tatsächlich als relativ hoch angesehen werden.
Statistik: Förderschulbesuch Abschließend sollen noch einige Informationen über den Anteil der eine Förderschule (früher Sonderschulen) bzw. ein Förderzentrum besuchenden gehörlosen und schwerhörigen Schüler (bezogen auf die Gesamtzahl der Schüler an Förderschulen im Pflichtschulalter) gegeben werden (Tab. 13). Nachdem der Anteil der Schüler an Förderschulen (insgesamt) bis 1975 stark angestiegen war, hat er sich seither kaum verändert; er liegt bei knapp über 4 % (Cortina et al. 2003, 766f). Seit dem Schuljahr 1999/2000 wird auch die Zahl der Schüler mit Förderbedarf an allgemeinen Schulen erfasst. Sie schwankt je nach Förderschwerpunkt und Bundesland erheblich. Danach liegt die Quote aller Schüler, die entweder an Förderzentren oder an allgemeinen Schulen sonderpädagogische Förderung erhalten, bei über 5 Prozent (Cortina et al. 2003, 768). Zu entnehmen ist der Tabelle auch, dass der Anteil der Schüler mit Hörschädigung (neben den Schülern mit Sehschädigung) im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler, die eine Förderschule besuchen, vergleichsweise gering ist. (Etwa die Hälfte der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind solche mit Förderbedarf Lernen. Sie besuchen Klassen bzw. Förderschulen für Lernbehinderte.)
Tab. 13: Schüler an Sonderschulen in Prozent aller Schüler im Alter der Vollzeitschulpflicht (Klassenstufen 1 – 10) in den Jahren 1975 – 2003 (Anmerkung: bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1995 Deutschland) (KMK 2005 a und frühere Jahre in Cortina et al. 2008, 522)
| Schulbesuchsquoten nach Förderschwerpunkten 1975 bis 20031 | |||||||
| Förderschwerpunkte | Schulbesuchsquoten2 | ||||||
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | |
| Lernen | 3,21 | 2,89 | 2,53 | 2,13 | 2,42 | 2,53 | 2,58 |
| Sonstige | 0,93 | 1,30 | 1,66 | 1,90 | 1,86 | 2,07 | 1,90 |
| Sehen | |||||||
| Blinde | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| Sehbehinderung | 0,03 | 0,04 | 0,03 | ||||
| Hören | |||||||
| Gehörlose | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| Schwerhörige | 0,08 | 0,09 | 0,08 | ||||
| Sprache | 0,10 | 0,17 | 0,28 | 0,36 | 0,34 | 0,38 | 0,40 |
| Körperliche und motorische Entwicklung | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,23 | 0,26 |
| Geistige Entwicklung | 0,40 | 0,55 | 0,64 | 0,59 | 0,62 | 0,71 | 0,79 |
| Emotionale und soziale Entwicklung | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,25 | 0,24 | 0,28 | 0,34 |
| Kranke | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,09a | 0,10 | 0,17 |
| Förderschwerpunkt übergreifend bzw. ohne Zuordnung | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,11 | |
| Zusammen | 4,14 | 4,19 | 4,20 | 4,03 | 4,28 | 4,60 | 4,84 |
1 Bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1995 Deutschland
2 Schüler an Förderschulen in Prozent aller Schüler im Alter der Vollzeitschulpflicht (Klassenstufen 1 bis 10)
a Ohne Sachsen
Interessant scheinen noch einige ergänzende Informationen, auf die in verschiedener Literatur verwiesen wird. Sie sollen mit angeführt werden, da sie die bereits getroffenen Aussagen ergänzen und differenzieren. Nachfolgende Ausführungen basieren vorzugsweise auf Krüger (1991), der sich wiederum auf verschiedene weitere Literatur stützt.
GeschlechterverteilungBei den Menschen mit Hörschädigung überwiegt das männliche gegenüber dem weiblichen Geschlecht etwa im Verhältnis 5:4 (neben Krüger auch Wisotzki 1998, 36). Wisotzki begründet das damit, dass Jungen insgesamt häufiger von den genannten Ursachen für Hörschädigungen (Kap. 3.3) betroffen werden als Mädchen.
Nach Krüger tritt der Unterschied verstärkt bei der schwerhörigen Schülerschaft auf; bei Gehörlosen ist dieser Überschuss männlicherseits recht gering.
Beide Aussagen finden sich in den Datensätzen des Deutschen Zentralregisters für kindliche Hörstörungen (DZH) bestätigt. Deren statistische Auswertung lässt erkennen, dass der prozentuale Anteil der Jungen höher ist als der von Mädchen: Von den gemeldeten Kindern und Jugendlichen mit beidseitiger Hörstörung sind 54,5 % männlich. Bei der Aufschlüsselung nach Geschlecht und Grad der Hörschädigung ist der Jungenüberhang bei leichten und mittleren Hörstörungen etwas deutlicher (Spormann- Lagodzinski et al. 2003).
Widersprüchliche Aussagen gibt es zur Geschlechterverteilung bei Personen mit Altersschwerhörigkeit: Krüger (1991, 28) spricht mit Bezug auf das o. g. Verhältnis von 5:4 von einer gewissen Umkehrung dieses Verhältnisses bei der Altersgruppe über 65 Jahren. Tesch-Römer/ Wahl (1996, 7) verweisen in ihrer Publikation auf die Framingham-Studie, die Personen mit Hörschädigung über 60 Jahre erfasste. Von den betroffenen Personen waren 32,5 % Männer und 26,7 % Frauen, so dass Männer eine höhere Prävalenzrate zeigen.
Pearson et al. (1995 nach Spormann-Lagodzinski et al. 2003) stellen fest, dass bei Männern der altersbedingte Hörverlust früher einsetzt und schneller fortschreitet als bei Frauen. Diese Aussage gilt auch dann noch, wenn Personen mit möglicher Lärmschwerhörigkeit ausgeschlossen werden.
Schumann (1929, 14) verweist mit Blick auf die Volkszählung von 1900 auf „54,1 % männliche Taubstumme bei sonstigem, nicht unbeträchtlichem Überwiegen des weiblichen Geschlechts“. Des Weiteren sind bei ihm folgende Zahlenverhältnisse zu finden:
1906 in Bayern 52,6 % männlich, 47,4 % weiblich
1910 in den USA 54 % männlich, 46 % weiblich
SchichtzugehörigkeitWie auch bei anderen Gruppen von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf lässt sich bei der Gruppe der gehörlosen, insbesondere aber bei den schwerhörigen Schülern in der Bundesrepublik Deutschland eine deutliche Überrepräsentation der niedrigen Sozialschichten der Elternhäuser feststellen (Krüger 1991, 28). Wisotzki (1998, 37) spricht davon, dass bei der Gruppe der Gehörlosen die untere soziale Schicht leicht überrepräsentiert ist.
Mit Bezug auf amerikanische Studien verweisen Streppel et al. (2006, 10) darauf, dass auch das soziale Umfeld während der frühkindlichen Entwicklung die Häufigkeit einer Hörschädigung beeinflusst. In sozial schwachen Gebieten wurden die höchsten Inzidenzen gefunden.
FamiliensituationIn Bezug auf die Familiensituation Gehörloser kann auf drei Prozentwerte verwiesen werden:
■ 90 % kommen aus Familien, in denen keine weiteren Familienmitglieder hörgeschädigt sind.
■ 90 % heiraten einen Partner mit Hörschädigung (Krüger 1991, 29) bzw. einen gehörlosen Partner (Wisotzki 1998, 37).
■ 90 % aller Kinder aus Ehen, in denen beide Partner gehörlos sind, sind hörend.
Einer Erhebung von Große (2003) zufolge benutzen von den Familien, in denen beide Eltern oder ein Elternteil gehörlos ist, 2,3 % die Deutsche Gebärdensprache als primäres Kommunikationsmittel.
 3.5 Übungsaufgaben zu Kapitel 3
3.5 Übungsaufgaben zu Kapitel 3
Aufgabe 9In welche drei Abschnitte wird das Ohr grob unterteilt?
Aufgabe 10Wie erfolgt die Schallaufnahme und -weiterleitung im Ohr?
Aufgabe 11Was versteht man unter „Physiologie des Hörens“?
Aufgabe 12Warum sind frühe Hörerfahrungen für die Ausreifung des auditorischen Cortex wichtig?
Aufgabe 13Welche Arten der Hörschädigung sind zu unterscheiden?
Aufgabe 14Für welche der Arten von Hörschädigung besteht vorrangig sonderpädagogischer Förderbedarf?
Aufgabe 15Wie stellt sich eine
a) Schallleitungsschwerhörigkeit
b) Schallempfindungsschwerhörigkeit
c) kombinierte Schallleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit im Audiogramm dar?
Aufgabe 16Wie wurde die Hörschwelle bei (normal-)hörenden Menschen festgelegt?
Aufgabe 17Wie kann man das Ausmaß des Hörverlustes einteilen?
Aufgabe 18Nennen Sie Ursachen von Hörschäden!
Aufgabe 19Was lässt sich über die Verbreitung von Hörschäden (Häufigkeit) aussagen?
4 Beschreibung des Personenkreises
Will man sich mit dem Personenkreis der Menschen mit Hörschädigung beschäftigen, wird man nicht umhin kommen, sich auf verschiedenen Betrachtungsebenen mit den Auswirkungen der Hörschädigung auseinander zu setzen. Neben medizinischen Aspekten (Kap. 3.2) sind im Wesentlichen sprachliche und psychosoziale Merkmale zu berücksichtigen. Die letzten beiden sollen nun nachfolgend näher beleuchtet werden, da erst durch eine gedankliche Zusammenfassung aller Gesichtspunkte die Grundlagen für ein pädagogisches und damit zugleich rehabilitatives Bemühen gegeben sind.
„Den“ Hörgeschädigten gibt es nicht Obwohl versucht wird, die einzelnen Gruppierungen von Menschen mit Hörschädigung näher zu beschreiben, muss angemerkt werden, dass die Er scheinungsbilder beim jeweiligen Betroffenen und ihre psychosoziale Situation infolge der Vielzahl der Faktoren, die am Zustandekommen der Hörschädigung beteiligt sind und aufgrund der sehr unterschiedlichen Intensität und Zeitdauer, mit denen diese wirken, ein sehr breites Spektrum aufweisen. Es ist de facto nicht möglich, von dem Gehörlosen, dem Schwerhörigen oder dem Ertaubten zu sprechen. Möglich sind dagegen, übergreifende Merkmale, die gehäuft zu beobachten sind, zu verdichten. Die Auswirkungen einer Höreinschränkung oder eines Hörverlustes sind individuell sehr verschieden und kaum vergleichbar, so dass eindeutige Zuordnungen (Kap. 2.1) zu hinterfragen sind. Ebenso erweist sich das persönliche Erleben der Höreinschränkung als sehr unterschiedlich.
Entsprechend differenziert muss die Entwicklungsproblematik der Menschen mit Hörschädigung gesehen werden. Unter pädagogischem Aspekt ist es trotz aufgeworfener Überlegungen sinnvoll, mehrere Gruppierungen nach der Spezifik des Förderbedarfs zusammenzufassen. Kriterien dieser Einteilung bzw. Zuordnung zu bestimmten Gruppen sind vorrangig die verbliebenen Hörkapazitäten, die Fähigkeit zur verbalen Kommunikation bzw. deren Entwicklungsstand und die Verwendung der Gebärdensprache als führendes Kommunikationsmittel.
Beim Versuch, die einzelnen Gruppen zu charakterisieren, ergibt sich die Notwendigkeit, stark zu verallgemeinern und mit vorrangigen Beobachtungen und sich häufenden Erscheinungen zu operieren. Für eine allgemeine Orientierung ist das zunächst ausreichend. Hörgeschädigtenspezifische Bildung, Erziehung und Förderung verlangen nach weiterem differenzierten Wissen über die individuelle psychosoziale Situation, insbesondere über die Fähigkeit, vorhandene Hörkapazitäten auszunutzen, den Stand der geistig-sprachlichen Entwicklung und über den Entwicklungsverlauf jedes Kindes mit Hörschädigung.
Vom Hörschaden zur HörbehinderungInwieweit psychosoziale Folgen auftreten, durch die sich aus dem Hörschaden eine Hörbehinderung entwickelt, hängt von mehreren determinierenden Faktoren ab:
Faktor 1Art und Ausmaß des Hörschadens: Es ist zu unterscheiden zwischen der Schallleitungsschwerhörigkeit (=Mittelohrschwerhörigkeit), der Schallempfindungsschwerhörigkeit (=sensorineurale Schwerhörigkeit oder Innenohrschwerhörigkeit), der kombinierten Schallleitungs- und Schallempfindungsschwerhörigkeit (kurz kombinierte Schwerhörigkeit) sowie der Gehörlosigkeit bzw. Taubheit (Kap. 3.2).
Hörgeschädigtenpädagogisch bedeutsam sind vor allem die Innenohrschwerhörigkeit, die kombinierte Schwerhörigkeit und die Gehörlosigkeit. Biologisch gesehen ist die Gehörlosigkeit eine (sehr) hochgradige sensorineurale Schwerhörigkeit oder kombinierte Schwerhörigkeit, bei der der Hörverlust im Hauptsprachbereich (zwischen 500 und 4.000 Hz) über 90 dB liegt.
Die Beeinträchtigung der auditiven Perzeption ist umso stärker, je höher der Grad, also das Ausmaß der Schwerhörigkeit ist. Die Verwertbarkeit der Hörreste (also der noch vorhandenen Hörkapazitäten) insbesondere für das Sprachverstehen hängt nicht allein von dem in Dezibel gemessenen Hörverlust ab, sondern vor allem davon, in welchem Frequenzbereich der auditive Analysator überhaupt noch auf akustische Reize anspricht (Neimann 1978). Hinzu kommen die sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen Betroffener, aus den vorhandenen Hörkapazitäten Nutzen ziehen zu können.
Faktor 2Zeitpunkt des Eintretens eines Hörschadens: Von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung der Persönlichkeit ist das Lebensalter, in dem ein Hörschaden eintritt. Je früher das geschieht, desto gravierender sind in der Regel die Auswirkungen auf die Entwicklung. Starke und hochgradige Hörschäden, die angeboren, unter der Geburt oder im frühen Kindesalter, noch vor oder während des (Laut-)Spracherwerbs eingetreten sind, belasten die Entwicklung des Kindes erheblich, zumal Kleinkinder noch nicht über die erforderlichen Regulationsmechanismen verfügen, um aktiv auf die Gestaltung der Wechselbeziehungen mit ihrer sozialen Umwelt Einfluss nehmen und der Hörbehinderung entgegenwirken zu können (Fallbeschreibung 1 bis 3, Kap. 1).
Eine gewisse Sonderstellung haben die gehörlosen Kinder gehörloser Eltern inne, da hier (zumindest im familiären Rahmen) eine ungehinderte Kommunikation (zumeist über die Gebärdensprache) von Anfang an ablaufen kann.
Beim Eintritt eines Hörschadens nach Abschluss des Spracherwerbs (ca. 3./4. Lebensjahr) oder zu einem noch späteren Zeitpunkt sind die lautsprachlichen Kompetenzen und die kognitiven Funktionen bereits deutlicher ausgeprägt. Die Problematik besteht vor allem darin, dass der Hörschaden die psychosoziale Situation der Betroffenen häufig kurzfristig (oft sogar schlagartig) verändert, ihre kommunikativen Möglichkeiten stark einschränkt und dadurch eine sehr umfängliche psychische Belastung bewirken kann. Hier hat sich seit den 1990er Jahren zunehmend das Cochlea Implantat (Kap. 7) als hilfreich erwiesen.
Faktor 3Das Vorhandensein einer oder mehrerer weiterer Behinderungen: Eine weitere bzw. mehrere zusätzliche Behinderungen können die Auswirkungen eines Hörschadens auf die gesamte Entwicklung erheblich verstärken. Die einzelnen Behinderungen wirken (sofern sie sich überhaupt klar voneinander abgrenzen lassen) nicht additiv oder nebeneinander, sondern haben in ihrer Auswirkung potenzierenden Charakter.
Mehrfachbehinderungen treten in uneinheitlichem Umfang, unterschiedlich schwer und in vielfach variierenden Kombinationen auf. Prinzipiell ist ein Hörschaden (unabhängig von Art und Ausmaß) in Verbindung mit jeder anderen Behinderung denkbar. Die zahlenmäßig größten Gruppen bilden aus schulischer Sicht die gehörlosen Schüler mit weiterem Förderbedarf im Lernen sowie die schwerhörigen Schüler mit weiterem Förderbedarf im Lernen. Die bekannteste und für den Außenstehenden beeindruckendste Gruppe der Mehrfachbehinderung ist die der Menschen mit Taubblindheit, wenn auch tatsächliche Taub-Blindheit sehr selten vorkommt. Sehr viel häufiger dagegen gibt es die Hör-Seh-Schädigung. Eine mit einem Hörschaden kombinierte Sehschwäche bereitet beispielsweise Schwierigkeiten beim Erlernen der Absehfertigkeit und setzt der visuellen Lautsprachperzeption objektive Grenzen; auch die Gebärdensprache kann nicht oder nur sehr eingeschränkt wahrgenommen werden. Cerebralparesen und andere Bewegungsbehinderungen können das Ausbilden der Sprechfertigkeiten, aber auch das Benützen manueller Zeichen (z. B. von Gebärden) erschweren oder auch unmöglich machen. (Weiterführende Informationen über Mehrfachbehinderte mit Hörschäden können der von Leonhardt 1998a herausgegebenen Publikation entnommen werden.)
Faktor 4Soziale Entwicklungsbedingungen: Die Auswirkungen eines Hörschadens werden wesentlich durch das soziale Umfeld mitbestimmt. Dazu gehören zunächst die engeren Bezugspersonen, also die Familie des Betroffenen, aber auch alle anderen Förderung, Betreuung und Unterstützung leistenden Personen und Institutionen (Kap. 12). Dies könnte beispielsweise für ein Kleinkind mit Hörschädigung die Pädagogisch-Audiologische Beratungsstelle und für den Erwachsenen, der schwerhörig geworden ist, der Absehkurs an der Volkshochschule oder beim Schwerhörigenverband sein. Die Qualität der von diesen Einrichtungen geleisteten Arbeit kann auf das Wohlbefinden und die Minimierung möglicher negativer Auswirkungen des Hörschadens erheblichen Einfluss ausüben.
Bei frühzeitigem Beginn hörgeschädigtenpädagogischer und therapeutischer Einflussnahme, bei ihrer kontinuierlichen Fortführung und bei angemessener Intensität und Qualität können Auffälligkeiten in der psychischen Entwicklung vermieden oder möglichst gering gehalten werden. Unzureichende soziale Förderung und Unterstützung kann dagegen bewirken, dass sich Auffälligkeiten in der Entwicklung und / oder im Verhalten wesentlich stärker ausprägen und sich ggf. negativ auf die Persönlichkeitsstruktur auswirken.
Auch die Qualität der Hörsysteme und anderer Kommunikationshilfen und der Nutzen, den der Einzelne aus ihnen ziehen kann, bestimmt die Wechselbeziehungen Individuum – Umwelt. Der tatsächliche Wirkungsgrad der technischen Hilfe hängt nicht allein von den technischen Parametern ab, entscheidend sind die subjektiven Voraussetzungen, unter denen das Hören mit Hörgeräten oder Cochlea Implantaten zielgerichtet aufgebaut und das Interesse an akustischen Erscheinungen geweckt (bei Kindern) oder erhalten (bei Spätbetroffenen) wird.
4.1 Schwerhörige
Schwerhörigkeit kann zu jedem Zeitpunkt des Lebens eintreten. Sie ist nicht wie die Gehörlosigkeit (Kap. 4.2) auf die prälinguale Entwicklungsetappe festgelegt. Dadurch sowie durch die verschiedenen Arten und das Ausmaß einer Schwerhörigkeit (Kap. 3.2) ist es äußerst schwierig, schwerhörige Menschen zu charakterisieren. Die relativ große Schwankungsbreite in der Perzeptionsleistung und in der sprachlichen Entwicklung erschwert ihre Beschreibung und veranlasst dazu, auf Erscheinungen hinzuweisen, die im Einzelfall auftreten können, aber nicht unbedingt auftreten müssen.
 Schwerhörig
Schwerhörig
Allen Schwerhörigen gemeinsam ist die Abweichung in der auditiven Perzeption. Unter pädagogischem Aspekt werden Menschen als schwerhörig bezeichnet, deren Schädigung des Hörorgans die Wahrnehmung akustischer Reize so beeinträchtigt, dass sie Lautsprache mit Hilfe von Hörsystemen aufnehmen und ihr eigenes Sprechen – wenn auch mitunter nur eingeschränkt – über die auditive Rückkopplung kontrollieren können. Für die Auswirkungen der Schwerhörigkeit auf den Entwicklungsverlauf Betroffener und für die fachpädagogische Beurteilung dieser sind die Zeitfaktoren und die spontan wirkenden sozialen Entwicklungsbedingungen von großer Bedeutung, so dass ihre psychosoziale Situation und ihre Erscheinungsbilder sehr differenziert zu sehen sind.
Auswirkungen bei SchallleitungsschwerhörigkeitMittelgradige Schallleitungsstörungen führen aufgrund der geringeren Intensität der Höreindrücke bzw. der schlechteren Diskriminationsmöglichkeit in Hörschwellennähe zu unvollständigem Hören. Insbesondere werden dabei unbetonte Teile der Rede (Endsilben, Partikel usw.) schlecht aufgefasst. Die Konstanz der Wahrnehmung akustischer Sprachzeichen bleibt jedoch erhalten, da keine Klangveränderungen eintreten. Der Betroffene hört leiser, der Höreindruck erfährt damit eine quantitative Beeinträchtigung. Durch Distanzverringerung bzw. elektroakustische Verstärkung ist ein weitgehender Ausgleich dieser Hörschädigung möglich.
Menschen mit erworbener Schallleitungsschwerhörigkeit, die über den vollen Sprachbesitz und die Fähigkeit zum Ergänzen und Kombinieren verfügen, sind folglich bei der Sprachwahrnehmung kaum beeinträchtigt. Anders verhält es sich bei Kindern, die von Geburt an eine Schallleitungsschwerhörigkeit haben, deren Sprache sich erst entwickeln muss. Ihre Spontansprache zeigt – insbesondere wenn diese nicht frühzeitig erkannt wird – häufig Auffälligkeiten. Da Endsilben, Endkonsonanten, Präpositionen, Konjunktionen, Flexionsendungen der Nomen, Verben und Adjektive, Artikel usw. weniger gut gehört werden, kann es zu entsprechenden Auffälligkeiten bei deren Sprachproduktion kommen. Eine schnellstmögliche HNO-ärztliche Behandlung und Hörgeräteversorgung ist angebracht, um derartige Erscheinungen zu verhindern.
Die Artikulation der Personen mit Schallleitungsschwerhörigkeit ist nicht sonderlich betroffen. Mitunter werden die Sprachakzente verändert, besonders die Melodie und Dynamik. Da die Schallleitungsschwerhörigkeit heute weitgehend durch otologische Behandlung operativ therapiert und – falls dies nicht möglich ist – durch Hörgeräte relativ gut ausgeglichen werden kann, hat sie – sofern sie nicht als Komponente einer Mehrfachbehinderung auftritt – weniger hörgeschädigtenpädagogische Relevanz. Dennoch gehören sie zum Aufgabengebiet eines Hörgeschädigtenpädagogen.
Auswirkungen bei SchallempfindungsschwerhörigkeitEine Schallempfindungsschwerhörigkeit bewirkt neben der quantitativen Beeinträchtigung vor allem eine qualitative Veränderung der auditiven Wahrnehmung. Es kommt zu einem „verzerrten“ Hören, das insbesondere das Verstehen von Sprache mehr oder minder stark erschwert, da die gehörten Laute stark deformiert sind. Es kann (bei Nichtverwenden von Hörgeräten) bis zum Nichtverstehen von Sprache führen.
Bei dieser Hörschädigung ist die Fähigkeit, hohe Töne zu hören, herabgesetzt, im Extremfall können sie nicht wahrgenommen werden. Betrifft die Hörschädigung charakteristische Formanten der Sprachlaute, so werden diese nicht mehr sicher unterschieden. Von den Konsonanten sind insbesondere die Zischlaute betroffen, ihr scharfes Geräusch wird gedämpft. Unter den Vokalen leiden das i und e; auch die Umlaute ö und ü sowie die Unterscheidung von u und ü sind betroffen.
Dadurch, dass einzelne Gebiete des Schallspektrums nicht oder nur gemindert empfunden werden können, kommt es zu Klangverzerrungen und Klangentstellungen, die die Differenzierbarkeit der Sprechlaute herabsetzen. Die Merkmalsbreite der gehörten Sprache wird ärmer. Der Betroffene verliert die Fähigkeit, einzelne Laute, also auch Wörter, akustisch zu unterscheiden. Infolgedessen kann er auch den Sinn der Wörter und Sätze nicht verstehen. Er hört relativ gut die tieferen Töne, so dass er die Sprechstimme vernehmen, aber die einzelnen Teile des Gesprochenen nicht unterscheiden kann. Die Betroffenen beschreiben ihr Hören häufig so: „Ich höre, aber ich verstehe nicht.“ Das Hören wird in geräuschvoller Umgebung weiter erschwert, da hier zusätzliche Ansprüche an die Differenzierungsfähigkeit gestellt sind.
Demzufolge haben Personen mit Schallempfindungsschwerhörigkeit Probleme in der Sprachauffassung. Da die Höreinbußen, wie beschrieben, in den höheren Frequenzen im Allgemeinen stärker werden (bis hin zum totalen Ausfall), kommt es zu qualitativen Veränderungen und Klangentstellungen der wahrgenommenen Sprache, weil sich nämlich die Laute gerade in den höherfrequenten Formanten charakteristisch voneinander unterscheiden. Vorhandene Hörreste im unteren Frequenzbereich (bei an Taubheit grenzenden Fällen) reichen dann nur noch aus, dass die Vokale irgendwie gehört, aber nicht mehr voneinander unterschieden werden können.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.