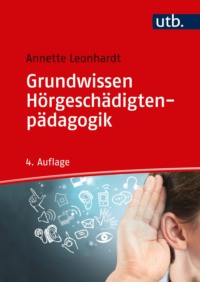Kitabı oku: «Grundwissen Hörgeschädigtenpädagogik», sayfa 4
 Hörgeschädigten pädagogik
Hörgeschädigten pädagogik
Gegenstand der Hörgeschädigtenpädagogik ist das Gewährleisten einer allumfassenden und uneingeschränkten Entwicklung Hörgeschädigter durch hörgeschädigtenspezifische Bildung, Erziehung, Förderung und (Re-)Habilitation.
Rehabilitation meint hier einen interdisziplinär angelegten Prozess, der die Auswirkungen der Hörschädigung auf das Leben der Betroffenen mindern will. Habilitation leitet sich vom Verb habilitare ab und bedeutet jemand befähigen, geschickt oder geeignet machen.
Die Hörgeschädigtenpädagogik will von ihrem Selbstverständnis her nicht nur beschreibend, sondern gegebenenfalls auch gestaltend tätig sein. Damit verfügt sie gleichermaßen über einen allgemeinen wie auch angewandten Wissenschaftszweig.
Forschung und Praxis der Hörgeschädigtenpädagogik akzentuierten in den vergangenen Jahren vor allem den hörgerichteten Spracherwerb und die bilinguale Erziehung, aktuell wenden sie sich eher Fragen der inklusiven Beschulung insbesondere unter den Aspekten der Beschulung lautsprachlich und gebärdenprachlich kommunizierender Schüler zu (Leonhardt 2018a).
Alle sonderpädagogischen Teildisziplinen sind auf interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen, insbesondere aber die Pädagogiken der Sinnesbehinderten (also die Hörgeschädigtenpädagogik und die Sehgeschädigtenpädagogik). Gleichsam werden sie von „außen“ (also von anderen Wissenschaftsdisziplinen oder von allgemeinen bildungspolitischen Bestrebungen) beeinflusst und zu neuen Denkansätzen veranlasst. Beispielhaft seien für die vergangenen Jahre Forschungsergebnisse aus der Linguistik über die Gebärdensprache und Entwicklungen im Rahmen der HNO-Heilkunde im Zusammenhang mit den Cochlea Implantationen genannt. Für die aktuellen Entwicklungen sind vorrangig die bildungspolitischen Bemühungen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hervorzuheben.

Weiterführende Literatur zur Theoriebildung der Sonderpädagogik: – Biewer (2017): Grundlagen der Heilpädagogik – Bleidick (1974): Pädagogik der Behinderten – Bleidick (1998): Einführung in die Behindertenpädagogik, Band I. – Bleidick (1999): Behinderung als pädagogische Aufgabe – Dederich et al. (2016): Handlexikon der Behindertenpädagogik – Haeberlin (2005): Grundlagen der Heilpädagogik. – Hedderich et al. (2016): Handbuch der Inklusion und Sonderpädagogik. – Kobi (2004): Grundfragen der Heilpädagogik. – Moser / Sasse (2008): Theorien der Behindertenpädagogik. – Speck (2008): System Heilpädagogik. – Für einen allgemeinen Überblick über die Sonderpädagogik bietet sich an: Klauer (1992): Grundriß der Sonderpädagogik.
2.4 Übungsaufgaben zu Kapitel 2
 Aufgabe 1
Aufgabe 1
Warum sind möglichst exakte Begriffsbestimmungen (z. B. von Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit) unumgänglich?
Aufgabe 2
Aus der Sicht der Medizin und aus der Sicht der Pädagogik wird der Begriff „hörgeschädigt“ unterschiedlich bestimmt. Worin besteht der wesentliche Unterschied?
Aufgabe 3
Wann entwickelten sich eigenständige Schwerhörigenschulen? Wonach sollte die Trennung in gehörlose und schwerhörige Schüler erfolgen?
Aufgabe 4
Worin zeigt sich die erweiterte Aufgabenstellung des Förderzentrums, Förderschwerpunkt Hören im Vergleich zur allgemeinen Schule?
Aufgabe 5
Welche Teilgebiete der Sonderpädagogik sind Ihnen außer der Hörgeschädigtenpädagogik bekannt?
Aufgabe 6
Was ist als Hauptziel der Hörgeschädigtenpädagogik anzusehen?
Aufgabe 7
Was ist der Gegenstand der Hörgeschädigtenpädagogik?
Aufgabe 8
Erarbeiten Sie sich anhand der Ausführungen in Kapitel 2 und durch Zuhilfenahme weiterer Fachliteratur (z. B. Lenzen [2004], Bleidick u. a. [1998], Wisotzki [1994] und Claußen [1995]) folgende Übersicht:
| Allgemeine Pädagogik | Sonderpädagogik | Hörgeschädigtenpädagogik | |
| Begriff (Was ist …?) | |||
| Aufgabe / Ziel (Wozu braucht man …?; Was beabsichtigt …?) | |||
| Gegenstand (Womit beschäftigt sich …?) |
3 Hörschäden im Kindes- und Jugendalter
Die Situation eines Kindes, das von Geburt an hörgeschädigt (gehörlos, hochgradig hörgeschädigt oder schwerhörig) ist, und eines Kindes, das sehr frühzeitig das Gehör verliert, unterscheidet sich grundlegend von den Verhältnissen, die für den im Erwachsenenalter ertaubten oder schwerhörig gewordenen Menschen gelten. In den Kapiteln 1 und 4 sind die Auswirkungen eines Hörschadens auf die emotional-volitive, geistige, körperliche, soziale und sprachliche Entwicklung dieser Kinder beschrieben. Die frühestmögliche Erkennung eines Hörschadens ist unter diesen Gesichtspunkten eine bedeutungsvolle Aufgabe. Deshalb hat der Gesetzgeber die Grundlagen dafür geschaffen, dass in der gesetzlichen Krankenversicherung ein umfangreiches und an den einzelnen Entwicklungsphasen des Kindes orientiertes Früherkennungsprogramm angeboten wird. Dieses für Säuglinge und Kleinkinder geschaffene Programm umfasst zehn ärztliche Untersuchungen in der Zeit von der Geburt bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres zu festgelegten Terminen. Das Früherkennungsprogramm enthält auch Maßnahmen zur Früherkennung von Hörschäden. Die Untersuchungen sollen nach den Vorgaben der „Kinder-Richtlinien“ von denjenigen Ärzten vorgenommen werden, „welche die vorgesehenen Leistungen auf Grund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen erbringen können, nach der ärztlichen Berufsordnung dazu berechtigt sind und über die erforderlichen Einrichtungen verfügen“ (Kinder-Richtlinie 2017, 6).
3.1 Anatomische und physiologische Vorbemerkungen
Anatomie des Ohres
Das, was gewöhnlich als Ohr bezeichnet wird, ist das statoakustische Sinnesorgan (gr. Statikos = auf das Gleichgewicht bezogen; gr. akoustikos = das Gehör betreffend). Wie der Name es bereits ausdrückt, sind hier zwei Sinnesorgane (Hörorgan, Gleichgewichtsorgan) auf engem Raum kombiniert. Sie haben verschiedene Funktionen.
Am Ohr werden drei Abschnitte unterschieden (Abb. 3): äußeres Ohr, Mittelohr und Innenohr.

Abb. 3: Aufbau des Ohres (aus: FORUM BESSER HÖREN: moderne HÖRSysteme, 14)
Das äußere Ohr (Auris externa)Zum äußeren Ohr werden Ohrmuschel und Gehörgang gezählt. Die Ohrmuschel besitzt mit Ausnahme des Ohrläppchens ein Gerüst aus elastischem Knorpel. Sie hat die Form eines Schalltrichters, der sich zum äußeren Gehörgang immer mehr verjüngt, d. h., der Anfangsteil des äußeren Gehörganges wird von einer rinnenförmigen Fortsetzung des Ohrmuschelknorpels gebildet, die durch das Bindegewebe zu einem geschlossenen Gang ergänzt wird (Abb. 4). Den Abschluss bildet das schräg in den Gehörgang eingelassene Trommelfell. Das Trommelfell ist eine häutige Membran mit einem Durchmesser von 9 – 11 mm. Es ist normalerweise so zart, dass die Gebilde des Mittelohres hindurchschimmern (Abb. 5).

Abb. 4: Längsschnitt des äußeren Gehörganges

Abb. 5: Ein rechtes Trommelfell
Das Mittelohr (Auris media) Hauptbestandteil des Mittelohrs (Abb. 6) ist die Paukenhöhle, ein spaltförmiger (schmaler hoher) Raum des Felsenbeins. Es wird lateral vom äußeren Ohr (Trommelfell) und medial vom Innenohr begrenzt. Die Paukenhöhle ist mit Schleimhaut ausgekleidet und beim gesunden Menschen mit Luft gefüllt.
Quer durch den oberen Teil der Paukenhöhle zieht vom Trommelfell zur Wand des Innenohrs die gelenkig miteinander verbundene Kette der Gehörknöchelchen: Hammer, Amboss und Steigbügel. Der Hammer ist durch seinen Handgriff mit dem Trommelfell verwachsen. Sein Köpfchen trägt eine Gelenkfläche, an die sich der Ambosskörper anlagert. Der Amboss sieht ähnlich aus wie ein Backenzahn mit zwei Wurzeln. Der längere dieser Ambossschenkel ist gelenkig mit dem Steigbügel verbunden. Die Fußplatte des Steigbügels ist bindegewebig im ovalen Fenster der Vorhofswand befestigt, so dass sie beweglich bleibt. Zwei Muskeln regulieren die Bewegungen der Gehörknöchelkette: der Hammermuskel, der das Trommelfell spannt, und der Steigbügelmuskel. Beide Muskeln sind Antagonisten: Der Hammermuskel zieht bei Auftreffen eines Schalls das Trommelfell nach innen und drückt das Fußstück des Steigbügels in das Vorhoffenster: Er bewirkt so eine erhöhte Empfindlichkeit der Überleitung. Der Steigbügelmuskel hebelt das Fußstück des Steigbügels aus dem Vorhoffenster heraus und verursacht dadurch eine Dämpfung der Überleitung. Beide Muskeln regulieren also den Spannungszustand des Schallleitungsapparates.

Abb. 6: Querschnitt durch das Mittelohr
Die Ohrtrompete ist eine 3 – 4 cm lange Röhre, auch Eustachische Röhre genannt. Sie geht von der Vorderwand der Paukenhöhle ab und mündet in den oberen Teil des Nasen-Rachen-Raumes. Bei jedem Schluckakt (oder auch beim Sprechen von k-Lauten und Gähnen) wird durch Muskelzug die Ohrtrompete erweitert (Abb. 7), so dass zwischen Mittelohr und Nasen-Rachen-Raum ein ständiger Luftaustausch erfolgen kann. (Somit erfolgt ein Luftdruckausgleich zwischen Mittelohr und Rachen.)

Abb. 7: Öffnung der Tube durch die Muskeln
a) geschlossene Tube
b) offene Tube
Das Innenohr (Auris interna)Das innere Ohr ist in die Felsenbeinpyramide eingelagert (Abb. 8). Es wird wegen seiner verwirrenden Vielfalt auch als Labyrinth bezeichnet. Es besteht aus zwei miteinander in Verbindung stehenden funktionellen Teilen, den Gleichgewichtsorganen (mit Vorhof und den drei Bogengängen) und dem Hörorgan in der Schnecke (Cochlea). Gleichgewichtsorgan und Hörorgan reagieren auf sehr feine Druckänderungen und stehen funktionell in enger Beziehung zueinander. Beide Sinnesorgane befinden sich im häutigen Labyrinth.
Das häutige Labyrinth ist ein System von Blasen und Kanälen, das allseitig von einer sehr harten Knochenkapsel (knöchernes Labyrinth) umgeben ist. Das häutige Labyrinth ist mit Endolymphe (visköse, d. h. klebrige Flüssigkeit) gefüllt. Das knöcherne Labyrinth enthält eine wasserklare Flüssigkeit, die Perilymphe, in der das häutige Labyrinth schwimmt.

Abb. 8: Das Innenohr

Abb. 9: Schema des häutigen Labyrinths: Die endolymphatischen Räume sind hellgrau, der Knochen dunkelgrau und die perilymphatischen Räume weiß
Alle Räume des häutigen Labyrinths stehen durch feine Kanälchen miteinander in Verbindung. Die Perilymphe und die Endolymphe im häutigen Labyrinth stehen nicht miteinander in Verbindung.
Das knöcherne Labyrinth Zentrales Mittelstück des knöchernen Labyrinths ist der Vorhof (Vestibulum). Nach vorn geht das Vestibulum in die knöcherne Schnecke (Cochlea) über und an seiner Rückwand münden die knöchernen Bogengänge. Die laterale Wand des Vorhofes entspricht der medialen Wand der Paukenhöhle und enthält zwei Öffnungen: das ovale Fenster und das runde Fenster.
Das häutige Labyrinth Das häutige Labyrinth besteht aus vier Teilen:
| ■ Sacculus | } | (gehören zum Gleichgewichtsorgan) |
| ■ Utriculus | ||
| ■ die 3 Bogengänge | ||
| ■ der häutige Schneckengang | (gehört zum Hörorgan) |
Utriculus und Sacculus sind zwei kleine Säckchen, die gemeinsam im knöchernen Vorhof liegen. Beide enthalten in einem umschriebenen Wandabschnitt Sinnesepithel. Auch in jedem Bogengang liegt jeweils eine quere Leiste mit Sinnesepithel. Durch Verschieben der Endolymphe werden bei Bewegungen und Lageänderungen des Körpers die Sinneszellen gereizt. Von den Sinneszellen im Vorhof wird die Erregung durch den Vorhofnerv des Gleichgewichts- und Hörnervs (Nervus vestibulocochlearis) zum Gehirn weitergeleitet.
Die häutige Schnecke enthält das Cortische Organ. Das Cortische Organ erstreckt sich in spiraligem Verlauf von der Basalwindung bis zur Kuppelwindung der Schnecke. Es ist das Sinnesepithel des Hörorgans und besteht ebenfalls aus Sinnes- und Stützzellen. Schallwellen, die auf das Trommelfell treffen, versetzen dies in Schwingungen. Diese werden durch die Kette der Gehörknöchelchen zum ovalen Fenster geleitet und durch die Steigbügelplatte auf die Endolymphe des Innenohrs übertragen, wodurch die Sinneszellen des Cortischen Organs gereizt werden. Der Schneckennerv des Gleichgewichts- und Hörnerven (Nervus vestibulocochlearis) leitet die Erregung zum Gehirn. Der Gleichgewichts- und Hörnerv hat also – ebenso wie das Ohr – eine doppelte Funktion.
Der Gleichgewichts- und Hörnerv (Nervus vestibulocochlearis) bildet gemeinsam mit 11 weiteren Hirnnerven das periphere Nervensystem des Kopfes. Das periphere Nervensystem hat die Aufgabe, die nervösen Erregungen weiterzuleiten.
Periphere Nerven enthalten im Allgemeinen sowohl afferente (sensorische) Nervenfasern, die dem Zentralnervensystem (ZNS) Informationen aus der Um- und Innenwelt zuleiten, als auch efferente (motorische) Nervenfasern, deren periphere Zielgebiete Drüsen und die Muskulatur sind.
Hörnerv und zentrale HörbahnenDie von den Sinneszellen des Cortischen Organs zum Ganglion spirale (Ganglien sind Ansammlungen von Nervenzellen, in denen die Nervenfasern ihren Ursprung haben) ziehenden Fasern geben dort die von ihnen geleiteten Reize auch an andere Nervenzellen weiter. Die Nervenfasern des 1. Neurons (Neuron = Gesamtheit der Zellfortsätze mit der dazugehörigen Ganglienzelle) verlaufen gemeinsam als Hörnerv in das Schädelinnere, wo sie in das Gehirn an dessen Unterseite eintreten. (Diesen Vorgang hat der Hörnerv mit den von den Gleichgewichtsorganen kommenden Nervenfasern gemeinsam.)
Nach Eintritt in den oberen Anteil des verlängerten Rückenmarks ziehen die Fasern des Hörnervs in ein aus mehreren Teilen bestehendes Ganglion, das als Nucleus cochlearis bezeichnet wird. Hier beginnt das zentrale Hörsystem.
Vom Nucleus cochlearis ziehen nun zentrale Hörbahnen über verschiedene Kerne (Nuclei) zum Zwischenhirn und von hier zur Hirnrinde, wobei der größere Teil der Bahnen auf die andere Hirnseite hinüber wechselt („kreuzt“). (Ein Prinzip, das bei allen wesentlichen Nervenbahnen zu beobachten ist.)
Eine Vorstellung von der Kompliziertheit der Führung der zentralen Hörbahnen im Gehirn vermittelt die vereinfachende Darstellung in Abb. 10. Die Abbildung zeigt, dass Impulse von einem Ohr zu beiden Hörrindenzentren geleitet werden.
Die Hörrinde liegt anatomisch in einer Querwindung des Schläfenlappens und wird Heschlsche Querwindung genannt. Die gürtelförmig an diese primäre Hörrinde angrenzenden Hirnareale werden als sekundäre Hörrinde bezeichnet.
In der Hörrinde (Abb. 12) findet die bewusste Verarbeitung der Höreindrücke statt.

Abb. 10: Schematische Darstellung der zentralen afferenten Hörbahnen

Abb. 11 (links): Seitenansicht des Gehirns mit Großhirn, Kleinhirn und Übergang zum Rückenmark

Abb. 12 (rechts): Die Hörrinde
Physiologie des Hörens
Unter Physiologie des Hörens versteht man die Lehre von den Hörfunktionen. Diese werden wahrgenommen durch das periphere Gehör- und Gleichgewichtssystem, das zentrale Hörsystem und das zentrale vestibulare System.
Äußeres Ohr Die Schallwellen erreichen das Hörorgan hauptsächlich über die Ohrmuschel, die als Schalltrichter dient (Abb. 3). Der Schall wird hier aufgefangen und gebündelt und gelangt durch den Gehörgang zum Trommelfell. Die auftreffenden Schallwellen versetzen das Trommelfell in Schwingungen.
Der Schall setzt auch den ganzen Schädel in Schwingungen, die direkt auf die Hörschnecke übertragen werden (man spricht von Knochenleitung). Sie spielt physiologisch kaum eine Rolle, doch wird sie zur Diagnose herangezogen und kann zur Hörgeräteversorgung genutzt werden.
Zwischen dem Auftreffen des Schalls am linken und rechten äußeren Ohr liegt (aufgrund ihres Abstandes zueinander) eine minimale Zeitdifferenz. Dadurch werden eine Raumorientierung und die Ortung der Schallquelle möglich.
Mittelohr Die Schwingungen werden über die Gehörknöchelkette weitergegeben (Abb. 6). Der Hammergriff, der mit dem Trommelfell fest verwachsen ist, gibt die Schwingungen an den dahinter liegenden Amboss weiter. Dieser wiederum überträgt die Schwingungen auf den Steigbügel. Der Steigbügel leitet die Schwingungen über die Steigbügelplatte als Druckbewegung an das ovale Fenster weiter. Es entsteht so eine Druckwelle, die die Perilymphe (Flüssigkeit im knöchernen Labyrinth) des Innenohrs in Schwingung bringt.
Die Aufgabe der Gehörknöchelkette ist die möglichst verlustarme Übertragung des Schalls von einem Medium mit niedrigem Wellenwiderstand (Luft) zu einem mit hohem Wellenwiderstand (Flüssigkeit; Abb. 13 und Abb. 14). Dieser Schallwellenwiderstand wird Impedanz genannt.
Die Binnenohrmuskeln (Trommelfellspannmuskel und Stapediusreflexmuskel) sind eine Schutzfunktion des Ohres gegen zu laute Höreindrücke. Sie sind in der Lage, die Schallübertragung der Gehörknöchelkette zu verändern. Teils wird die Übertragung leisen Schalles verbessert, teils die Übertragung lauten Schalles gebremst und die Nachschwingungen der Knöchelchen gedämpft. Wenn der eintreffende Schall zu laut und von langer Dauer ist, kontrahieren sich die Binnenohrmuskeln und versteifen die Gehörknöchelkette.

Abb. 13: Schallaufnahme und -weiterleitung

Abb. 14: Schallweiterleitung (Ausschnitt)
Innenohr Das ovale Fenster gerät durch die Druckbewegung, die durch die Schwingungen der Steigbügelplatte entstehen, ebenfalls in Schwingung. Dadurch entsteht eine Wanderwelle in der Schnecke. Tiefe Frequenzen erzeugen nahe der Schneckenspitze eine Auslenkung, hohe Frequenzen nahe der Basis der Cochlea (Richtung ovales Fenster).
Die Schnecke (Cochlea) ist hauptsächlich ein flüssigkeitsgefüllter Schlauch mit einer Membran (Basilarmembran genannt), die der Länge nach mitten durch sie hindurchläuft. Die Flüssigkeit innerhalb der Cochlea wird in wellenartige Bewegungen versetzt, wenn – wie eingangs erwähnt – die Fußplatte des Steigbügels gegen das ovale Fenster an der Basis der Schnecke vibriert. Diese Wellenbewegung der Flüssigkeit setzt sich der Länge des aufgerollten Schlauches nach fort, um das Ende herum und zurück zur Basis auf der anderen Seite, wo sie vom runden Fenster absorbiert wird (Abb. 14).
Durch ihre Bewegung versetzt die Flüssigkeit die Basilarmembran in wellenartige Bewegung. Diese Bewegung beugt die kleinen Sinneshaare, die sich an den Sinneszellen der Schnecke befinden. (Die Sinneszellen der Schnecke werden Corti-Organ oder Hörorgan genannt.) Die Sinneszellen verwandeln die mechanischen Schwingungen der Basilarmembran in neurale Aktivität, indem sie, wenn sie sich beugen, Nervenenden reizen.
Der physikalische Reiz ist nunmehr in einen Nervenreiz transformiert.
 Hörtheorien
Hörtheorien
Zur Erklärung der Umwandlung von Schallwellen in Empfindungen (Hörempfindungen) gibt es verschiedene Hörtheorien. Diese sind aber nicht in der Lage, gleichzeitig alle Einzelheiten des Hörvorgangs zu erklären. Jede erklärt einen Teil des Vorgangs. Die genaue Erforschung ist infolge der geringen Ausmaße des Hörorgans und der Winzigkeit der von ihm verarbeiteten Kräfte schwierig. Eine der bekanntesten Hörtheorien stammt von Georg von Békésy (1899 – 1972; 1961 Nobelpreis). Seine sogenannte Wanderwellentheorie löste die bis dahin gültige Vorstellung von Hermann von Helmholtz (1821 – 1894) (Resonanzhypothese) ab. Die Wanderwellentheorie von von Békésy gilt inzwischen auch nicht mehr als ausreichend und wird ergänzt durch eine Verstärkertheorie. Diese geht davon aus, dass erst durch den Einfluss der äußeren Haarzellen eine ausreichend hohe Trennschärfe der Frequenzen erreicht werden kann. Ferner ermöglichen die äußeren Haarzellen eine Verstärkung des ansonsten zu geringen Reizes für die inneren Haarzellen bei einem Schalldruck unter 50 (–80) dB (Götte 2010). Daher werden die äußeren Haarzellen als „cochleäre Verstärker“ bezeichnet.

(Weiterführende Informationen dazu sind Goldstein [2002, 371f], Lenarz / Boenninghaus [2012, 24f], Lindner [1992, 91f], Plath [1992, 37f], Probst [2008 a, 151], Schmidt / Lang [2007, 343f] und Gerrig [2016, 129f] zu entnehmen.)
Reizfortleitung und zentrale SchallverarbeitungSchallintensität, Dauer (Entfernung der Schallquelle), Schallfrequenz(en) und Schallrichtung werden vom Ohr aufgenommen und zur Weiterleitung im Hörnerv kodiert.
Im Verlauf der Hörbahn (Nervenverbindungen zwischen Cortischem Organ [=Hörorgan] in der Cochlea [=Schnecke] des Innenohres und dem Hörzentrum in der Hirnrinde (Abb. 10)) findet bereits eine komplizierte Verarbeitung der aufgenommenen akustischen Informationen statt. Während die Umformung im Mittelohr- und Innenohrbereich noch als analoge Informationswandlung angesehen werden kann, lässt sich die neuronale Weiterverarbeitung der Signale mit einer digitalen und sogar strukturbildenden vergleichen (Lindner 1992, 89).
Wichtige Umschaltstationen der HörbahnenDie Nervenimpulse verlassen die Cochlea in einem Faserbündel (= Hörnerv). Diese Fasern haben Schaltstellen (=Synapsen) im Nucleus cochlearis (Kap. 3.1) des Gehirnstammes. Von da aus laufen 60 % der eintreffenden Informationen zur gegenüberliegenden Gehirnhälfte, der Rest bleibt auf der ursprünglichen Seite. Auf ihrem Weg zum auditiven Cortex (Hörrindenzentrum) durchlaufen die auditiven Signale noch eine Reihe weiterer Kerne (Nuclei).
Bedeutung erste LebensjahreFür die Ausreifung des auditorischen Cortex spielen die ersten vier Lebensjahre die entscheidende Rolle. Ein adäquater akustischer Stimulus ist die Voraussetzung für einen Erwerb der Lautsprache. Im auditorischen Cortex entstehen die Schalllokalisation und die Schallbilderkennung. Die Schalllokalisation gelingt durch das zeitlich verzögerte Eintreffen des Schalls und dem Lautstärkeunterschied zwischen beiden Ohren. Die Schallbilderkennung – für das menschliche Gehör ist das wichtigste Schallbild die Lautsprache – ist eine kognitive Großhirnfunktion, die erlernt ist. (Zur Bedeutung der frühen Hörerfahrung siehe Kral 2012.)
Das akustische Hörrindenzentrum liegt im Bereich des Schläfenhirns in unmittelbarer Nachbarschaft zur Körpergefühlssphäre, zum Brocaschen Sprachzentrum und zum akustischen Sprachzentrum.
3.2 Arten und Ausmaß von Hörschäden
Funktionsstörungen im Bereich des Hörorgans, der Hörbahnen oder der Hörzentren bewirken eine Schwerhörigkeit oder eine Gehörlosigkeit. Das Wissen darüber allein reicht nicht aus, um eine entsprechende (z. B. medizinische oder pädagogische) Intervention einleiten zu können. Ebenfalls wichtig ist es, über Art und Ausmaß des Hörschadens Bescheid zu wissen. Dies ist aus medizinischer Sicht für die Art der Behandlung, aber auch zur Abschätzung des Grades der Behinderung (s. Tab. 1) notwendig. Für den Hörgeräteakustiker bietet die Kenntnis dieser Daten eine wesentliche Grundlage für die Anpassung von Hörgeräten. Dem Hörgeschädigtenpädagogen vermittelt es eine erste Orientierung, wobei aufgrund einer Diagnose, insbesondere bei jüngeren Kindern, nicht voreilig auf mögliche Entwicklungsverläufe geschlossen werden darf. Es sind folgende Arten der Hörschädigung zu unterscheiden:
Arten der Hörschädigung
a) Schallleitungsschwerhörigkeit
b) Schallempfindungsschwerhörigkeit (auch: Sensorineurale Schwerhörigkeit)
c) Kombinierte Schallleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit
d) Gehörlosigkeit
a ) bis d) zählen zu den peripheren Hörschäden. Des Weiteren gibt es zentrale Hörstörungen. Zu den bekanntesten und pädagogisch relevanten gehören
e) die Auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS).
a) Schallleitungsschwerhörigkeit (auch Mittelohrschwerhörigkeit oder konduktive Schwerhörigkeit) Schwerhörigkeiten dieser Art sind im schallzuleitenden Teil des Ohres lokalisiert, d. h., dass der Schall das Innenohr nicht ungehindert erreichen kann. Es liegt eine Funktionsstörung des Gehörgangs, des Trommelfells oder des Mittelohres vor, die meist als Folge von Mittelohrentzündungen oder von Infektionskrankheiten, die auf das Mittelohr übergegriffen haben, entstanden sind.
Abbildung 15 zeigt normale Knochenleitungswerte. Daraus kann geschlossen werden, dass das Innenohr und die zentrale Verarbeitung von Schallreizen normal funktionieren. Für die Luftleitung zeigt sich ein Hörverlust, der weitgehend linear verläuft. Die Lage von Knochenleitung und Luftleitung zueinander beschreibt man als Luftleitungs-Knochenleitungs-Differenz. Bei einer Schallleitungsstörung ist der Hörverlust in allen Frequenzen etwa gleich groß; ihre Folge ist leiseres Hören. Diese Art von Schwerhörigkeit ist mittels Hörgeräten gut auszugleichen. Eine lineare Intensitätsverstärkung bewirkt hier, dass das gesamte Sprachfeld in den Bereich des Hörens rückt. Schallleitungsschwerhörigkeiten kann man zudem medizinisch in fast allen Fällen soweit therapieren, dass auch ohne technische Hilfen (Hörgeräte) ein soziales Gehör vorhanden ist. Daher besuchten diese Kinder seit jeher einen allgemeinen Kindergarten oder eine allgemeine Schule. Eine hörgeschädigtenspezifische Begleitung ist dabei zu gewährleisten. Liegt allerdings eine weitere Behinderung vor, so ist mit nachteiligen Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung des Kindes weit eher zu rechnen, so dass dies bei der pädagogischen Begleitung und Förderung entsprechend Berücksichtigung finden muss.

Abb. 15: Schallleitungsschwerhörigkeit
b) Schallempfindungsschwerhörigkeit (auch Sensorineurale Schwerhörigkeit) Die Schallempfindungsschwerhörigkeit (auch Sensorineurale Schwerhörigkeit) beruht auf pathologischen Veränderungen des Cortischen Organs oder retrocochleär der nervalen Hörbahn. Deswegen sind zwei Formen zu unterscheiden: die sensorische (auch cochleäre) Schwerhörigkeit und die neurale (auch retrocochleäre) Schwerhörigkeit. Die beiden Schädigungsformen können auch gleichzeitig auftreten.
Das Tonaudiogramm (Abb. 16) weist für Luft- und Knochenleitung den gleichen Hörverlust aus, d. h., es besteht keine Luftleitungs-Knochenleitungs-Differenz.
Aus dem Kurvenverlauf kann man entnehmen, dass die Störung entweder im Innenohr oder von da aus zentralwärts liegt. Um den genauen Ort der Funktionsstörung zu finden, bedarf es einer Differenzialdiagnostik durch spezielle audiologische Tests.
Die Hörschwelle verläuft bei einer sensorineuralen Schwerhörigkeit nicht linear, die höheren Frequenzen sind stärker betroffen. Schallereignisse, insbesondere die Lautsprache, werden zumeist verzerrt wahrgenommen, weil Teilbereiche des Sprachfeldes (insbesondere die hochfrequenten Sprachanteile) unterhalb der subjektiven Hörschwelle liegen. Diese sind jedoch für das Verstehen von Sprache wichtig. Es liegt also eine Beeinträchtigung der auditiven Differenzierungsfähigkeit vor, wodurch z. B. Sprachlaute nicht adäquat aufgenommen werden können.

Abb. 16: Mittelgradige Innenohrschwerhörigkeit beidseits
Eine einfache lineare Verstärkung der Intensität, z. B. durch lautes Sprechen, bietet dem von dieser Art betroffenen schwerhörigen Menschen keine Hilfe. Hörgeräte können eine wirkungsvolle Hilfe sein. Voraussetzungen für einen wirklichen Hörgewinn sind jedoch eine gründliche audiologische Diagnostik durch den HNO-Arzt, eine sorgfältige Anpassung der Hörgeräte durch den Akustiker sowie eine Hörerziehung bzw. ein Hörtraining (Kap. 10.1), die bzw. das auf die individuelle audiologische Situation abgestimmt ist.
Die Ursachen der sensorineuralen Schwerhörigkeit sind vielfältig. Sie kann vererbt sein, kann pränatal eintreten (z. B. Erkrankung der Mutter während der Schwangerschaft an Röteln oder Toxoplasmose), perinatal (z. B. durch Asphyxie) oder postnatal (z. B. durch Meningitis, Encephalitis, toxische Stoffwechselstörungen, häufige und länger andauernde Lärmeinwirkung) (weiterführende Informationen Kap. 3.3).
Überschwellige Hörstörungen Im Zusammenhang mit der sensorineuralen Schwerhörigkeit ist noch auf zwei Formen überschwelliger (bedeutet über der Hörschwelle des Betroffenen liegende) Hörstörungen hinzuweisen, die die Wahrnehmung und die zentrale Verarbeitung hörbarer Schallerscheinungen zusätzlich erschweren: Bei der sensorischen (oder cochleären) Schwerhörigkeit findet man als typisches audiometrisches Merkmal das Recruitment. Bei der neuralen (oder retrocochleären) Schwerhörigkeit tritt die pathologische Verdeckung auf.
Recruitment Das Recruitment wird durch Innenohr-Haarzellenstörungen verursacht und bewirkt einen pathologischen Lautheitsausgleich. Leise Schallerscheinungen werden nicht gehört, wenn sie unterhalb der Hörschwelle liegen. Signale oberhalb der Hörschwelle werden gut erkannt und im Bereich um 80 dB werden sie ebenso laut empfunden wie von Normalhörenden. Da aber der Abstand zwischen (der herabgesetzten) Hörschwelle und der Schmerzschwelle verringert ist, wird die Unbehaglichkeitsschwelle eher erreicht. Das Recruitment ist oft nicht über die gesamte Frequenzbreite verteilt, sondern betrifft nur bestimmte Bereiche des Frequenzspektrums, die den geschädigten Haarzellenabschnitten der Basilarmembran entsprechen. Dadurch erhöht sich die Kompliziertheit der individuellen auditiven Wahrnehmung weiter. Meist ist das Recruitment mit starken Hörverlusten verbunden, so dass bei Kindern die Auswirkungen auf die Sprachentwicklung erheblich sein können. Bei enger Dynamik (das ist der Bereich zwischen Hörschwelle und Unbehaglichkeitsschwelle) kann die Hörgeräteanpassung schwierig sein, weil leicht Verzerrungen auftreten. Bei optimaler Verstärkung kann man jedoch ein gutes Sprachgehör erreichen.
Pathologische Verdeckung Die pathologische Verdeckung ist eine abnorme auditive Ermüdung, d. h., unter Geräuschbelastung verschlechtert sich die Hörschwelle des Betroffenen. Laute Schallerscheinungen werden als sehr leise empfunden oder verschwinden ganz. Der Betroffene hat erhebliche Schwierigkeiten, sprachlichen Nutzschall vom Störlärm bzw. Nebengeräuschen zu erkennen. Damit ist das Verstehen von Sprache weitgehend beeinträchtigt.