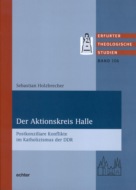Kitabı oku: «Der christliche Sonntag», sayfa 6
28 Vgl. u.a. Fuchs, Guido, Der Sonntag. Von kaiserlich verordneter Gottesverehrung im Wochenrhythmus zum pastoralliturgischen Sorgenkind angesichts gesellschaftlicher Nivellierung, in: Klöckener, Martin / Urban, Albert (Hg.), Liturgie in Wendezeiten. Zwischen konstantinischem Erbe und offener Zukunft, Trier 2009, 86-109; Fuchs, Guido, Wochenende und Gottesdienst. Zwischen kirchlicher Tradition und heutigem Zeiterleben, Regensburg 2008; Fuchs, Guido, Wochenende, Wochen-Ende. Wochenwende?, in: Gottesdienst 42. 2008, 164f.; Fuchs, Guido, „Komm, herrlicher Festtag!“ Eine liturgische Eröffnung des Sonntags, in: Gottesdienst 38. 2004, 84f.; Fuchs, Guido, Den Sonntag eröffnen. Lieder – Texte – Riten, Regensburg 2004.
29 Vgl. Bender, Annika, Die kulturelle Bedeutung der Sonntagsliturgie in pluralistischer Gesellschaft, in: ThG 52. 2009, 250-257; Fechtner, Kristian, Im Rhythmus des Kirchenjahres. Vom Sinn der Feste und Zeiten, Gütersloh 2007; Werner, Dietrich, Von der Heiligkeit der Unterbrechung. Schutz und Gestaltung des Sonntags als göttliches Gebot menschlicher Humanität, in: Green, Friedemann (Hg.), Um der Hoffnung willen. Praktische Theologie mit Leidenschaft. Festschrift für Wolfgang Grünberg (Kirche in der Stadt 10), Hamburg 2000, 369-379; Van Tongeren, Louis, The Squeeze on Sunday. Reflections on the Changing Experience and Form of Sundays, in: Post, Paul (Hg. u.a.), Christian Feast and Festival: The Dynamics of Western Liturgy and Culture (Liturgia condenda 12), Leuven 2001, 703-727. Zur ökumenischen Verantwortung vgl. Lehmann, Karl, Der Sonntag als gemeinsames Erbe und ökumenische Verpflichtung, in: Walter, Peter / Krämer, Klaus / Augustin, George (Hg.), Kirche in ökumenischer Perspektive (FS Walter Kasper), Freiburg / i.Br. [u.a.], 2003, 441-452.
30 Vgl. Grethlein, Christian, Gottesdienst nur am Sonntag? Evangelische Überlegungen zu einem zeitgemäßen Gottesdienstverständnis, in: JLH 43. 2004, 114-133.
31 Vgl. Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische Kirche der Union und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands, Berlin [u.a.] 2000. Seit Advent 1999 ist die Agende verbindlich.
32 Schwier, Helmut, Der evangelische Sonntagsgottesdienst. Verständnis und Praxis im Umfeld des „Evangelischen Gottesdienstbuches“, in: LJ 60. 2010, 116-131; hier: 122.
33 Vgl. Nagel, Eduard, Was ist uns wichtig? Entwurf für einen Brief an die Gemeinde aufgrund von Strukturreformen, in: Gottesdienst 23. 2011, 189-191; vgl. Fuchs, Ottmar, Sonntagsliturgie in Zeiten pastoraler Umstrukturierungen, in: BiLi 86. 2013, 183-192.
34 Vgl. Pohl-Patalong, Uta, Gemeindegottesdienst? Überlegungen zum Gottesdienst im kirchlichen Strukturwandel, in: Fechtner, Kristian / Friedrichs, Lutz (Hg.), Normalfall Sonntagsgottesdienst?, 110-118; Ratzmann, Wolfgang, Gottesdienst im ländlichen Raum. Suche nach Zukunftsmodellen, in: Fechtner, Kristian / Friedrichs, Lutz (Hg.), Normalfall Sonntagsgottesdienst?, 190-199; Fechtner, Christian, Der „gewöhnliche“ Sonntagsgottesdienst, in: DtPfrBl 110. 2010, 464-467; Arnold, Jochen / Tergau-Harms, Christine, Kleine Gemeinde, weiter Raum. Ekklesiologische und liturgische Perspektiven, in: Fechtner, Kristian / Friedrichs, Lutz (Hg.), Normalfall Sonntagsgottesdienst, 216-225; Lurz, F., Die Katholizität des Gottesdienstes; Emeis, D., Die Sonntagsgemeinde.
35 Vgl. Die Wortgottesfeier. Der Wortgottesdienst der Gemeinde am Sonntag. Vorsteherbuch für Laien. Hg. v. Liturgischen Institut Zürich im Auftrag der deutschschweizerischen Bischöfe, Freiburg/Schw. 1997; Die Wort-Gottes-Feier am Sonntag. Hg. v. Liturgischen Institut in Freiburg im Auftrag der Bischöfe der deutschsprachigen Schweiz, Freiburg/Schw. 2014; Wort-Gottes-Feier. Werkbuch für die Sonn- und Festtage. Hg. v. den Liturgischen Instituten Deutschlands und Österreichs im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, der Österreichischen Bischofskonferenz und des Erzbischofs von Luxemburg, Trier 2004.
36 Vgl. Kranemann, Benedikt (Hg.), Die Wort-Gottes-Feier. Eine Herausforderung für Theologie, Liturgie und Pastoral, Stuttgart 2006; Dürr, Marion, „Brannte uns nicht das Herz…?“, Struktur und Gestaltung der Wort-Gottes-Feier an Sonn- und Feiertagen am Beispiel der Rollenbücher für das deutsche Sprachgebiet (STPaLi 28), Regensburg 2011; Günther, Christa-Maria, Einander und den Herrn nicht aus den Augen verlieren. Würde und Bedeutung sonntäglicher Wort-Gottes-Feiern, in: Gottesdienst 44. 2010, 17; Wort-Gottes-Feiern am Sonntag. Erfahrungen und Anregungen. Zusammengestellt von einer Arbeitsgruppe der Liturgiebeauftragten der Bistümer Deutschlands. Hg. v. Deutschen Liturgischen Institut (Pastoralliturgische Hilfen 12), Trier 1998; Rau, Stefan, Sonntagsgottesdienst ohne Priester. Problematik und Hilfen für die Praxis (Laien leiten Liturgie), Kevelaer 1999. Auch in Frankreich dominieren die Fragen von Gottesdienstform und -zeit die liturgiewissenschaftliche Diskussion: Wernert, François, Eucharistiefeier, feiernde Gemeinde, Sonntagsfeier, in: LJ 57. 2007, 205-227; Clavier, Michèle, La messe dominical anticipée au samedi soir. Évolution historique et thélogicque de la question, in: MSR 64. 2007, 34-44.
37 Vgl. Gerhards, Albert, Deuten und Bedeuten. Zum Wechselspiel von Predigt und Sonntäglicher Eucharistiefeier, in: Roth, Ursula / Schöttler, Heinz-Günther / Ulrich, Gerhard (Hg.), Sonntäglich, 159-168; Meyer-Blanck, Michael, Sonntagskultur und Sonntagspredigt, in: Huizing, Klaas (Hg.), Kleine Transzendenzen, FS Hermann Timm, Münster 2003, 173-186.
38 Vgl. Groen, Basilius J., Die eine Sonntagseucharistie und die pluriforme Gemeinde, in: Pacik, Rudolf / Redtenbacher, Andreas (Hg.), Protokolle zur Liturgie (Veröffentlichungen der Liturgiewissenschaftlichen Gesellschaft Klosterneuburg 1), Würzburg 2007, 79-100.
39 Mit dem „Zweiten Programm“ sind alternative Gottesdienste neben der agendarischen Sonntagsliturgie gemeint. Vgl. Trebing, Ferdinand Christian, „Genau meine Musik“. Kreative Gottesdienste an jedem Sonntag, Altenstadt / Hessen 22010; Roth, U., Gottesdienst in der Stadt, 200-206; Schützler, Georg, Mut zur offenen Religiosität. Das Beispiel der Ludwigsburger Nachteulengottesdienste, in: Fechtner, Kristian / Friedrichs, Lutz (Hg.), Normalfall Sonntagsgottesdienst, 208-215; Mildenberger, Irene, „Kommt her zu mir, alle …“. Die Sonntagabendkirche in St. Jakob zu Nürnberg, in: Herausforderungen missionarischer Gottesdienst. Liturgie kommt zur Welt. Wolfgang Ratzmann zum 60. Geburtstag (Beiträge zu Liturgie und Spiritualität 19), Leipzig 2007, 35-56; Reich, Werner, Gemeinde bietet Gottesdienste für Ausgeschlafene an, in: Für den Gottesdienst 55. 2000, 28.
40 Vgl. z.B. Hirsch-Hüffel, Thomas, Zwischen Mysterium und Übung. Der Sonntagsgottesdienst als spirituelle Praxis, in: DtPfrBl 108. 2008, 464-468; Hirsch-Hüffel, Thomas, Der Sonntagsgottesdienst im Feld spiritueller Praxis, in: Fechtner, Kristian / Friedrichs, Lutz (Hg.), Normalfall Sonntagsgottesdienst, 119-127; Kalb, U. / Leineweber, M., Die Gemeinschaft Sant’ Egidio und der Sonntag; Agnew, Mary B., Sunday. Synthesis of Christian life, in: Liturgical ministry 12. 2003, 84-90; Weinert, Franz R., Das „Gesicht“ des Guten-Hirten-Sonntags. Liturgische und spirituelle Erschließung des vierten Sonntags der Osterzeit, in: HlD 53. 1999, 202-208.
41 Vgl. Festtag mit Format. Der Sonntag in den Medien – die Medien am Sonntag. Hg. v. Beirat der Konferenz der Deutschsprachigen Pastoraltheologen und Pastoraltheologinnen e.V., Passau 2004; Stollberg, Dietrich, Kitsch, Klischees und Konventionen. Fernsehgottesdienste – „ein wichtiger Beitrag zur Sonntagskultur“?, in: DtPfrBl 105. 2005, 286-289.; Gilles, Beate, Durch das Auge der Kamera. Eine liturgie-theologische Untersuchung zur Übertragung von Gottesdiensten im Fernsehen (Ästhetik – Theologie – Liturgie 16), Münster 2000.
42 Vgl. Hober, David, Totgesagte leben länger. Anmerkungen zu 50 Jahren „Wort zum Sonntag“, in: HerKorr 58. 2004, 240-244; Thull, Martin, Modernes Fossil. Das „Wort zum Sonntag“ hat sich verändert, in: HerKorr 53. 1999, 135-139; Reyntjes, Anton S., Lyrisches Stichwort Gott. Im Spannungsfeld von Literatur und Theologie. Das TV Wort zum Sonntag, in: ReHe 1999, 38f.; Deifel-Vogelmann, Bärbel, Das „Wort zum Sonntag“ als „Spurensuche“ oder: Was ist das Eigentliche?, in: LS 50. 1999, 35-37; Ayaß, Ruth, „Das Wort zum Sonntag“. Fallstudie einer kirchlichen Sendereihe, Stuttgart [u.a.] 1997.
43 Vgl. Fuchs, G., Wochenende und Gottesdienst; König, Marcus, „Wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen“. Sonntagsgottesdienst mit neuer Qualität: Einige Ergebnisse des Projektes „Gottesdienstqualität“ in Wien, in: HlD 59. 2005, 151-160; Pohl-Patalong, Uta, Gottesdienst erleben. Empirische Einsichten zum evangelischen Gottesdienst, Stuttgart 2001.
44 Vgl. Hennecke, Nicole, Sonntagsheiligung – Zwischen Anspruch und Wirklichkeit, in: Pastoralblatt 1. 2010, 3-10; Couzinet, Daniel/ Weiss, Andreas, Das Verhältnis von Art. 4 GG zu Art. 140 GG i.V. m Art. 139 WRV – Aktuelle Probleme und dogmatische Standortbestimmung, in: ZevKR 54. 2009, 34-61; Schiepek, Hubert, Der Sonntag und kirchlich gebotene Feiertage nach kirchlichem und weltlichem Recht. Eine rechtshistorische Untersuchung (Adnotationes in ius canonicum 27), Frankfurt/a.M. [u.a.] 22009; Unruh, Peter, Die Kirchen und der Sonntagsschutz. Zur Ladenöffnung an kirchlich besonders bedeutsamen Sonntagen, in: ZevKR 52. 2007, 1-29; Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Bremen vom 24. November 2004 (1 B 419/04) zur Ladenöffnung an Sonntagen in der Adventszeit, in: AkathKR 174. 2005, 218-221; zur Wort-Gottes-Feier: Kriegbaum, Christian, Die „Sonntägliche Wort-Gottes-Feier“ – aus der Not geboren, zum Segen geworden (Dissertationen Kanonistische Reihe 21), St. Ottilien 2006.
45 Vgl. Becker, Uwe, Kirchliche Zeitpolitik, in: ZEE 54. 2010, 89-104; Kowalski, Beate, Der Sonntag ist für den Menschen da. Neues Testament und Sonntagsschutz, in: TThZ 119. 2010, 76-78; Petrović, Dubravka, Der freie Sonntag für eine humane Gesellschaft, in: Renöckl, Helmut (Hg.), Umbrüche gestalten. Sozialethische Herausforderungen im neuen Europa. Beiträge des internationalen Symposiums 12.-14. April 2007 Opole / Polen, Wien [u.a.] 2008, 367-369; Becker, Uwe, Sabbat und Sonntag. Plädoyer für eine sabbattheologisch begründete Zeitpolitik, Neukirchen-Vluyn 2006; Pribyl, Herbert, Freizeit und Sonntagsruhe. Zur ethischen Relevanz der Freizeit unter besonderer Berücksichtigung der Sonntagsruhe, Wien [u.a.] 2005; Geist, C. / Janokowski, P. / Kunkel, R. (Hg.), Sonntage … Sonnentage des Lebens. Das Humane in Gefahr? Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Kirche beziehen Position, Münster 2003; Verhülsdonk, Andreas, Stört der Sonntag die Marktfreiheit?, in: StZ 221. 2003, 805-812; Harg, Joseph, Sonntags-Frust und Sonntags-Freude. Biblische und sozialethische Betrachtungen zur Sonntagsarbeit, in: CPB 115. 2002, 218-222; Ellbogen, Christa, Allianz für den freien Sonntag, in: Renöckel, Helmut (Hg.), Umbrüche gestalten. Sozialethische Herausforderungen im neuen Europa, Wien [u.a.] 2008, 363-366; Kranich, Sebastian, Der christliche Sonntag. Heilmittel gegen das Leiden an der Moderne?, in: ZEE 44. 2000, 133-145; Jünemann, Elisabeth, Zur Diskussion der Sonntagsruhe, in: Nothelle-Wildfeuer, Ursula (Hg.), Christliche Sozialethik im Dialog. Zur Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. FS zum 65. Geburtstag von Lothar Roos, Grafschaft 2000, 239-258; Werner, D., Von der Heiligkeit der Unterbrechung; Henkel, Jürgen, Sonntagsschutz. Religiöse Enttabuisierung der Konsumgesellschaft, in: ZdZ 2. 1999, 38f.; Riedenauer, Markus, Vom Sinn des freien Sonntags, in: Orientierung 63. 1999, 187f.; Weiler, Stephan, Die Problematik der Ladenöffnungszeiten und Sonntagsarbeiten. Als das Sommerloch-Thema „Sonntag“ die Republik verändern sollte, in: Ren. 56. 2000, 10-18; Kock, Manfred, Ist der Sonntag noch heilig?, in: WuA(M) 41 (2000), 119-122; Menschen brauchen den Sonntag. Gemeinsame Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1999, in: Klbl 79. 1999, 222-224; Hill, Werner, Sonntagsruhe als Gnade. Die Dienstleistungsgesellschaft frißt ihre Kinder, in: Die Zeichen der Zeit. Lutherische Monatshefte 2. 1999, 10-12; Heiliger Zorn. Die Kirche kämpft um den Sonntag, in: Evangelische Kommentare 32. 1999, 5; Quarch, Christoph, Ladensturm aus Langeweile. Der Streit um den Ladenschluß verrät eine Sinnkrise, in: Evangelische Kommentare 32. 1999, 5; Nuß, Berthold Simeon, Der Streit um den Sonntag. Der Kampf der Katholischen Kirche in Deutschland von 1869 bis 1992 für den Sonntag als kollektive Zeitstruktur. Anliegen – Hintergründe – Perspektiven, Idstein 1996.
46 Vgl. Beer, Peter, Kontextuelle Theologie. Überlegungen zu ihrer systematischen Grundlegung (BÖT 26), Paderborn [u.a.] 1995, 31; vgl. auch Collet, Giancarlo, Kontextuelle Theologie, in: LThK 6. 2006, 327-329; hier: 328f.
47 Collet, G., Kontextuelle Theologie, 329.
48 Vgl. Beer, P., Kontextuelle Theologie, 49.
49 Vgl. Beer, P., Kontextuelle Theologie, 10; 13; Feiter, Reinhard, Antwortendes Handeln. Praktische Theologie als kontextuelle Theologie (Theologie und Praxis 14), Münster [u.a.] 2002, 20.
50 Vgl. Beer, P., Kontextuelle Theologie, 65.
51 Vgl. ebd., 14; 17.
52 Vgl. ebd., 30.
53 Vgl. ebd., 113.
54 Vgl. ebd., 114.
55 Feiter, R., Antwortendes Handeln, 20.
56 Vgl. ebd., 20.
57 Vgl. Collet, G., Kontextuelle Theologie, 328.
58 Vgl. Pohl-Patalong, U., Gemeindegottesdienst, 114.
59 Vgl. Lurz, F., Die Katholizität des Gottesdienstes, 106.
60 Vgl. Heimbrock, Hans-Günter, Der Sonntagsgottesdienst vor dem Hintergrund der Eventkultur des Wochenendes, in: Roth, Ursula / Schöttler, Heinz-Günther / Ulrich, Gerhard (Hg.), Sonntäglich, 160-186, 175f.
61 Vgl. Beer, P., Kontextuelle Theologie, 13.
62 Vgl. Collet, G., Kontextuelle Theologie, 327f. [vgl. GS 1]; Beer, P., Kontextuelle Theologie, 65.
63 Vgl. Grethlein, Christian, Grundfragen der Liturgik. Ein Studienbuch zur zeitgemäßen Gottesdienstgestaltung, Gütersloh 2001, 17.
64 Vgl. Meyer-Blanck, M., Der Sonntagsgottesdienst, 73f.
65 Vgl. Jeggle-Merz, Birgit, Zur Einführung, in: Bärsch, Jürgen (Hg. u.a.), Zwischen Tradition und Postmoderne. Die Liturgiewissenschaft vor neuen Herausforderungen (ThBer 33), Freiburg/Schw. 2010, 15-25; hier: 20.
66 Im Jahr 2007 hat Papst Benedikt XVI. mit den Motu Proprio „Summorum Pontificium“ den vorkonziliaren Ritus der Messfeier und der anderen Sakramente wieder zugelassen. Um diesen Ritus gibt es theologische und pastorale Auseinandersetzungen. In den aktuellen Diskussionen über die Sonntagskultur spielt der sog. Alte Ritus weder kirchlich noch gesellschaftlich eine Rolle. Deshalb wird er auch in dieser Arbeit nicht thematisiert. Vgl. Gerhards, Albert, Ein Ritus - zwei Formen. Die Richtlinie Papst Benedikt XVI. zur Liturgie (Theologie kontrovers), Freiburg / i. Br. [u.a.] 2008.
67 Vgl. Kranemann, Benedikt, Christliche Festkultur und kulturelle Identität Europas – Kontinuität und Diskontinuität, in: Malik, Jamal / Manemann, Jürgen (Hg.), Religionsproduktivität in Europa. Markierungen im religiösen Feld (Vorlesungen des Interdisziplinären Forums Religion der Universität Erfurt 6), Münster 2009, 51-65; hier: 52f.
68 Vgl. Davie, Grace, Religion in Britain since 1945. Believing without belonging, Oxford [u.a.] 1994, 189f.
69 Vgl. Stambolis, Barbara, Im Zeichen des Glaubens. Tradition und Wandel kirchlicher Feste, Kevelaer [u.a.] 2007, 7; vgl. Kranemann, Benedikt / Bender, Annika, Mehr als kulturelles Erbe. Die christlichen Feste im heutigen Europa, in: HerKorr 63. 2009, 95-99.
A GRUNDLEGENDE VORÜBERLEGUNGEN
2. Zeitdiagnostische Aspekte
2.1 Beschreibungen religiöser Orientierung im Europa der Gegenwart
Die sozialwissenschaftliche Debatte über die Rolle von Religion in Europa wird seit einigen Jahren von der Diskussion über das sog. Säkularisierungsparadigma dominiert. Im Zentrum dieses Paradigmas steht die These, die Moderne hätte zur Abnahme der Bedeutung von Religion geführt. Je höher der Grad der Modernisierung einer Gesellschaft sei, desto geringer werde der Einfluss von Religion und Kirche70. Das würde sich auch auf die Sonntagsliturgie als Ausdruck kirchlichen Lebens auswirken. Die unterschiedlichen Präzisierungen der Säkularisierungsthese ermöglichen eine bessere Einordnung der Traditionsum- und -abbrüche kirchlicher Kultur in der Gegenwart. Sie stellen den Boden dar, auf dem Versuche, die theologische und gesellschaftliche Relevanz des sonntäglichen Gottesdienstes zu vermitteln, gedeihen können. Die Diskussion um das Säkularisierungsparadigma bzw. die -these umfasst in den Sozialwissenschaften eine Fülle an Literatur, hier können nur einige Stränge nachgezeichnet und die ambivalenten Einschätzungen aufgezeigt werden. Vier Ansätze, die den sozialwissenschaftlichen Diskurs maßgeblich prägen, sollen skizziert werden. Zunächst kommen die Überlegungen von José Casanova und Charles Taylor zur Sprache, die der Bedeutung von Religion in Säkularisierungsprozessen in Europa einen veränderten, aber hohen Stellenwert zuweisen. Im Gegensatz dazu argumentiert der deutsche Religionssoziologe Detlef Pollack, der von einer abnehmenden Bedeutung von Religion ausgeht. In einem zweiten Schritt sollen detaillierter als zuvor möglich die Beschreibungsmuster der britischen Religionssoziologin Grace Davie dargestellt werden. Davie deutet die Säkularisierung ebenfalls nicht als Niedergang von Religion. Ihre Modelle, mit denen sie versucht, religiöse Praxis im Europa der Gegenwart in ihrer Differenziertheit abzubilden, sind für liturgiewissenschaftliche Fragestellungen interessant.
Der Befund, der sich aus der Lektüre verschiedener Studien ergibt, ist für die liturgiewissenschaftliche Auseinandersetzung von Interesse, weil er das Vorverständnis des Gottesdienstes in der pluralen Gesellschaft prägt. Hier wie da ergeben sich wichtige Anhaltspunkte für den Sonntagsdiskurs und Anstöße für die liturgiewissenschaftliche Methode. Es geht also nicht in erster Linie um eine Klärung der Frage der Säkularisierung, sondern um die Kennzeichnung der Gesellschaft, wie sie von den jeweiligen Vertretern in den argumentativen Diskurs eingebracht wird. Der Blick auf religiöse Praktiken der Gegenwart weitet sich, die Liturgiewissenschaft kann auf diese Modelle hin ihre theologisch formulierten Theorien diskutieren und nach Kriterien für die Liturgiepastoral fragen.
2.1.1 Das Säkularisierungsparadigma in der sozialwissenschaftlichen Diskussion
Das religiöse Feld in Europa gestaltet sich heute plural. Es existieren verschiedene Ausprägungen des Christentums, auch die Formen außerkirchlicher Religiosität haben sich vervielfältigt. Diese Vielfalt wirkt sich nicht nur auf das Tun der religiösen Gemeinschaften, sondern auch auf das alltägliche Leben und die zwischenmenschliche Kommunikation aus. Mit ihr ist eine Vervielfältigung religiöser und kultureller Interessen und Ansprüche verbunden, die auch Konflikte in sich birgt71.
In der Literatur werden zwei Modelle des Säkularisierungsparadigmas einander gegenübergestellt, die mehr Gemeinsamkeiten in der Diagnose religiöser Entwicklungen aufweisen, als oft eingeräumt wird. Auf der einen Seite stehen die Befürworter des Säkularisierungsparadigmas, auf der anderen die Vertreter der Individualisierungstheorie. Beiden Theorien gemein ist in ihren unterschiedlichen Facetten die Feststellung enormer Veränderungen, die auf Religion und Kirchen einwirken. Es gibt verschiedene Indikatoren, die zur Einschätzung der Rolle institutionell verfasster Religion in Europa herangezogen werden können. Ein wichtiger Aspekt ist die Teilnahme an Gottesdiensten. Ein Blick auf die Statistiken zum Gottesdienstbesuch in den europäischen Gesellschaften seit den 1950er Jahren lässt zunächst eine abnehmende Bedeutung von Religion für Individuum und Gesellschaft vermuten. Der kontinuierliche Rückgang der Teilnehmerzahlen wird oft als Bestätigung der Säkularisierungstheorie interpretiert72. Die sinkende Teilnahme an Gottesdiensten wird dabei mit einem zurückgehenden gesellschaftspolitischen Einfluss der evangelischen und katholischen Kirche in Europa in Verbindung gebracht73.
Delef Pollack: Säkularisierung als Verlust der sozialen und individuellen Relevanz von Religion
Der Religionssoziologe Detlef Pollack gehört zu den Befürwortern des Säkularisierungsparadigmas. Während andere Sozialwissenschaftler Verschiebungen in der religiösen Praxis hin zum Individuum beobachten, geht Pollack von einer Abnahme von Religiosität in Gänze aus. Er verwahrt sich gegen die Interpretation, Säkularisierung wirke sich nur auf der Makroebene negativ auf Religion aus, so dass etwa die gesellschaftliche Autorität einzelner Religionsgemeinschaften zurückginge74. Als Vertreter der Säkularisierungsthese fühlt sich Pollack falsch verstanden:
„[…] die Kernthese der Säkularisierungstheoretiker besagt, dass Prozesse der Modernisierung einen letztlich negativen Einfluss auf die Stabilität und Vitalität von Religionsgemeinschaften, religiösen Praktiken und Übersetzungen ausüben. Die These lautet nicht, dass sich diese Entwicklung unausweichlich vollzieht und auch nicht, dass sie unumkehrbar ist […].“75
Fest steht für Pollack, dass Religion im pluralisierten Kontext ihren alltäglichen Bezug nur schwer bewahren kann. In kulturell geschlossenen Gesellschaften ist der Grad an Selbstverständlichkeit, mit der sie in das alltägliche Leben integriert wird, höher76. Für Pollack ist der Verlust der starken religiösen Autorität nicht gleichzeitig mit einer Verstärkung des individuellen Glaubens verbunden:
„Zu behaupten, Säkularisierung betreffe nur den Rückgang religiöser Autorität und habe mit dem religiösen Bewusstsein des Individuums nichts zu tun, ähnelt einer Immunisierungsstrategie, die die Bedeutung religiöser Gefühle und Vorstellungen herunterspielt, um die Säkularisierungsthese mit dem hohen Niveau religiösen Glaubens, den wir in angeblich säkularen Gesellschaften antreffen, vereinbaren zu können.“77
Pollack und die Vertreter der Individualisierungstheorie diagnostizieren das Gleiche: einen Wandel von Religiosität und konfessioneller Zugehörigkeit in den einst von den großen Kirchen geprägten Gesellschaften Europas. Dieser fällt zugunsten nicht institutionell angebundener spiritueller Ausprägungen von Religiosität aus. In der Deutung dieser Phänomene unterscheidet sich Pollack jedoch fundamental von den Individualisierungstheoretikern: „Dieser Wandel, der sich in einem Bedeutungsrückgang traditionaler institutionsgebundener Religiosität ausdrückt, ist aber selbst Bestandteil des Minorisierungsprozesses von Religion und Kirche.“78 Pollack sieht die Säkularisierung damit als bestätigt an. Aus seiner Sicht kennzeichnet die Individualisierung den religiösen Bedeutungsrückgang:
„So richtig es ist, dass ein Formenwandel des Religiösen stattfindet, so wichtig ist es doch auch zu betonen, dass dieser Formenwandel mit einem Bedeutungsrückgang des Religiösen einhergeht. Die Zustimmung zu Formen außerkirchlicher Religiosität bleibt gering, und die zunehmende Hinwendung zu ihnen kann die Verluste der traditionalen Religiosität nicht kompensieren. Außerdem stehen die nichtkirchlichen Formen der Religiosität nicht in einem Alternativverhältnis zu den traditionalen und können auch deshalb von dem Bedeutungsrückgang letzterer nicht profitieren.“79
Die Konsequenz, die er daraus zieht, steht in einem fundamentalen Widerspruch zur gesellschaftlichen Bedeutung von Religion, wie sie von den im Folgenden vorzustellenden Ansätzen wahrgenommen wird. Für den einzelnen hätte Religion weniger Bedeutung, die Veränderung des Formenwandels religiöser Praktiken sei mit der „Abnahme der sozialen Relevanz“80 von Religion verbunden. Pollack verweist auf die Ergebnisse seiner empirischen Erhebungen, die u.a. für den Gottesglauben eine abnehmende Tendenz zeigen. Er misst die religiöse Praxis am Rückgang der Häufigkeit des Kirchgangs und des Gottesglaubens in West- und Osteuropa81. Trotzdem gesteht Pollack ein: „[…] religiöse Traditionen hinterlassen einen prägenden Eindruck in ihren jeweiligen Gesellschaften, der selbst dann erhalten bleibt, wenn Säkularisierungsprozesse einsetzen.“82
Charles Taylor: Vervielfältigung der religiösen Optionen
Eine andere Perspektive nimmt der kanadische Philosoph und Politikwissenschaftler Charles Taylor ein. Ein wesentliches Kennzeichen der Säkularisierung ist Taylor zufolge die Entkoppelung sozialer Lebensbereiche von religiösen Einflüssen. Das schließt den Glauben an einen Gott und religiöse Praxis aber nicht aus. Nimmt man für die Einschätzung des Grades an Säkularisierung allein die Teilnehmerzahlen des Gottesdienstes als Indikator, dann kann man den Großteil der Länder Westeuropas als säkular bezeichnen. Für Taylor vollziehen sich die entscheidenden Veränderungen aber auf einer anderen Ebene. Die große Neuerung besteht in der Zunahme der religiösen Optionen. Das trifft auch auf religiöse Menschen zu. Während es früher undenkbar gewesen ist, nicht an einen Gott zu glauben, stellt sich der Glaube heute auch für die sich bekennenden Menschen als eine unter vielen Optionen dar. Diese Glaubensmöglichkeiten sind oft nicht mehr klar voneinander zu trennen, Entscheidungen dafür oder dagegen müssen jeweils neu getroffen werden.83 Taylor meldet dennoch Zweifel an der Interpretation eines starken Rückgangs religiöser Praxis an, er rät stattdessen zu einem relationalen Blick, der von einer romantischen Vorstellung eines „‚Zeitalter des Glaubens‘“84 abrückt, in der jeder religiös praktizierend gewesen sei. Taylor weist darauf hin, dass es sich jeweils um Deutungen handelt, die von einem entsprechenden Vorverständnis von Religiosität abhängig sind:
„Selbst in Zeiten des Glaubens war nicht jeder wirklich fromm. Wie verhielt es sich etwa mit jenen zögerlichen Gemeindemitgliedern, die nur selten in die Kirche gingen? Waren sie wirklich so verschieden von jenen, die sich heute für nichtreligiös erklären? Ich für meinen Teil bin überzeugt, daß die Säkularisierungsthese den meisten dieser Einwände standhalten kann. […] Vielmehr gibt es uns die Möglichkeit, die eigene Darstellung des eigentlichen Geschehens präziser zu erfassen.“85
Taylor beschreibt die Veränderungen in der religiösen Orientierung in Europa als Veränderung von einer ‚heißen‘ zu einer ‚kalten‘ Form. Der ehemals religiöse Bezug existiert in der Gegenwart z.B. in der Form der Erinnerung weiter, das Christentum verliert dabei seine herausgehobene Rolle als moralische Autorität. Die kalte Form ermöglicht einen offeneren Umgang mit religiösen Bezügen. Das berührt die geschichtliche Identität der Gesellschaft. Religiöse Dimensionen werden dabei nicht eliminiert, treten aber in den Hintergrund86. Die Zwischenstufen haben sich vermehrt sowie die Glaubensvorstellungen, die außerhalb dessen angesiedelt sind, was man als dogmatisch formuliert bezeichnen würde87. Religiöse Orientierung hat unter Umständen dann nicht mehr einen solch hohen Wert an Stabilität. Taylor hält fest: „[…], es fällt immer schwerer, eine Nische zu finden, in der Glaube oder Unglaube unwidersprochen in Geltung stehen.“88 In der religiösen Pluralität stehen verschiedenen Formen des Glaubens und Nichtglaubens nebeneinander und beeinflussen sich. Der Glaube hat dabei viel von seiner Verankerung im sozialen Leben verloren89. Das stellt kirchliches und theologisches Handeln vor neue Herausforderungen, weil moralische, ethische oder spirituelle Einstellungen jeweils neu getroffen werden und den jeweiligen Ansprüchen standhalten müssen. Der Verweis auf Traditionen kann dabei hilfreich sein, ist als alleinige Argumentation jedoch nicht ausreichend, weil die Individualisierung in den letzten Jahrzehnten ein vorher unbekanntes Maß erreicht hat90.
José Casanova: Zunehmender Einfluss von Religion in der Öffentlichkeit
Der Einschätzung des US-amerikanischen Religionssoziologen José Casanova zufolge gewinnt Religion in den europäischen Gesellschaften wieder an Einfluss. Die Erweiterung der Europäischen Union, Globalisierungs- und Migrationsprozesse und Terrorangriffe haben zu einer verstärkten Diskussion über die Identität Europas und den Einfluss der Religion in der Gesellschaft geführt91. Die christlichen Kirchen sind entsprechend herausgefordert.
Casanova erachtet es als schwierig, die Rolle von Religion in einem religiös sehr unterschiedlich geprägten Europa mit dem Säkularisierungsparadigma zu kennzeichnen. Das Säkularisierungstheorem versucht, eine komplexe Situation vereinfacht darzustellen und reduziert dabei die Komplexität der Bedeutung von Religion. Casanova misst eine zunehmende Relevanz von Religion in der europäischen Öffentlichkeit92. Er führt sie nicht nur auf die Bedrohung durch den Terrorismus, sondern auch auf Globalisierungs- und Migrationsprozesse und die Erweiterung der EU zurück, die v.a. Fragen nach dem Zusammenhalt Europas und der Rolle des Christentums neu gestellt haben93. Für ihn lässt sich in den meisten europäischen Ländern für die Mehrheit der Bevölkerung eine unbestimmte Art von Glauben an einen Gott feststellen. Ausnahmen bilden hier historisch bedingt Ostdeutschland und Tschechien als die wohl am meisten säkularisierten Gebiete der Welt. Der Grad der individuellen religiösen Praxis ist dabei aber stark gesunken. Der Glaube an einen personalen Gott, regelmäßiges Beten und das Bekennen von religiösen Erfahrungen trifft in der Mehrzahl der europäischen Staaten nur noch auf eine Minderheit zu. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod ist für eine Mehrzahl der Befragten wichtig94. Statistisch lässt sich nachweisen, dass die Zustimmung dazu gerade unter den Jüngeren gestiegen ist. Casanova deutet das als „[…] deutliches Anzeichen für eine starke Hoffnung auf Transzendenz sogar im säkularisierten Europa“95. Umso problematischer erscheint in einer globalen Sichtweise der europäische Hang, das Säkularisierungsparadigma als Zukunftsentwurf anzunehmen. Casanova spricht von „sich selbst erfüllende[n; A. B.] Prophezeiungen“96. Dahinter steht die Annahme, je moderner Gesellschaften wurden, desto stärker müsste die Säkularisierung vorangetrieben werden. Die Abnahme religiöser Praxis war die Konsequenz. Casanova erachtet den Versuch Europas, säkulare Neutralität zum obersten Prinzip zu ernennen, als problematisch:
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.