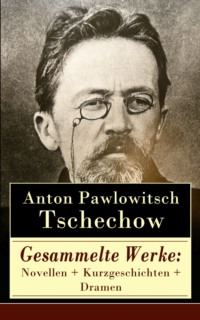Kitabı oku: «Gesammelte Werke: Novellen + Kurzgeschichten + Dramen», sayfa 11
»Schläfst du nicht?« fragte sie gähnend. »Schlaf, schlaf, ich bin nur für einen Augenblick hergekommen … Ich will die Tropfen holen …«
»Was brauchen Sie sie?«
»Die arme Lilli hat wieder ihre Kolik. Schlaf, mein Kind, du mußt ja morgen ins Examen …«
Sie holte aus dem Schränkchen ein Fläschchen, trat damit ans Fenster, las das Etikett und ging hinaus.
»Marja Leontjewna, es sind nicht die richtigen Tropfen!« hörte Wolodja nach einer Weile. »Das sind Maiglöckchentropfen, und Lilli bittet um Morphin. Schläft Ihr Sohn schon? Bitten Sie ihn, daß er die richtigen heraussucht …«
Es war Njutas Stimme. Wolodja überlief es kalt. Er zog schnell die Hose an, warf sich den Mantel über und ging zur Tür.
»Verstehen Sie? Morphin!« erklärte Njuta leise. »Es muß lateinisch auf dem Fläschchen stehen. Wecken Sie Wolodja, er wird es schon finden …«
Die Mama öffnete die Türe, und Wolodja erblickte Njuta. Sie hatte die gleiche Bluse an, in der sie gestern aus dem Bade kam. Ihr Haar war offen und fiel auf die Schultern herab, das Gesicht war verschlafen und schien im Dämmerlichte seltsam dunkel.
»Wolodja schläft ja nicht …« sagte sie. »Wolodja, suchen Sie doch bitte das Morphin heraus! Es ist eine Plage mit dieser Lilli … Immer hat sie etwas.«
Die Mama sagte etwas, gähnte und ging.
»Suchen Sie doch,« sagte Njuta. »Was stehen Sie so da?«
Wolodja ging zum Schränkchen, hockte sich hin und begann unter den Fläschchen und Schächtelchen herumzukramen. Seine Hände zitterten, und in der Brust und im Magen, hatte er ein Gefühl, als ob durch alle seine Eingeweide kalte Wellen liefen. Der Geruch von Aether, Karbolsäure und allerlei Kräutern, nach denen er mit seinen zitternden Händen griff und die er dabei verschüttete, benahm ihm den Atem.
– Ich glaube, die Mama ist weg – dachte er sich. – Das ist gut … gut … –
»Wird's bald?« fragte Njuta gedehnt.
»Sofort … Hier ist, glaub ich, das Morphin …« sagte Wolodja, der eben auf einem Etikett die Silbe »Morph.« las. »Hier, bitte!«
Njuta stand in der Türe so, daß einer ihrer Füße sich im Korridor und der andere in Wolodjas Zimmer befand. Sie richtete an ihrem Haar, doch ohne jeden Erfolg – so lang und dicht war es! – und blickte zerstreut Wolodja an. In ihrer weiten Bluse, verschlafen, mit aufgelöstem Haar, erschien sie Wolodja im trüben Lichte, das ins Zimmer von dem schon weißen, aber noch nicht von der Sonne beleuchteten Himmel fiel, bezaubernd und herrlich … Entzückt, am ganzen Leibe zitternd, mit unsagbarer Wonne daran denkend, wie er diesen herrlichen Körper in der Laube umarmt hatte, reichte er ihr die Tropfen und sagte:
»Wie sind Sie doch …«
»Was?«
Sie trat ins Zimmer.
»Was?« fragte sie, lächelnd.
Er schwieg und sah sie an und ergriff wie damals in der Laube ihre Hand … Sie aber betrachtete ihn lächelnd und wartete, was wohl noch kommen würde.
»Ich liebe Sie …« flüsterte er.
Sie hörte zu lächeln auf, dachte eine Weile nach und sagte:
»Warten Sie, ich glaube, jemand kommt her … Ach, diese Gymnasiasten!« sagte sie halblaut, zur Türe gehend und in den Korridor hinausblickend. »Nein, es ist niemand …«
Und sie kehrte zurück ....
Wolodja war es, als ob das Zimmer, Njuta, das Morgengrauen und er selbst, als ob alles im Gefühl eines brennenden, ungewöhnlichen, noch nicht dagewesenen Glückes zusammenflösse, für das man sein Leben opfern und ewige Qualen erdulden könnte; aber nach einer halben Minute war schon alles vorbei. Wolodja sah nur das volle, unschöne, vor Ekel verzerrte Gesicht und fühlte auch selbst Ekel vor dem, was eben geschehen war.
»Ich muß aber gehen,« sagte Njuta, indem sie Wolodja angewidert musterte. »So häßlich, so jämmerlich … Pfui, garstiges Entenküken!«
So abstoßend kamen jetzt Wolodja ihre langen Haare, ihre weite Bluse, ihre Schritte und ihre Stimme vor! …
– Garstiges Entenküken … – sagte er sich, als sie schon fort war. – Ich bin in der Tat garstig … Alles ist häßlich. –
Draußen ging die Sonne auf, und die Vögel zwitscherten laut. Man hörte den Gärtner durch den Garten gehen und den Sand unter seinem Karren knirschen … Und etwas später erklang das Gebrüll der Kühe und das Spiel der Hirtenflöte. Das Sonnenlicht und alle diese Töne erzählten, daß es irgendwo in der Welt ein reines, schönes, poetisches Leben gibt. Wo ist es aber? Weder Mama, noch die andern Menschen, die ihn umgaben, hatten ihm etwas davon erzählt.
Als der Diener ihn zum Frühzuge weckte, stellte er sich schlafend.
– Zum Teufel damit! – dachte er sich.
Er stand erst nach zehn auf. Als er sich vor dem Spiegel kämmte und sein unschönes, nach der schlaflosen Nacht blasses Gesicht betrachtete, sagte er sich:
– Ganz richtig … Ein garstiges Entenküken. –
Als die Mama ihn sah, entsetzte sie sich, daß er nicht im Examen war, Wolodja aber erklärte:
»Ich habe verschlafen, Mama … Machen Sie sich aber keine Sorge, ich werde ein ärztliches Attest beibringen.«
Frau Schumichina und Njuta erwachten erst nach zwölf. Wolodja hörte, wie Frau Schumichina ihre Fenster mit Geklirr aufschlug, wie Njuta auf ihre rauhe Stimme mit schallendem Gelächter antwortete. Er sah, wie die Türe aufging und der lange Zug der Nichten und schmarotzenden Tischgäste (unter den letzteren befand sich auch seine Mama) zum Frühstück ging; er sah auch das frischgewaschene, lachende Gesicht Njutas und daneben die schwarzen Brauen und den Vollbart des Architekten, der eben angekommen war.
Njuta hatte ein kleinrussisches Kostüm an, das ihr gar nicht stand und sie plump erscheinen ließ; der Architekt machte dumme und abgeschmackte Witze; in dem Klops, den man zum Frühstück reichte, war, wie es Wolodja schien, viel zu viel Zwiebel. Es schien ihm auch, daß Njuta absichtlich laut lachte und immer zu ihm hinübersah, um ihm zu zeigen, daß die Erinnerung an die Nacht ihr nicht die geringsten Schmerzen mache und daß sie die Anwesenheit des häßlichen Entenkükens am Frühstückstische gar nicht bemerkte.
Gegen vier Uhr fuhr Wolodja mit der Mama zur Station. Die unsauberen Erinnerungen, die schlaflose Nacht, die bevorstehende Relegation, die Gewissensbisse – alles erregte in ihm einen schweren, düsteren Haß. Er betrachtete das magere Profil der Mama, ihr kleines Näschen, den Regenmantel, den ihr Njuta geschenkt hatte, und brummte:
»Warum pudern Sie sich? Das paßt sich doch nicht in Ihrem Alter! Sie schminken sich, bezahlen Ihre Kartenschulden nicht und rauchen fremde Zigaretten … das ist ekelhaft! Ich liebe Sie nicht … ich liebe Sie nicht!«
Er beschimpfte sie, sie aber bewegte erschrocken die Aeuglein, schlug die Händchen zusammen und flüsterte entsetzt:
»Was hast du, liebes Kind? Mein Gott, der Kutscher hört es ja! Schweig, der Kutscher hört es! Er hört jedes Wort!«
»Ich liebe Sie nicht… ich liebe Sie nicht!« fuhr er keuchend fort. »Sie haben keine Moral im Leibe, Sie sind herzlos … Unterstehen Sie sich nicht, diesen Regenmantel zu tragen! Hören Sie? Sonst reiße ich ihn in Fetzen …«
»Mein Kind, beruhige dich!« jammerte die Mama. »Der Kutscher hört es!«
»Und wo ist das Vermögen meines Vaters? Wo ist Ihr Geld? Sie haben alles durchgebracht! Ich schäme mich nicht meiner Armut, aber ich schäme mich, daß ich so eine Mutter habe! Wenn meine Freunde nach Ihnen fragen, muß ich jedesmal erröten.«
Mit dem Zuge hatten sie bis zur Stadt nur zwei Stationen zu fahren. Während der ganzen Fahrt stand Wolodja auf der Plattform und zitterte. Er wollte nicht in den Wagen gehen, da dort seine Mutter saß, die er haßte. Er haßte auch sich selbst, die Schaffner, den Rauch der Lokomotive und die Kälte, der er sein Zittern zuschrieb … Und je schwerer es ihm ums Herz war, um so stärker fühlte er, daß es irgendwo in dieser Welt Menschen gibt, die ein reines, edles, warmes und schönes Leben voller Liebe, Zärtlichkeit, Freude und Freiheit leben … Er fühlte es und grämte sich so sehr, daß einer der Fahrgäste ihn aufmerksam ansah und fragte:
»Sie haben wohl Zahnweh?«
In der Stadt lebten Mama und Wolodja bei Marja Petrowna, einer adligen Dame, die eine große Wohnung hatte und Zimmer vermietete. Die Mama hatte zwei Zimmer: in dem einen, dem mit den Fenstern, wo ihr Bett stand und an der Wand zwei Bilder in Goldrahmen hingen, hauste sie selbst, und im anschließenden kleinen und fensterlosen wohnte Wolodja. Hier stand das Sofa, auf dem er schlief, und andere Möbel gab es hier nicht: das ganze Zimmer war voller Kinderkörbe, Hutschachteln und allerlei Gerümpel, das die Mama aus irgendeinem Grunde aufhob. Seine Aufgaben pflegte Wolodja im Zimmer der Mutter, oder im »Gesellschaftszimmer« zu machen; so hieß ein großes Zimmer, in dem sich alle Mieter zum Mittagessen und in den Abendstunden versammelten.
Nach Hause zurückgekehrt, legte er sich aufs Sofa und deckte sich mit dem Mantel zu, um sein Zittern zu bewältigen. Die Hutschachteln, Körbe und das Gerumpel erinnerten ihn daran, daß er kein eigenes Zimmer, keine Zuflucht hatte, wo er sich vor der Mama, vor ihren Gästen und vor den Stimmen, die jetzt aus dem Gesellschaftszimmer drangen, verstecken könnte, und der Ranzen und die Bücher, die in den Ecken herumlagen, – an das Examen, das er versäumt hatte … Ohne jeden ersichtlichen Grund kam ihm plötzlich Mentone in den Sinn, wo er einmal als siebenjähriger Junge mit seinem verstorbenen Vater gewesen war; auch an Biarritz und die zwei kleinen Engländerinnen, mit denen er im Sande herumlief, mußte er denken … Er wollte sich die Farbe des Himmels und des Ozeans, die Größe der Wellen und seine damalige Stimmung in Erinnerung rufen, aber das gelang ihm nicht; die beiden kleinen Engländerinnen huschten wie lebendig durch seine Erinnerung, alles andere aber vermischte sich und verschwand ....
– Nein, hier ist es zu kalt, – sagte sich Wolodja. Er stand auf, zog den Mantel an und ging ins Gesellschaftszimmer.
Im Gesellschaftszimmer trank man Tee. Am Samowar saßen dreie: seine Mutter, die alte Musiklehrerin mit dem Zwicker in Schildpattfassung, und Augustin Michailowitsch, ein älterer dicker Franzose, der an einer Parfümeriefabrik angestellt war.
»Ich habe heute nicht zu Mittag gegessen,« sagte Mama. »Ich würde gern das Mädchen nach Brot schicken.«
»Dunjascha!« rief der Franzose.
Es stellte sich heraus, daß die Hausfrau das Mädchen irgendwohin fortgeschickt hatte.
»Oh, das hat nichts zu sagen,« sagte der Franzose mit einem breiten Lächeln. »Ich gehe gleich selbst hin und hole Brot. Oh, das macht nichts!«
Er legte seine starke, stinkende Zigarre an eine sichtbare Stelle, setzte den Hut auf und ging. Als er draußen war, begann die Mama der Musiklehrerin zu erzählen, wie sie bei den Schumichins zu Besuch gewesen war und wie schön man sie dort aufgenommen hatte.
»Lilli Schumichina ist ja meine Verwandte …« sagte sie.
»Ihr verstorbener Mann, General Schumichin war ein Cousin meines Mannes. Und sie selbst ist eine geborene Baronin Kolb …«
»Mama, es ist ja nicht wahr!« sagte Wolodja gereizt: »Wozu die Lüge?«
Er wußte sehr gut, daß seine Mama die Wahrheit sprach; in ihren Worten über den General Schumichin und die geborene Baronin Kolb war nichts erlogen, und doch hatte er das Gefühl, daß alles Lüge sei. Er fühlte die Lüge in ihrer Manier zu sprechen, in ihrem Gesichtsausdruk, im Blick, in allem.
»Sie lügen!« wiederholte Wolodja und schlug mit der Faust so heftig auf den Tisch, daß das ganze Geschirr klirrte und die Mama ihren Tee verschüttete. »Warum erzählen Sie von den Generälen und Baroninnen? Alles ist Lüge!«
Die Musiklehrerin wurde verlegen und begann ins Taschentuch zu husten, als ob ihr etwas in die unrechte Kehle gekommen wäre, und die Mama brach in Tränen aus.
– Wohin soll ich nun gehen? – fragte sich Wolodja.
Auf der Straße war er schon gewesen; seine Freunde aufzusuchen, schämte er sich. Wieder kamen ihm unberufen die beiden kleinen Engländerinnen in den Sinn … Er schlenderte einmal von Ecke zu Ecke und ging dann ins Zimmer Augustin Michailowitschs. Hier roch es stark nach ätherischen Oelen und Glyzerinseife. Auf dem Tisch, auf den Fensterbänken und sogar auf den Stühlen standen eine Menge Fläschchen, Gläschen und Schälchen mit allerlei farbigen Flüssigkeiten. Wolodja nahm vom Tisch eine Zeitung, entfaltete sie und las den Titel: »Figaro« … Der Zeitung entströmte irgendein starker und angenehmer Duft. Dann fand er auf dem Tische einen Revolver ....
»Beruhigen Sie sich, machen Sie sich nichts draus!« tröstete im Nebenzimmer die Musiklehrerin seine Mama. »Er ist ja noch so jung! In seinem Alter erlauben sich die jungen Leute oft zu viel. Da muß man schon ein Auge zudrücken.«
»Nein, Jewgenia Andrejewna, er ist allzu verdorben!« sagte die Mama in singendem Tone. »Er hat niemand über sich, und ich bin schwach und kann nichts ausrichten. Nein, ich bin wirklich unglücklich!«
Wolodja steckte sich den Lauf des Revolvers in den Mund, tastete mit dem Finger nach dem Hahn oder Abzug und drückte … Dann fand er noch einen anderen Vorsprung und drückte noch einmal. Er nahm den Lauf aus dem Munde, trocknete ihn mit dem Schoße des Mantels ab und besah sich den Mechanismus … er hatte noch nie im Leben eine Schußwaffe in der Hand gehabt ....
– Ich glaube, man muß erst das da heben … – überlegte er sich. – Ja, wahrscheinlich so … –
Ins Gesellschaftszimmer kam eben Augustin Michailowitsch zurück und begann, laut lachend, etwas zu erzählen. Wolodja steckte sich den Revolverlauf wieder in den Mund, preßte ihn mit den Zähnen zusammen und drückte wieder mit dem Finger … Der Schuß krachte … Etwas schlug Wolodja mit furchtbarer Kraft in den Nacken, und er fiel auf den Tisch, mit dem Gesicht auf die Fläschchen und Gläschen. Dann sah er, wie sein verstorbener Vater im Zylinderhut mit breitem Flor, den er damals in Mentone, als er irgendeine Dame beweinte, trug, ihn plötzlich mit beiden Armen ergriff … Und sie flogen beide in irgendeinen finsteren, tiefen Abgrund.
Und dann vermischte sich alles und verschwand ....
Jonytsch
Übersetzt von Alexander Eliasberg
I
Wenn sich die Fremden in der Gouvernementsstadt S. über die Langweile und Eintönigkeit des Lebens beklagten, so rechtfertigten sich die Ortsbewohner, daß es in S. im Gegenteil sogar sehr schön sei, daß man hier eine Bibliothek, ein Theater und einen Klub hätte, daß manchmal Bälle veranstaltet werden und daß es schließlich auch intelligente, interessante, angenehme Familien gäbe, mit denen man verkehren könne. Und sie wiesen gewöhnlich auf die Familie Turkin hin, als auf die intelligenteste und talentierteste.
Diese Familie bewohnte ein eigenes Haus in der Hauptstraße neben dem Hause des Gouverneurs. Iwan Petrowitsch Turkin selbst, ein korpulenter, hübscher Herr mit schwarzem Backenbart, organisierte Liebhabervorstellungen mit wohltätigem Zweck, in denen er selbst die Rollen alter Generäle spielte und dabei sehr komisch hustete. Er kannte zahllose Witze, Wortspiele, Scherzfragen, komische Redensarten, liebte zu witzeln und geistreich zu tun und hatte immer einen solchen Gesichtsausdruck, daß man unmöglich erraten konnte, ob er Scherz oder Ernst mache. Seine Frau, Wjera Iossifowna, eine schmächtige Dame von angenehmem Aeußeren, mit einem Zwicker auf der Nase, schrieb Romane und Novellen und las sie gerne ihren Gästen vor. Die Tochter, Jekaterina Iwanowna, ein achtzehnjähriges junges Mädchen, spielte Klavier. Mit einem Worte, jedes Mitglied dieser Familie hatte irgendein Talent. Die Turkins übten große Gastfreundschaft und zeigten ihren Gästen ihre Talente mit Vergnügen und Herzenseinfalt. In ihrem großen, aus Stein erbauten Hause war es geräumig und im Sommer angenehm kühl, und die Hälfte der Fenster ging nach dem alten schattigen Garten hinaus, wo im Frühjahr die Nachtigallen sangen; wenn im Hause Besuch war, so klopften in der Küche die Messer, im Hofe roch es nach gerösteten Zwiebeln, und das verhieß jedesmal ein reichliches und schmackhaftes Abendessen.
Auch dem Doktor Dmitrij Ionytsch Starzew, der soeben den Posten eines Landarztes bekommen und sich in Djalisch, neun Werst von S. niedergelassen hatte, erklärte man, daß er als gebildeter Mann unbedingt die Familie Turkin kennen lernen müsse. Einmal im Winter machte ihn jemand auf der Straße mit Iwan Petrowitsch bekannt; sie wechselten einige Worte über das Wetter, über das Theater, über die Cholera, und gleich darauf kam auch die Einladung. An einem Feiertage im Frühjahr – es war Himmelfahrt – begab sich Starzew nach der Sprechstunde in die Stadt, um sich etwas zu zerstreuen und auch einige Einkäufe zu machen. Er ging zu Fuß (eigene Pferde hatte er damals noch nicht), und sang vor sich hin:
»Als ich noch keine Tränen trank aus dieses Daseins Kelch …«
In der Stadt aß er zu Mittag, ging dann im Stadtgarten spazieren; plötzlich kam ihm die Einladung Iwan Petrowitschs in den Sinn, und er beschloß, die Turkins zu besuchen, um zu sehen, was das für Menschen seien.
»Ich grütze Sie!« empfing ihn Iwan Petrowitsch im Vorzimmer. »Ich bin glücklich, einen so angenehmen Gast bei uns zu sehen. Kommen Sie mit, ich will Sie meinem Ehegespenst vorstellen. Ich sage ihm Wjerotschka,« fuhr er fort, nachdem er den Doktor seiner Frau vorgestellt hatte: »ich sage ihm, daß er nicht das geringste römische Recht hat, immer in seinem Spital zu hocken, und seine freie Zeit der Gesellschaft widmen muß. Nicht wahr, Herzchen?«
»Setzen Sie sich, bitte,« sagte Wjera Iossifowna, ihm einen Platz an ihrer Seite zeigend. »Sie dürfen mir den Hof machen. Mein Mann ist zwar eifersüchtig wie ein Othello, aber wir wollen uns so benehmen, daß er nichts merkt.«
»Ach, du Küken …« sagte Iwan Petrowitsch zärtlich und küßte sie auf die Stirn. »Sie kommen gerade recht,« wandte er sich wieder an den Gast: »mein Ehegespenst hat einen mordsgroßen Roman vollendet und wird ihn heute vorlesen.«
»Jeanchen,« wandte sich Wjera Iossifowna an ihren Mann, »dites que l'on nous donne du thé.«
Starzew lernte auch die Tochter Jekaterina Iwanowna kennen, die der Mutter sehr ähnlich sah und ebenso schmächtig wie diese war. Der Ausdruck ihres hübschen Gesichts war noch kindlich, und ihre Figur schlank und graziös; auch der jungfräuliche, schon erblühte, schöne Busen atmete Frühling, echten Frühling. Sie tranken Tee mit Marmelade, Honig, Konfekt und außerordentlich schmackhaftem Gebäck, das im Munde schmolz. Als der Abend anbrach, versammelten sich auch die anderen Gäste, und Iwan Petrowitsch sah einen jeden von ihnen mit seinen lachenden Augen an und sagte:
»Ich grütze Sie!«
Später saßen alle mit sehr ernsten Gesichtern im Salon, während Wjera Iossifowna ihren Roman vorlas. Er begann mit den Worten: »Der Frost nahm zu …« Die Fenster standen weit offen, man hörte die Messer in der Küche klopfen und roch die gerösteten Zwiebeln … In den weichen, tiefen Sesseln saß es sich so bequem, das Lampenlicht flackerte so freundlich im Dämmer des Salons; und wie man so an diesem Sommerabend saß, die Stimmen und das Lachen von der Straße her hörte und den Fliederduft, der vom Garten kam, einatmete, konnte man sich schwer vorstellen, wie der Frost zunahm und die untergehende Sonne mit ihren kalten Strahlen die schneeverwehte Steppe und den einsamen Wanderer beleuchtete; Wjera Iossifowna las von einer jungen hübschen Gräfin, wie sie in ihrem Dorfe Schulen, Krankenhäuser und Bibliotheken errichtete und wie sie sich in einen wandernten Künstler verliebte; sie las von Dingen, die im Leben niemals vorkommen, und doch war es so angenehm und gemütlich, ihr zuzuhören: allerlei schöne, beruhigende Gedanken kamen einem in den Sinn, und man hatte gar nicht Lust, aufzustehen.
»Nicht übelhaft …« sagte leise Iwan Petrowitsch.
Und einer von den Gästen, der mit seinen Gedanken irgendwo sehr weit weg war, sagte kaum hörbar:
»Ja … in der Tat …«
So vergingen an die zwei Stunden. Im nahen Stadtgarten spielte ein Orchester und sang ein Bauernchor. Als Wjera Iossifowna ihr Manuskript zuklappte, herrschte an die fünf Minuten lang Schweigen, und alle lauschten dem Volksliede, das der Chor sang und das von Dingen erzählte, die es im Roman nicht gab, die aber im Leben wohl vorkommen.
»Lassen Sie Ihre Werke in den Zeitschriften erscheinen?« fragte Starzew Wjera Iossifowna.
»Nein,« antwortete sie, »ich lasse sie nirgends erscheinen. Wenn ich etwas fertig habe, so tue ich es in meinen Schrank. Wozu soll ich es auch drucken? Wir haben ja Mittel.«
Alle seufzten aus irgendeinem Grunde leise auf.
»Und jetzt spiel du etwas vor, Kätzchen,« wandte sich Iwan Petrowitsch an die Tochter.
Man hob den Deckel des Klaviers und schlug das Notenheft auf, das schon bereit lag. Jekaterina Iwanowna setzte sich hin und schlug mit beiden Händen in die Tasten; gleich darauf schlug sie noch einmal mit aller Kraft hin, und dann noch einmal, und noch einmal; ihre Schultern und Brust bebten, sie schlug hartnäckig immer auf die gleiche Stelle los, und man hatte den Eindruck, daß sie nicht eher aufhören wollte, als bis sie die Tasten tief ins Klavier hineingejagt haben würde. Der Salon füllte sich mit Donner; alles dröhnte: der Fußboden, die Decke, die Möbel … Jekaterina Iwanowna spielte ein schwieriges Stück, das sehr lang und eintönig, aber gerade durch seine Schwierigkeiten interessant war. Starzew hörte zu und stellte sich vor, daß von einem hohen Berge Steine herabrollen, unaufhörlich herabrollen, und er hatte den Wunsch, daß sie nicht mehr herabrollen; aber Jekaterina Iwanowna, die vor Anspannung ganz rosig war, und so stark und energisch, dreinschlug, während ihr eine Locke auf die Stirne gefallen war, gefiel ihm sehr gut. Es war ihm so angenehm, so neu, nach dem Winter, den er in Djalisch unter den Bauern und Kranken verbracht hatte, hier im Salon zu sitzen, dieses junge, hübsche und wahrscheinlich keusche Wesen anzublicken und diesen lauten, ennuyanten, aber immerhin von Kultur zeugenden Tönen zu lauschen ....
»Kätzchen, du hast heute so gespielt, wie noch nie,« sagte Iwan Petrowitsch mit Tränen in den Augen, als die Tochter fertig war und sich von ihrem Platze erhob. »Nun kannst du ruhig sterben: besser spielst du deinen Lebtag nicht.«
Alle drängten sich um sie, beglückwünschten und bewunderten sie und behaupteten, daß sie schon lange keine solche Musik gehört hätten, sie aber hörte schweigend, leise lächelnd zu, und ihr ganzes Wesen drückte Triumph aus.
»Wunderbar! Herrlich!«
»Wunderschön!« sagte auch Starzew, sich von der allgemeinen Begeisterung hinreißen lassend. »Wo haben Sie Musik studiert?« fragte er Jekaterina Iwanowna: »Am Konservatorium?«
»Nein, aufs Konservatorium will ich erst kommen, vorläufig habe ich hier Stunden genommen, bei der Madame Zawlowska.«
»Haben Sie auch das hiesige Mädchengymnasium besucht?«
»Oh nein!« antwortete Wjera Iossifowna für ihre Tochter. »Wir haben stets Privatlehrer im Haus, Sie werden doch zugeben, daß im Gymnasium oder einem Institut schädliche Einflüsse möglich sind; ein junges Mädchen soll aber nur unter dem Einflusse ihrer Mutter stehen.«
»Und doch gehe ich aufs Konservatorium!« erklärte Jekaterina Iwanowna.
»Nein, Kätzchen liebt die Mama. Kätzchen wird Papa und Mama keinen Kummer machen wollen.«
»Nein, ich gehe doch hin! Ganz bestimmt!« sagte Jekaterina Iwanowna halb im Scherz und stampfte trotzig mit dem Füßchen.
Während des Abendessens zeigte auch Iwan Petrowitsch seine Künste. Nur mit den Augen allein lachend, erzählte er Witze, stellte Scherzfragen, die er sofort selbst beantwortete, und sprach die ganze Zeit seine eigentümliche Sprache, die er sich offenbar durch langjährige Uebungen im Witzemachen angeeignet hatte und die ihm wohl zur Gewohnheit geworden war: nicht übelhaft; leben Sie sowohl, als auch; ich grütze Sie; ich danke vergebens und dergleichen.
Das war aber noch nicht alles. Als die Gäste, satt und zufrieden, sich im Vorzimmer drängten und ihre Mäntel und Stöcke suchten, half ihnen dabei der Lakai Pawluscha, oder Pawa, wie man ihn nannte, ein vierzehnjähriger Junge mit kurzgeschorenem Kopf und Pausbacken.
»Nun, Pawa, produziere dich!« sagte ihm Iwan Petrowitsch.
Pawa stellte sich in Positur, hob einen Arm in die Höhe und sprach in tragischem Ton:
»Stirb, Unselige!«
Und alle lachten.
– Nicht uninteressant, – sagte sich Starzew, als er draußen war.
Er ging noch in ein Restaurant, trank ein Glas Bier und begab sich dann zu Fuß nach Djalisch. Im Gehen sang er ununterbrochen das Rubinsteinsche Lied:
»Die Stimme dein, so zärtlich und so freundlich…«
Als er die neun Werst gegangen war und sich später zu Bett legte, spürte er nicht die geringste Müdigkeit; im Gegenteil, er hatte den Eindruck, daß er mit dem größten Vergnügen noch weitere zwanzig Werst gehen könnte.
– Nicht übelhaft … – fiel es ihm im Einschlafen ein, und er mußte lachen.