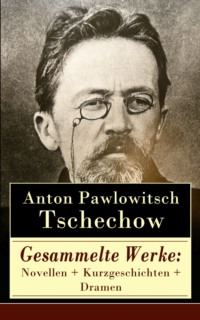Kitabı oku: «Gesammelte Werke: Novellen + Kurzgeschichten + Dramen», sayfa 16
Der Untersuchungsrichter spuckte aus und ging zum Badehaus hinaus. Ihm folgte mit gesenktem Haupte Djukowski. Beide bestiegen sie schweigend den Charabancs und fuhren ab. Noch niemals war ihnen der Weg so weit und langweilig erschienen, wie diesmal. Beide schwiegen. Tschubikow zitterte den ganzen Weg vor Wut, Djukowski verbarg sein Gesicht im Kragen, als fürchtete er, daß die Dunkelheit und der Sprühregen auf seinem Gesicht die Beschämung lesen könnten.
Zu Hause angelangt, fand der Untersuchungsrichter bei sich den Doktor Tjutjujew vor. Der Arzt saß am Tisch und blätterte seufzend in der ›Niwa‹.
»Was nicht wieder alles los ist!« sagte er, den Untersuchungsrichter mit einem trüben Lächeln begrüßend. »Wieder Österreich! . . . Und auch Gladstone gewissermaßen . . .«
Tschubikow warf seinen Hut unter den Tisch und erbebte.
»Teufelsskelett! Laß mich in Ruh! Tausendmal habe ich Dir gesagt, daß Du mir nicht mit Deiner Politik kommen sollst! Hab' was anderes im Kopf! – Und Dir«, wandte sich Tschubikow an Djukowski, die Fäuste ballend, »Dir . . . verzeihe ich das nie im Leben!«
»Aber . . . das schwedische Zündholz! Wie konnt ich denn wissen!«
»Daß Du an Deinem Zündholz erstickst! Gehe und ärgere mich nicht, sonst mache ich aus Dir weiß der Teufel was! Daß ich Deinen Fuß hier nicht sehe.«
Djukowski fuhr zusammen, nahm seinen Hut und ging.
»Ich geh und sauf mich voll!« beschloß er, als er zum Thor hinaus war und schlenderte betrübt dem Wirtshaus zu.
Als die Frau Amtshauptmann aus dem Badehause zurückkehrte, fand sie im Salon ihren Mann.
»Wozu war der Untersuchungsrichter hier?« fragte der Mann.
»Er war gekommen, um zu sagen, daß Kljausow gefunden sei. Er war garnicht ermordet. Im Gegenteil, er lebt und ist gesund . . . Stelle Dir vor, man hat ihn bei einer fremden Frau gefunden! . . .«
»Ach, Mark Iwanitsch, Mark Iwanitsch!« seufzte der Amtshauptmann, die Augen zur Decke erhebend. »Habe ich Dir nicht gesagt, daß Liederlichkeit zu nichts Gutem führt! Nein, wolltest auf mich nicht hören!«
Der Löwen- und Sonnenorden
In einer der diesseits des Urals gelegenen Städte hatte sich das Gerücht verbreitet, daß ein persischer Würdenträger namens Rachat-Chelam angekommen sei und im Hôtel »Japan« Wohnung genommen hätte. Dieses Gerücht machte auf die Einwohner keinen besonderen Eindruck, man begnügte sich damit, zu wissen, daß ein Perser da sei. Nur das Stadthaupt, Stepan Iwanowitsch Kuzin, wurde nachdenklich, als er vom Syndikus des Stadtamts von der Ankunft des Orientalen erfuhr, und fragte:
»Wohin reist er denn?«
»Ich glaube nach Paris oder London.«
»Hm! . . . Also ein hohes Tier?«
»Weiß der Kuckuck.«
Als das Stadthaupt aus dem Bureau nach Hause gekommen war und zu Mittag gegessen hatte, verfiel er wieder in Gedanken, und diesmal grübelte und dachte er bis zum Abend. Die Ankunft des persischen Würdenträgers beschäftigte ihn stark. Es schien ihm, daß das Schicksal selbst ihm diesen Rachat-Chelam geschickt hätte, und daß jetzt der richtige Augenblick gekommen sei, seinen sehnsüchtigen, leidenschaftlichen Wunsch zu verwirklichen. Kuzin besaß nämlich zwei Medaillen, den Stanislausorden 3. Klasse, das Abzeichen des Roten Kreuzes und das Abzeichen der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Außerdem hatte er sich noch eine Berlocke anfertigen lassen – eine goldne Flinte gekreuzt mit einer Guitarre –, die er an der Uhrkette zum Knopfloch der Uniform heraushängen ließ; von weitem sah die Berlocke etwas außergewöhnlich aus und konnte recht gut für ein Ehrenzeichen gehalten werden.
Nun ist es ja bekannt, je mehr einer Orden hat, umsomehr möchte er noch welche haben, und so wünschte sich denn das Stadthaupt schon lange, den persischen Löwen- und Sonnenorden zu erhalten. Sein Wunsch war brennend und unbezwingbar. Er wußte, daß man, um diesen Orden zu bekommen, weder zu kämpfen noch eine Wohlthätigkeitsanstalt zu dotieren, noch sich im Gemeindedienste hervorzuthun brauchte, sondern daß dazu nur eine günstige Gelegenheit nötig war. Und jetzt schien es ihm, daß diese Gelegenheit gekommen sei.
Am andern Tage gegen Mittag legte er sich alle seine Ehrenzeichen an, hing sich die Amtskette um den Hals und fuhr nach dem Hôtel »Japan«. Das Schicksal begünstigte ihn. Als er das Zimmer des persischen Würdenträgers betrat, war dieser allein und nicht beschäftigt. Rachat-Chelam, ein riesiger Asiate mit einer langen Bekassinennase und hervorstehenden Augen, saß im Fez auf der Diele und kramte in seinem Koffer.
»Ich bitte zu entschuldigen, wenn ich es gewagt habe, Sie zu inkommodieren«, begann Kuzin lächelnd. »Ich habe die Ehre, mich vorzustellen: erblicher Ehrenbürger und Ritter hoher Orden, Stepan Iwanowitsch Kuzin, das hiesige Stadthaupt. Ich hielt es für meine Pflicht, in Ihrer werten Person sozusagen dem Vertreter einer befreundeten und nachbarlichen Monarchie meine Ehrerbietung zu bezeugen . . .«
Der Perser wandte sich um und stammelte etwas in sehr schlechtem Französisch, das wie das Klappern auf einem Holzbrette klang.
»Die Grenzen Persiens«, fuhr Kuzin in seiner vorher einstudierten Begrüßungsrede fort, »befinden sich in enger Berührung mit denjenigen unseres weiten Vaterlandes, und daher veranlassen mich die gemeinsamen Sympathien, Ihnen sozusagen unsere Solidarität auszudrücken.«
Der persische Würdenträger erhob sich und stammelte wieder etwas in seiner hölzernen Sprache.
Kuzin, der überhaupt keine fremden Sprachen kannte, schüttelte den Kopf zum Zeichen, daß er nicht verstehe.
»Wie soll ich nur mit ihm sprechen?« dachte er. »Man müßte eigentlich gleich nach einem Dolmetsch schicken, aber die Sache ist etwas peinlich und läßt sich in Zeugengegenwart nicht gut abmachen. Der Dolmetsch würde es dann in der ganzen Stadt herumtragen.«
Und Kuzin suchte sich einige Fremdwörter ins Gedächtnis zu rufen, die er aus den Zeitungen kannte.
»Ich bin das Stadthaupt . . .« stammelte er, »das heißt Lord-Mayor . . . Municipale . . . Oui? Comprenez?«
Er wollte durch Worte oder mimisch seine soziale Stellung bezeichnen, wußte aber nicht, wie er es machen sollte. Ein an der Wand hängender Stich mit der deutlichen Unterschrift »Die Stadt Venedig« half ihm aus seiner Verlegenheit. Er wies mit dem Finger auf die Stadt und dann auf seinen Kopf, woraus sich seiner Meinung nach die Phrase, ergab: »Ich bin das Stadthaupt.«
Der Perser begriff nichts, lächelte aber und sagte: »Gutt, musje . . . Gutt . . .«
Eine halbe Stunde später klopfte das Stadthaupt den Perser bald auf das Knie, bald auf die Schulter und sprach:
» Comprenez? Oui . . .? Als Lord-mayor und Municipale . . . biete ich Ihnen eine kleine Promenade an . . . Comprenez? Promenade . . .«
Kuzin wies mit einem Finger auf Venedig und stellte mit zwei Fingern einherschreitende Beine dar.
Rachat-Chelam, der von den Medaillen des Stadthaupts nicht die Augen wandte und offenbar bereits vermutete, daß er die wichtigste Person der Stadt vor sich hatte, verstand das Wort » Promenade« und entblößte liebenswürdig seine Zähne.
Darauf zogen beide ihre Paletots an und verließen das Zimmer. Unten an der Thür, die zu dem Restaurant »Japan« führte, fiel es Kuzin ein, daß es nicht übel wäre, dem Perser etwas vorzusetzen. Er blieb stehen und sagte, auf die Tische weisend:
»Nach russischer Sitte könnte man jetzt mal . . . Purée . . . Entrecôte . . . Champagne und so weiter . . . Comprenez?«
Der Würdenträger begriff, und nach einer Weile saßen beide in einem der vornehmsten Chambre separées des Restaurants, tranken Champagner und aßen.
»Trinken wir auf das Wohl Persiens!« sprach Kuzin. »Wir Russen lieben die Perser. Wenn wir auch einen verschiedenen Glauben haben, aber die gemeinsamen Interessen, die gegenseitigen Sympathien . . . der Fortschritt . . . die Asiatischen Märkte . . . die friedliche Eroberung, sozusagen . . .
Der persische Würdenträger aß und trank mit großem Appetit. Er stach mit der Gabel nach dem geräucherten Stör und sagte, den Kopf schüttelnd, mit Begeisterung:
»Gutt! Bien!«
»Schmeckt's Ihnen?« fragte erfreut das Stadthaupt. » Bien? Na, das ist schon.« Und an den Kellner gewandt, sagte er: »Luka, sorge mal, mein Bester, dafür, daß zu Seiner Excellenz zwei Störe aufs Zimmer gebracht werden, aber von den besseren!«
Darauf fuhren das Stadthaupt und der Perser in eine Menagerie.
Die Einwohner sahen, wie ihr Stepan Iwanowitsch, vom Champagner gerötet, heiter und sehr zufrieden, den Perser in den Hauptstraßen und auf dem Marktplatz herumführte und ihm die Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigte. Auch auf den Turm des Feuerwehrhauses führte er ihn hinauf.
Unter anderem sahen die Einwohner auch, wie das Stadthaupt vor dem steinernen Thor mit den Löwen stehen blieb und zuerst auf einen der Löwen, dann nach oben auf die Sonne und dann auf seine eigene Brust wies, dann nochmals auf die Sonne und den Löwen, während der Perser wie zum Zeichen des Einverständnisses mit dem Kopfe nickte und lächelnd seine weißen Zähne zeigte.
Am Abend saßen sie im »Hôtel London« und lauschten den Harfenistinnen; wo sie aber in der Nacht waren, blieb unbekannt.
Des morgens am andern Tage war das Stadthaupt im Stadtamt. Die Beamten hatten offenbar schon einiges erfahren und Verdacht geschöpft. Wenigstens trat der Syndikus an ihn heran und sagte mit einem spöttischen Lächeln:
»Bei den Persern giebt es so eine Sitte, wenn zu ihnen ein vornehmer Gast kommt, so müssen sie für ihn eigenhändig einen Hammel schlachten . . . hm, hm!«
Etwas später wurde dem Stadthaupt ein mit der Post gekommenes Paket überreicht. Er öffnete dasselbe und fand eine Karikatur darin. Vor Rachat-Chelam kniete das Stadthaupt in eigener Person und sprach mit erhobenen Händen folgende Worte zu dem Perser:
Um Rußlands Freundschaft mit dem Schach
Zu ehren und zu achten,
Würd' ich am liebsten selbst mich schlachten
Als Hammel . . . Aber ach:
Ich bin ja nur ein Eseltier,
Was kann ich armer Mann dafür!
Das Stadthaupt empfand ein unangenehmes Gefühl, als saugte ihm etwas unter der Herzgrube, aber das dauerte nicht lange. Um Mittag war er schon wieder bei dem persischen Würdenträger und traktierte ihn. Dann zeigte er ihm wieder die Sehenswürdigkeiten der Stadt und führte ihn abermals vor das steinerne Thor, wo er wieder, bald auf den Löwen, bald auf die Sonne, bald auf seine Brust wies. Zu Mittag speisten sie in »Japan«, nach dem Essen bestiegen sie wieder, beide rot und glücklich, mit Zigarren im Munde, den Feuerwehrturm. Hier wollte offenbar das Stadthaupt dem Gast ein seltenes Schauspiel darbieten und schrie von oben hinab zu dem Posten, der unten auf und ab ging:
»Läute Alarm!«
Aber aus dem Alarm wurde nichts, da die Feuerwehrleute gerade im Bade waren.
Zu Abend speisten sie in »London«, nach dem Abendessen aber reiste der Perser ab.
Stepan Iwanowitsch küßte ihn, als er ihm das Geleit gab, nach russischer Sitte drei Mal und war sogar bis zu Thränen gerührt. Als der Zug sich in Bewegung setzte, rief er:
»Grüßen Sie Persien von uns. Sagen Sie Ihrem Vaterland, daß wir es lieben!«
*
Ein Jahr und vier Monate waren vergangen. Draußen war es bitterkalt, gegen 35° und dabei ein durchdringender Wind.
Stepan Iwanowitsch ging auf den Straßen umher in einem auf der Brust zurückgeschlagenen Pelz und ärgerte sich, daß niemand ihm begegnete und den Löwen- und Sonnenorden auf seiner Brust blitzen sah. So ging er bis zum Abend im offenen Pelz umher und fror fürchterlich.
In der Nacht aber warf er sich von der einen Seite auf die andere und konnte nicht einschlafen. Sein Herz war schwer und pochte unruhig, während ihn ein inneres Feuer verzehrte: er wollte jetzt den serbischen Takowa-Orden haben. Sein Wunsch war brennend und unbezwingbar . . .
Grischa
Grischa, ein kleiner dicker, zwei Jahre und acht Monate alter Junge, spaziert mit seiner Wärterin auf der Promenade. Er hat einen langen wattierten Mantel und warme Galoschen an, um seinen Hals ist ein großes Cachenez gebunden und auf dem Kopf sitzt eine große Mütze mit einer zottigen Troddel. Ihm ist so wie so schon heiß, und nun scheint ihm noch die freundliche Aprilsonne gerade in die Augen und kitzelt ihm die Lider.
Seine ganze, unsicher und schüchtern einherschreitende, plumpe Figur drückt äußerste Ratlosigkeit aus.
Bis jetzt hat Grischa nur eine einzige, viereckige Welt gekannt, in deren einer Ecke sein Bett, in der anderen die Lade der Wärterin, in der dritten ein Stuhl steht und in der vierten das Lämpchen vor dem Heiligenbilde glüht. Wirft man einen Blick unter das Bett, so findet man dort eine Puppe mit abgebrochenem Arm und eine Trommel, während hinter der Lade der Wärterin eine ganze Menge verschiedenartiger Dinge liegen: Zwirnrollen. Papierschnitzel, eine Schachtel ohne Deckel und ein invalider Hampelmann. In dieser Welt kann man, außer der Wärterin und Grischa, auch sehr häufig Mama und die Katze sehen. Mama sieht wie eine Puppe aus, und die Katze wie Papas Pelz, nur daß der Pelz keine Augen und keinen Schwanz hat. Aus der Welt, die die Kinderstube genannt wird, führt eine Thür in einen Raum, wo zu Mittag gegessen und Thee getrunken wird. Dort steht der hochbeinige Stuhl Grischas und hängt eine Uhr, die nur dazu da ist, um mit dem Pendel zu schlenkern und zu klingeln. Aus dem Speisezimmer kann man in ein anderes Zimmer treten, in welchem rote Sessel stehen. Dort auf dem Teppich sieht man einen dunklen Fleck, der noch immer die Veranlassung dazu giebt, daß man Grischa mit dem Finger droht. Hinter diesem Zimmer liegt noch ein anderes, in welches Grischa nicht hineingelassen wird und wo ab und zu Papa sich zu schaffen macht. Dieser Papa ist eine außerordentlich rätselhafte Persönlichkeit! Die Wärterin und Mama sind verständlich: sie kleiden Grischa an, füttern ihn und legen ihn zu Bett, aber wozu Papa existiert – das ist unklar. Es giebt noch eine andere rätselhafte Persönlichkeit – die Tante, die Grischa die Trommel geschenkt hat. Bald taucht sie auf, bald verschwindet sie wieder. Wohin verschwindet sie? Grischa hat mehr als einmal unter sein Bett geguckt, hinter die Lade und unter den Diwan, aber dort war sie nicht . . .
In dieser neuen Welt dagegen, wo die Sonne in die Augen sticht, giebt es so viel Papas, Mamas und Tanten, daß man gar nicht weiß, zu wem man heranlaufen soll. Das Komischste aber und Albernste, das sind – die Pferde. Grischa sieht zu, wie sie ihre Beine bewegen, und kann nichts begreifen. Er sieht die Wärterin an, damit diese ihm das Rätsel löse, aber die Wärterin schweigt.
Plötzlich hört er ein furchtbares Getrampel . . . Auf der Promenade bewegt sich gerade auf ihn zu in gleichmäßigem Schritt eine Truppe aus dem Schwitzbade zurückkehrender Soldaten mit roten Gesichtern und Birkenquasten unterm Arm. Grischa läuft es vor Schreck kalt über den Rücken und er sieht die Wärterin fragend an: ist das schrecklich? Aber die Wärterin läuft nicht weg und weint nicht, es ist also nicht schrecklich. Grischa begleitet die Soldaten mit den Augen und beginnt selbst im Takt zu schreiten.
Über die Promenade laufen zwei große Katzen mit langen Schnauzen, ausgestreckten Zungen und aufrecht stehenden Schwänzen. Grischa glaubt, daß auch er laufen müsse und läuft den Katzen nach.
»Halt!« schreit ihm die Wärterin zu, ihn rüde an der Schulter fassend. »Wohin? Wirst Du wohl artig sein!«
Dort sitzt eine Wärterin und hält einen kleinen Trog mit Apfelsinen. Grischa geht an ihr vorbei und nimmt sich, ohne ein Wort zu sagen, eine Apfelsine.
»Was machst Du denn da?« schreit seine Begleiterin, ihm einen Klaps auf die Hand gebend und die Apfelsine wieder entreißend. »Dummer Jung!«
Jetzt würde Grischa mit Vergnügen ein Glasstückchen aufheben, das ihm unter den Füßen liegt und in der Sonne wie das Lämpchen vor dem Heiligenbilde strahlt. Aber er fürchtet, daß man ihm wieder eins auf die Hand giebt.
»Ich habe die Ehre!« vernimmt Grischa plötzlich über seinem Ohr eine laute, tiefe Stimme und erblickt einen großen Mann mit glänzenden Knöpfen.
Zu seinem größten Vergnügen reicht dieser Mann der Wärterin die Hand, bleibt mit ihr stehen und beginnt ein Gespräch. Das Leuchten der Sonne, der Lärm der Wagen, die Pferde, die glänzenden Knöpfe, alles das ist so außerordentlich neu und so gar nicht schrecklich, daß Grischas Herz sich mit Wonne erfüllt und er zu lachen beginnt.
»Wollme gehn! Wollme gehn!« ruft er dem Mann mit den glänzenden Knöpfen zu und zupft ihn am Rock.
»Wohin denn?« fragt der Mann.
»Wollme gehn!« beharrt Grischa.
Er möchte sagen, daß es nicht schlecht wäre. auch Papa, Mama und die Katze mitzunehmen, aber seine Zunge sagt etwas ganz anderes, als was sie soll.
Nach einiger Zeit biegt die Wärterin von der Promenade ab und führt Grischa in einen großen Hof, wo noch Schnee liegt. Auch der Mann mit den glänzenden Knöpfen folgt ihnen. Sie gehen den Schneehaufen und Pfützen vorsichtig aus dem Wege, steigen dann eine schmutzige, dunkle Treppe hinauf und treten in ein Zimmer. Dort giebt es viel Rauch, es riecht nach Braten und eine Frau steht am Herd und bratet Koteletts. Die Köchin und die Wärterin küssen sich, setzen sich zusammen mit dem Mann auf die Bank und beginnen leise zu sprechen.
Grischa, der warm eingepackt ist, wird es unerträglich heiß und schwül.
»Woher kommt das?« denkt er, sich umsehend.
Er sieht eine dunkle Lage, Küchengerät und den Ofen, der wie eine große schwarze Höhle starrt . . .
»Ma–ma!« beginnt Grischa zu greinen.
»Nu, nu, nu!« schreit die Wärterin. »Kannst schon warten!«
Die Köchin stellt eine Flasche auf den Tisch, drei Gläser und einen Kuchen.
Die beiden Frauen und der Mann mit den glänzenden Knöpfen stoßen an, trinken mehrere mal, und der Mann umarmt bald die Köchin, bald die Wärterin. Dann beginnen sie alle drei leise zu singen.
Grischa streckt die Hände nach dem Kuchen und man giebt ihm ein Stückchen. Er ißt und sieht zu, wie die Wärterin trinkt . . . Er möchte auch trinken.
»Gieb! Gieb!« bittet er die Wärterin.
Die Köchin giebt ihm aus ihrem Glase zu nippen. Die Augen treten ihm heraus, er verzieht das Gesicht, hustet und wehrt sich noch lange mit den Armen, während die Köchin ihn betrachtet und lacht.
Nach Hause zurück gekehrt, beginnt Grischa der Mutter, den Wänden und dem Bett zu erzählen, wo er gewesen sei und was er gesehen habe. Er erzählt nicht so sehr mit der Zunge, als mit dem Gesicht und den Händen. Er zeigt, wie die Sonne leuchtet, wie die Pferde laufen, wie der schreckliche Ofen aussieht und wie die Köchin trinkt . . .
Am Abend kann er nicht einschlafen. Die Soldaten mit den Birkenquasten, die großen Katzen, die Pferde, das Glasstückchen, der Trog mit den Apselsinen, die glänzenden Knöpfe – alles das drängt sich zusammen und lastet ihm auf dem Gehirn. Er wälzt sich von einer Seite auf die andere, schwatzt und kann seiner Erregung nicht Herr werden, bis er endlich zu weinen anfängt.
»Du fieberst ja!« sagt die Mama, ihm die flache Hand auf die Stirn legend. »Woher kann denn das kommen?«
»Der Ofen!« weint Grischa. »Geh weg von hier. Ofen!«
»Er hat wohl zu viel gegessen . . .« meint die Mama.
Und Grischa, bewältigt von den Eindrücken des neuen Lebens, das er eben kennen gelernt, erhält von der Mama einen Löffel Ricinusöl.
Die Apothekerin
Das Städtchen B., das nur aus zwei bis drei krummen Straßen besteht, liegt in tiefen Schlummer versunken. In der regungslosen Luft vernimmt man kaum einen Laut. Nur irgendwo in der Ferne, wahrscheinlich außerhalb der Stadt, bellt mit einem dünnen, heiseren Tenor ein Hund. Bis zur Morgenröte dauert es nicht mehr lange.
Alles ruht. Nur die junge Frau des Provisors Tschornomordik, des Inhabers der B–schen Apotheke, schläft nicht. Sie hat sich schon dreimal zu Bette gelegt, aber der Schlaf flieht sie eigensinnig – Gott weiß warum. Sie sitzt am offenen Fenster im bloßen Hemde und sieht auf die Straße hinaus. Es ist ihr schwül, langweilig und ärgerlich zu Mute . . . so ärgerlich, daß sie sogar weinen möchte. Warum? Sie weiß es selbst nicht! Es liegt ihr wie ein hartes Stück auf der Brust, das immerfort zur Kehle aufsteigt . . .
Hinten, nur einige Schritte von der Apothekerin, schnarcht süß Tschornomordik selbst. Ein gieriger Floh hat sich bei ihm auf der Stirn zwischen den Augen festgesogen, aber er merkt es nicht und lächelt sogar, da er träumt, daß alle in der Stadt Husten haben und bei ihm immerfort seine Hustentropfen kaufen. Man kann ihn jetzt weder durch Stiche, noch mit Kanonen, noch mit Zärtlichkeiten wecken.
Die Apotheke liegt beinahe an der Grenze der Stadt, so daß die Apothekerin weit hinaus ins Feld blicken kann . . . Sie sieht, wie der östliche Rand des Himmels ganz allmählich erbleicht und wie er dann rot wird, wie von einer großen Feuersbrunst. Ganz unerwartet steigt hinter einem in der Ferne liegenden Gebüsch der große, breitgesichtige Mond langsam auf. Er ist rot, wie denn der Mond überhaupt, wenn er hinter einem Gebüsch hervorsteigt, aus irgend einem Grunde immer furchtbar verlegen ist.
Plötzlich ertönen in der nächtlichen Stille Schritte und Sporengeklirr. Man hört Stimmen.
›Das sind die Offiziere, die vom Polizeiinspektor nach Hause ins Biwak gehen‹, denkt die Apothekerin.
Etwas später zeigen sich zwei Gestalten in weißen Offizier-Sommerröcken; die eine groß und dick, die andere kleiner und dünner . . . Sie schreiten faul eine hinter der anderen längs des Zaunes einher und sprechen laut über irgend etwas. Als sie sich der Apotheke genähert haben, beginnen beide Gestalten immer langsamer zu gehen und sehen nach den Fenstern.
»Es riecht nach einer Apotheke . . .« sagt der Dünne. »Richtig, da ist sie ja auch! Aha, ich erinnere mich . . . In der vorigen Woche war ich hier und kaufte mir Rizinusöl. Hier wohnt ja der Apotheker mit dem sauren Gesicht und der Eselskinnlade. Das ist mal eine Kinnlade! Gerade mit so einer muß Simson die Philister verhauen haben.«
»M–ja . . .« spricht der Dicke im Baß. »Es schläft die Pharmacie! Und auch die Apothekerin schläft. Hier giebt es nämlich, Obtjossow, eine hübsche Apothekerin.«
»Ich habe sie gesehen. Sie gefiel mir sehr . . . Sagen Sie, Doktor, ist sie wirklich im stande, diese Eselskinnlade zu lieben? Unmöglich?«
»Nein, wahrscheinlich liebt sie ihn nicht«, seufzt der Doktor auf, mit einem Ausdruck, als thäte ihm der Apotheker leid. »Sie schläft jetzt hinterm Fenster, das Puppchen! Obtjossow, he? Liegt vor Hitze so hingegossen . . . das Mündchen ist halb geöffnet . . . das Füßchen hängt zum Bett heraus. Der Schafskopf von Apotheker wird von diesen Sachen kaum viel verstehen . . . Weib und Karbolflasche sind für ihn wohl ziemlich dasselbe!«
»Wissen Sie was, Doktor?« sagt der Offizier, indem er stehen bleibt. »Gehen wir mal in die Apotheke hinein und kaufen uns etwas. Vielleicht sehen wir die Apothekerin.«
»Nanu, in der Nacht!«
»Was ist denn dabei? Sie müssen ja auch in der Nacht öffnen. Mein Lieber, gehen wir!«
»Meinetwegen . . .«
Die Apothekerin, die sich hinterm Vorhang versteckt hat, hört die heisere Glocke. Sie sieht sich nach dem Manne um, der ruhig weiter schnarcht und süß lächelt, wirft sich in ein Kleid, zieht sich an die bloßen Füße Pantoffel und läuft in die Apotheke.
Durch die Glasthür hindurch sieht man zwei Schatten . . . Die Apothekerin schraubt die Lampe auf und eilt zur Thür, um zu öffnen. Sie fühlt jetzt keine Langeweile und keinen Ärger mehr und will nicht mehr weinen; nur ihr Herz pocht heftig. Der dicke Doktor und der dünne Obtjossow treten ein. Jetzt kann man sie schon besser sehen. Der dickbäuchige Arzt ist schwarz, bärtig und unbeholfen. Bei der geringsten Bewegung kracht sein Rock und Schweißtropfen treten ihm auf die Stirn. Der Offizier ist rosig, ohne Schnurrbart, etwas weiblich und biegsam wie eine englische Reitgerte.
»Was wünschen Sie?« fragt die Apothekerin, das Kleid über der Brust zusammenhaltend.
»Geben Sie . . . äh . . . äh . . . für fünfzehn Kopeken Pfefferminzplätzchen!«
Die Apothekerin holt ohne Eile vom Regal eine Büchse und beginnt zu wiegen. Die Käufer blicken ihr unverwandt auf den Rücken; der Arzt schließt halb die Augen, wie ein satter Kater, während der Leutnant sehr ernst ist.
»Zum ersten Mal sehe ich in einer Apotheke eine Dame«, sagt der Doktor.
»Dabei ist nichts besonderes . . .« antwortet die Apothekerin, nach dem rosigen Gesicht Obtjossows hinüberschielend. »Mein Mann hat keine Gehilfen, und ich helfe ihm immer.«
»So . . . Sie haben eine ganz nette Apotheke! Wieviel verschiedene . . . Büchsen es hier giebt! Und Sie fürchten sich nicht, so inmitten der Gifte zu leben? Brrrr!«
Die Apothekerin klebt das Packet zu und reicht es dem Doktor. Obtjossow giebt ihr ein Fünfzehnkopekenstück. Es vergeht eine halbe Minute schweigend . . . Die Käufer sehen sich an, machen einen Schritt zur Thür, sehen sich dann wieder an.
»Geben Sie mir, bitte, für zehn Kopeken Soda!« sagt der Doktor.
Die Apothekerin streckt die Hand wieder faul und lässig nach dem Regal aus.
»Hätten Sie nicht hier in der Apotheke so was . . .« murmelt Obtjossow, die Finger bewegend, »so etwas, wissen Sie, allegorisches, irgend ein erquickendes Naß . . . Selterwasser vielleicht? Haben Sie Selterwasser?«
»Jawohl«, antwortet die Apothekerin.
»Bravo! Sie sind kein Weib, sondern eine Fee. Schleifen Sie uns also etwa drei Flaschen heran!«
Die Apothekerin verpackt eilig die Soda und verschwindet im Dunkel der Thür.
»Ein Bissen!« sagt der Doktor augenblinzelnd. »So eine Ananas, Obtjossow, finden Sie selbst auf der Insel Madeira nicht. He? Was meinen Sie? Übrigens . . . hören Sie das Geschnarch? Das ist der Herr Apotheker in höchsteigener Person, der da schlummert.«
Nach einer Minute kehrt die Apothekerin zurück und stellt auf den Ladentisch fünf Flaschen. Sie war eben im Keller und ist daher rot und ein wenig erregt.
»Tss . . . leiser!« sagt Obtjossow, als sie beim Aufkorken der Flaschen den Korkenzieher fallen läßt. »Lärmen Sie nicht so, sonst wecken Sie Ihren Mann.«
»Nun, und was ist denn dabei, wenn ich ihn wecke?«
»Er schläft so süß . . . träumt von Ihnen . . . Auf Ihr Wohl!«
»Und außerdem«, meint mit seiner Baßstimme der Doktor, nach dem Selterwasser aufstoßend, »außerdem sind die Ehemänner ein so langweiliges Kapitel, daß sie gut thäten, immer zu schlafen. Na, zu diesem Wasserchen etwas Rotspon, das wäre was!«
»Was nicht noch!« lacht die Apothekerin.
»Das wäre prächtig! Schade, daß in den Apotheken keine Spirituosen verkauft werden! Übrigens . . . Sie müssen ja Wein als Medizin verkaufen. Haben Sie gallicum rubrum?«
»Jawohl.«
»Na, also! Geben Sie ihn mal her! Hol's der Teufel, nur her damit!«
»Wieviel wollen Sie?«
» Quantum satis! . . . Zuerst geben Sie uns ins Wasser je eine Unze, und dann wollen wir schon sehen . . . Obtjossow, he? Zuerst mit Wasser und dann nachher per se . . .«
Der Doktor und Obtjossow setzen sich an den Ladentisch, nehmen die Mützen ab und fangen an, Rotwein zu trinken.
»Der Wein ist aber, alles was recht ist, ein miserables Zeugs! Vinum schwachissimum, das muß man sagen! Übrigens, in der Gesellschaft . . . äh . . . schmeckt er wie Nektar. Sie sind entzückend, meine Gnädige! Ich küsse Ihnen in Gedanken die Hand.«
»Ich würde viel dafür geben, um das nicht nur in Gedanken thun zu können!« sagt Obtjossow. »Auf Ehre! Ich würde mein Leben dafür geben!«
»Das lassen Sie nur bleiben . . .« sagt Frau Tschornomordik errötend und macht ein ernstes Gesicht.
»Wie Sie übrigens kokett sind!« lacht leise der Doktor, sie schelmisch von unten herauf ansehend. »Die Äuglein schießen nur so! Piff! paff! Ich gratuliere: Sie haben gesiegt! Wir sind gefangen!«
Die Apothekerin blickt auf ihre frischen Gesichter, lauscht auf ihr munteres Geplauder und wird allmählich selbst lebhafter. O, ihr ist es jetzt schon so heiter zu Mut! Sie beteiligt sich am Gespräch, lacht, kokettiert und trinkt sogar, nach langem Bitten der Käufer, etwa zwei Unzen Rotwein.
»Die Herren Offiziere müßten doch häufiger aus dem Biwak in die Stadt kommen«, sagt sie, »sonst ist's hier so furchtbar langweilig. Ich sterbe fast . . .«
»Natürlich!« meint der Doktor empört. »So eine Ananas . . . ein Wunder der Natur, und in dieser Öde! Übrigens ist's für uns schon Zeit. Sehr angenehm gewesen, Ihre Bekanntschaft zu machen . . . sehr! Was haben wir zu zahlen?«
Die Apothekerin hebt die Augen zur Decke und bewegt lange die Lippen.
»Zwölf Rubel achtundvierzig Kopeken!« sagt sie.
Obtjossow holt seine dicke Brieftasche hervor, sucht lange in einem Päckchen Papiergeld und zahlt.
»Ihr Mann schläft süß und träumt . . .« murmelt er, der Apothekerin zum Abschied die Hand drückend.
»Ich liebe keine Dummheiten . . .«
»Wieso denn Dummheiten? Im Gegenteil . . . es sind gar keine Dummheiten . . . Sogar Shakespeare sagt: ›selig, wer jung in der Jugend!‹«
»Lassen Sie meine Hand los!«
Endlich, nach langen Gesprächen, küssen die Käufer der Apothekerin die Hand und verlassen unschlüssig, als überlegten sie, ob sie nicht irgend was vergessen hätten, die Apotheke.
Die junge Frau läuft schnell in das Schlafzimmer und setzt sich wieder ans Fenster. Sie sieht, wie der Doktor und der Leutnant etwa zwanzig Schritte vor der Apotheke stehen bleiben und über etwas zu flüstern anfangen. Worüber? Ihr Herz klopft, auch in den Schläfen klopft es. warum – weiß sie selbst nicht. Das Herz klopft so stark, als entschieden die Beiden, die dort flüstern, über ihr Schicksal.
Ungefähr nach fünf Minuten verläßt der Doktor Obtjossow und geht weiter, während Obtjossow zurückkommt. Er geht an der Apotheke vorbei, einmal. zweimal . . . Bald bleibt er an der Thür stehen, bald geht er wieder weiter . . . Endlich wird die Glocke behutsam gezogen.
»Was? Wer ist da?« hört die Apothekerin plötzlich die Stimme ihres Mannes. »Dort wird geklingelt, und Du hörst es nicht!« sagt streng der Apotheker. »Was ist das für eine Unordnung!«
Er steht auf, zieht sich den Schlafrock an und geht, mit den Pantoffeln schlurfend und im Halbschlaf schwankend in die Apotheke.
»Was . . . wünschen Sie?« fragt er Obtjossow.
»Geben Sie . . . geben Sie mir für fünfzehn Kopeken Pfefferminzplätzchen.«
Mit endlosem Schnaufen und Gähnen, unterwegs einschlafend und mit den Knieen an den Ladentisch stoßend, klettert der Apotheker zu dem Regal hinauf und holt die Büchse . . .
Zwei Minuten später sieht die Apothekerin, wie Obtjossow aus der Apotheke herauskommt und nachdem er einige Schritte gegangen, die Pfefferminzplätzchen auf die staubige Straße wirft. Hinter der Ecke hervor kommt ihm der Doktor entgegen . . . Sie treffen zusammen und verschwinden dann, mit den Händen gestikulierend, im Morgennebel.