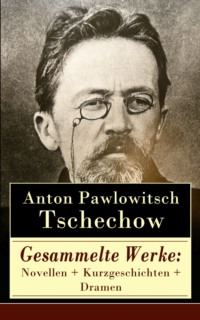Kitabı oku: «Gesammelte Werke: Novellen + Kurzgeschichten + Dramen», sayfa 7
XIV
Auch meine Schwester lebte ihr eigenes Leben, das sie sorgfältig vor mir verheimlichte. Oft tuschelte sie mit Mascha. Wenn ich auf sie zuging, schrumpfte sie gleichsam ein und blickte mich wie schuldbewußt und flehend an; offenbar ging in ihrer Seele etwas vor, das sie fürchtete oder dessen sie sich schämte. Um mir nicht im Garten zu begegnen oder sonstwie mit mir unter vier Augen zu bleiben, hielt sie sich immer in Maschas Nähe auf, und ich hatte nur selten, höchstens beim Mittagessen Gelegenheit, mit ihr zu sprechen.
Eines Abends kehrte ich vom Bau durch den Garten beim. Es dunkelte. Ohne mich zu bemerken und ohne meine Schritte zu hören, bewegte sich meine Schwester geräuschlos wie ein Gespenst vor einem alten, weitverzweigten Apfelbaume. Sie war ganz schwarz gekleidet und ging sehr schnell, zu Boden blickend, immer in der gleichen Linie auf und ab. Ein Apfel fiel vom Baum, sie fuhr zusammen, blieb stehen und drückte die Hände an die Schläfen. In diesem Augenblick ging ich auf sie zu.
In einer Anwandlung zärtlicher Liebe, die plötzlich mein Herz überströmte, nahm ich sie bei den Schultern und küßte sie mit Tränen in den Augen; ich mußte dabei an unsere Mutter und unsere Kindheit denken.
»Was hast du?« fragte ich sie. »Du leidest, ich sehe es längst. Sag', was ist mit dir?«
»Ich fürchte so …« sagte, sie zitternd.
»Was ist denn mit dir?« drang ich in sie ein. »Um Gottes willen, sei doch aufrichtig!«
»Ja, ich will, ich werde aufrichtig sein, ich werde dir die ganze Wahrheit sagen. Es ist mir so schwer, sie vor dir zu verheimlichen! Missail, ich liebe …« fuhr sie flüsternd fort. »Ich liebe, ich liebe … Ich bin glücklich, und doch fürchte ich mich so!«
Schritte wurden laut, und zwischen den Bäumen zeigte sich Doktor Blagowo in seidenem Hemd und hohen Stiefeln. Hier unter diesem Apfelbaum hatten sie offenbar ein Stelldichein. Als sie ihn erblickte, stürzte sie ihm entgegen und schrie gequält, als wollte ihn ihr jemand wegnehmen:
»Wladimir! Wladimir!«
Sie schmiegte sich an ihn und sah ihm lechzend ins Gesicht, und ich merkte erst jetzt, wie mager und bleich sie in der letzten Zeit geworden war. Besonders deutlich war das an ihrem Spitzenkragen zu sehen, den ich seit vielen Jahren kannte und der jetzt freier als je an ihrem feinen und langen Hals lag. Der Doktor wurde verlegen, besann sich aber bald und sagte, ihr die Haare streichelnd:
»Na, genug, genug … Warum so nervös? Du siehst ja, ich bin hergekommen.«
Wir schwiegen und sahen einander etwas geniert an. Dann gingen wir zu dritt weiter, und der Doktor sagte mir:
»Das Kulturleben hat bei uns noch nicht begonnen. Die Alten trösten sich damit, daß es jetzt zwar nichts gäbe, aber in den vierziger und sechziger Jahren etwas gegeben habe; das sind die Alten; unsere Gehirne sind aber noch nicht vom marasmus senilis berührt, und wir können uns mit solchen Illusionen nicht trösten. Der Anfang des Russischen Reiches fällt auf das Jahr 862, aber die russische Kultur hat überhaupt noch nicht angefangen.«
Ich hörte ihm kaum zu. Es kam mir so seltsam, beinahe unglaublich vor, daß meine Schwester verliebt war, daß sie diesen fremden Mann bei der Hand hielt und so zärtlich ansah. Meine Schwester, dieses nervöse, eingeschüchterte, verängstigte, unfreie Geschöpf liebt einen Mann, der verheiratet ist und auch Kinder hat! Etwas tat mir weh, ich weiß aber nicht, was. Die Anwesenheit des Doktors war mir nun unangenehm, und ich konnte unmöglich begreifen, was aus dieser Liebe werden sollte.
XV
Mascha und ich fuhren zur Einweihung der Schule nach Kurilowka.
»Herbst, Herbst, Herbst …« sagte Mascha leise, um sich blickend. »Der Sommer ist vorüber. Die Vögel sind fort, und nur noch die Weiden allein sind grün.«
Ja, der Sommer ist vorüber. Die Tage sind noch heiter und warm, aber des Morgens ist es recht frisch, die Hirten gehen in Schafpelzen auf die Weide, und auf den Astern in unserem Garten trocknet der Tau im Laufe des ganzen Tages nicht aus. Es sind immer so traurige Töne zu hören, und man kann nicht recht erkennen, ob es das Knarren eines Fensterladens m den rostigen Angeln ist, oder das Geschrei der Kranichzüge … Dabei ist es aber einem so wohl ums Herz, und man spürt solche Luft zu leben!
»Der Sommer ist vorüber …« sagte Mascha. »Nun können wir das Fazit ziehen. Wir haben viel gearbeitet, haben viel gedacht, wir sind besser geworden, wir haben in der persönlichen Vervollkommnung Erfolge gemacht, – das muß alles anerkannt werden. Haben aber unsere Erfolge auch irgendeinen Einfluß auf das uns umgebende Leben gehabt, haben sie jemandem genützt? Nein! Die Roheit und die Unbildung, der Schmutz, die Trunksucht, die entsetzlich hohe Kindersterblichkeit – alles ist beim alten geblieben, und davon, daß du geackert und gesät hast und ich Geld ausgegeben und Bücher gelesen habe, wurde niemand besser. Offenbar haben wir nur für uns selbst gearbeitet und nur für uns selbst gedacht.«
Diese Betrachtungen machten mich wirr, und ich wußte nicht, was ich denken sollte.
»Wir waren vom Anfang bis zum Ende aufrichtig,« sagte ich, »und wer aufrichtig ist, der hat auch recht.«
»Wer bestreitet es? Wir waren wohl im Recht, wir haben aber das, worin wir recht hatten, falsch verwirklicht. Vor allen Dingen, waren denn nicht schon unsere äußeren Methoden durch und durch fehlerhaft? Du willst den Menschen nützlich sein, wenn du aber ein Gut kaufst, schneidest du dir von vornherein jede Möglichkeit ab, ihnen irgendwie zu nützen. Ferner: wenn du wie ein Bauer arbeitest, dich kleidest und ißt, so legitimierst du durch deine Autorität diese schwere, plumpe Kleidung, diese schrecklichen Häuser, diese dummen Bärte … Nehmen wir sogar an, daß du lange, sehr lange, dein ganzes Leben lang arbeitest und schließlich auch einige praktische Resultate erzielst; was bedeuten aber deine Resultate gegen solche Elementarkräfte, wie Roheit, Hunger, Kälte und Entartung? Einen Tropfen im Meere! Hier sind andere, kühnere, raschwirkende, kräftige Kampfmittel vonnöten! Wenn du tatsächlich Nutzen bringen willst, so mußt du den engen Kreis der normalen Tätigkeit aufgeben und dich bemühen, auf die ganze Masse einzuwirken! Vor allen Dingen ist eine laute, energische Predigt notwendig. Warum ist die Kunst, z. B. die Musik so lebenskräftig, so populär und so mächtig? Weil der Musiker oder Sänger gleich auf Tausende von Menschen einwirkt. Die liebe, liebe Kunst!« fuhr sie mit einem träumerischen Blick gen Himmel fort. »Die Kunst gibt uns Flügel und entführt uns weit, weit von hier! Wer des Schmutzes und der kleinlichen Pfenniginteressen überdrüssig geworden ist, wer empört und beleidigt ist, der kann nur im Schönen Ruhe und Befriedigung finden.«
Als wir uns Kurilowka näherten, war das Wetter heiter und freundlich. In einigen Höfen wurde gedroschen, und es roch nach Roggenstroh. Hinter den Zäunen leuchteten hellrote Ebereschen, und alle Bäume, so weit der Blick reichte, waren golden oder rot. Vom Turme tönten die Glocken, man trug die Heiligenbilder in die Schule, und der Chor sang »Heilige Fürbitterin«.« Die Luft war durchsichtig, und die Tauben flogen so hoch!
Der Gottesdienst wurde im Klassenzimmer abgehalten. Dann überreichten die Bauern von Kurilowka Mascha ein Heiligenbild, und die von Dubetschnja – eine große Brezel und ein vergoldetes Salzfaß. Und Mascha weinte.
»Und wenn wir vielleicht ein Wort zu viel gesagt haben, oder es sonst irgendwelche Unannehmlichkeit gab, so verzeihen Sie uns!« sagte ein Greis und verneigte sich vor ihr und vor mir.
Als wir nach Hause fuhren, sah sich Mascha nach der Schule um; das grüne Dach, das ich gestrichen hatte, glänzte in der Sonne und blieb lange sichtbar. Und ich fühlte, daß die Blicke, die Mascha um sich warf, Abschiedsblicke waren.
XVI
Abends fuhr sie in die Stadt.
In der letzten Zeit pflegte sie oft in die Stadt zu fahren und dort zu übernachten. Wenn sie fort war, konnte ich nicht arbeiten; meine Hände wurden auf einmal schwach, unser großer Hof erschien mir als eine langweilige Wüste, der Garten rauschte unfreundlich, und ohne sie waren das Haus, die Bäume und die Pferde für mich nicht mehr »unser«.
Ich ging nicht aus dem Hause, sondern saß immer an ihrem Tisch, neben ihrem Schrank mit den landwirtschaftlichen Büchern, ihren gewesenen Lieblingen, die sie jetzt nicht mehr brauchte und die mich daher so verlegen ansahen. Stundenlang, bis es sieben, acht, neun schlug, bis die schwarze Herbstnacht zum Fenster hereinblickte, besah ich mir irgendeinen alten Handschuh von ihr, oder den Federhalter, mit dem sie immer schrieb, oder ihre kleine Schere; ich tat nichts und war mir dessen vollkommen bewußt, daß ich früher nur darum geackert, gemäht und Holz gehackt hatte, weil sie es so wollte. Und wenn sie mich schickte, einen tiefen Brunnen zu reinigen, wo ich bis an den Gürtel im Wasser stehen mußte, so stiege ich gewiß in den Brunnen hinab, ohne mir zu überlegen, ob das nötig wäre oder nicht. Aber jetzt, wo sie nicht mehr in meiner Nähe war, erschien mir Dubetschnia mit der ganzen Unordnung, mit den ewig klappernden Fensterläden, mit den Tag- und Nachtdieben als ein Chaos, in dem jede Arbeit zwecklos wäre. Was soll ich hier auch arbeiten, was soll ich für die Zukunft sorgen, wenn ich fühle, daß mir der Boden entgleitet, daß meine Rolle hier in Dubetschnja zu Ende ist, mit einem Worte, daß mich das gleiche Schicksal erwartet, das die landwirtschaftlichen Werke ereilt hat? Wie furchtbar waren diese einsamen Stunden in der Nacht, als ich jeden Augenblick erschrocken horchte, ob mir nicht jemand zuriefe, daß ich schon gehen solle. Es tat mir um Dubetschnja leid, nur meine Liebe tat mir leid, für die offenbar auch schon der Herbst gekommen war. Was für ein großes Glück ist es, zu lieben und geliebt zu werden, und wie schrecklich ist es, zu fühlen, daß man von diesem hohen Turm herabstürzt!
Mascha kehrte aus der Stadt am anderen Abend zurück. Sie war über etwas unzufrieden, verheimlichte es aber und fragte nur, warum ich alle Winterfenster eingesetzt hätte; so könne man ja ersticken! Ich nahm zwei Fenster wieder heraus. Wir hatten gar keinen Hunger, setzten uns aber doch hin und aßen Abendbrot.
»Geh, wasch dir die Hände,« sagte meine Frau zu mir. »Du riechst nach Kitt.«
Sie hatte neue illustrierte Zeitschriften aus der Stadt mitgebracht, und nach dem Abendessen sahen wir sie uns zusammen an. Es waren auch Beilagen mit Modebildern und Kleiderschnitten dabei. Mascha sah sie sich nur flüchtig an, legte sie aber beiseite, um sie nachher genauer anzusehen; aber ein Kleid mit einem weiten, glatten Glockenrock und Bauschärmeln interessierte sie, und sie betrachtete es eine Minute ernst und aufmerksam.
»Das ist nicht übel,« sagte sie.
»Ja, das Kleid wird dir gut stehen,« sagte ich: »sogar sehr gut!«
Ich sah gerührt auf dieses Kleid, ich bewunderte das Bild nur, weil es ihr gefiel, und fuhr zärtlich fort:
»Ein herrliches, wunderbares Kleid! Meine herrliche, wunderbare Mascha! Meine teure Mascha!«
Tränen fielen auf das Bild.
»Meine herrliche Mascha …« stammelte ich: »Meine liebe, teure Mascha …«
Sie ging schlafen, ich aber saß noch eine Stunde da und besah die Illustrationen.
»Es ist schade, daß du die Fenster wieder herausgenommen hast,« sagte sie aus dem Schlafzimmer. »Ich fürchte, daß es doch kalt werden wird. Wie der Wind heult!«
Ich las unter »Vermischtes« von der Herstellung billiger Tinte und vom größten Diamanten der Welt. Dann kam mir wieder das Modebild mit dem Kleide in die Hand, das ihr so gut gefallen hatte, und ich stellte sie mir auf einem Ball vor, mit einem Fächer in der Hand, mit entblößten Schultern, strahlend schön, mit großem Verständnis für Musik, Kunst und Literatur, und meine eigene Rolle kam mir so kläglich und kurz vor!
Unsere Begegnung und unsere Ehe waren nur eine Episode, wie sie diese lebhafte, reich begabte Frau noch viele in ihrem Leben haben wird. Alles Beste in der Welt stand zu ihrer Verfügung und fiel ihr ganz umsonst zu, selbst die Ideen und die moderne geistige Bewegung bedeuteten ihr nur einen Genuß, eine Abwechslung in ihrem Leben; ich aber war nur der Kutscher, der sie von einem Erlebnis zum anderen gefahren hatte. Jetzt braucht sie mich nicht mehr, sie fliegt aus, und ich bleibe allein.
Wie als Antwort auf meine Gedanken erklang im Hofe der verzweifelte Schrei:
»Zu Hilfe!«
Es war eine dünne Weiberstimme, und der Wind pfiff ebenso dunn im Kamin, als wollte er sie nachahmen. Nach einer halben Minute erklang es wieder durch das Heulen des Windes, aber scheinbar vom anderen Ende des Hofes:
»Zu Hilfe!«
»Missail, hörst du es?« fragte leise meine Frau. »Hörst du es?«
Sie kam aus dem Schlafzimmer im bloßen Hemd mit offenen Haaren und lauschte, auf das dunkle Fenster blickend.
»Da wird jemand erwürgt!« sage sie. »Das fehlte noch gerade.«
Ich nahm mein Gewehr und ging hinaus. Draußen war es stockfinster, und der Wind wehte so stark, daß ich kaum stehen konnte. Ich ging einmal zum Tor und horchte: die Bäume rauschten, der Wind pfiff, und im Garten heulte träge der Hund des blöden Wächters. Hinter dem Tore war eine höllische Finsternis, und am Bahndamm brannte kein einziges Licht. Plötzlich ertönte neben dem Flügel, in dem im vorigen Jahre die Baukanzlei gewesen war, ein halberstickter Schrei:
»Zu Hilfe!«
»Wer ist da?« fragte ich.
Zwei Männer rangen miteinander. Der eine wollte den anderen hinausdrängen, der andere wehrte sich, und beide atmeten schwer.
»Laß los!« sagte der eine, und ich erkannte die Stimme Tscheprakows; er war es, der mit der dünnen Weiberstimme geschrien hatte. »Laß los, Verfluchter, sonst beiße ich dir die Hände blutig!«
Im anderen erkannte ich Moïssej. Ich brachte sie auseinander und schlug dabei Moïssej zweimal ins Gesicht. Er fiel hin, stand wieder auf, und ich schlug ihn noch einmal.
»Er wollte mich umbringen,« stammelte er. »Er hatte sich an die Kommode der Frau Mama herangemacht … Ich möchte ihn im Flügel einsperren, der Vorsicht halber.«
Tscheprakow war aber betrunken, er erkannte mich nicht und holte immer tief Atem, als wollte er möglichst viel Luft einatmen, um von neuem um Hilfe zu schreien.
Ich ließ sie stehen und kehrte ins Haus zurück. Meine Frau lag schon angekleidet auf dem Bett. Ich erzählte ihr, was sich auf dem Hofe abgespielt, und gestand auch, daß ich Moïssej geschlagen hatte.
»Es ist so schrecklich, auf dem Lande zu wohnen,« sagte sie. »Und so furchtbar lang ist diese Nacht …«
»Zu Hilfe!« ertönte es nach einer Weile wieder.
»Ich gehe hin und schaffe Ruhe,« sagte ich.
»Nein, sollen sie nur einander die Kehlen durchbeißen,« sagte sie mit Ekel.
Sie blickte auf die Decke und horchte hinaus, und ich saß an ihrer Seite, wagte nicht mit ihr zu sprechen und hatte das Gefühl, als ob es meine Schuld wäre, daß man draußen um Hilfe schrie und daß die Nacht so lang war.
Wir schwiegen, und ich wartete mit Ungeduld auf das erste Morgenlicht. Mascha blickte aber die ganze Zeit so, wie wenn sie aus einer Ohnmacht erwacht wäre und nun staunte, wie sie, das kluge, wohlerzogene, reinliche Wesen in diese elende Provinzeinöde, in diese Gesellschaft unbedeutender, kleinlicher Menschen geraten sei und wie sie sich dermaßen habe vergessen können, um einen dieser Menschen zu lieben und länger als ein halbes Jahr seine Frau zu sein. Mir schien schien es, daß sie keine Unterschiede mehr zwischen mir, Moïssej und Tscheprakow machte; alles vermischte sich für sie in diesem trunkenen, wilden Hilfeschrei – ich, und unsere Ehe, und unsere Wirtschaft, und der Herbstschmutz; und wenn sie seufzte oder sich im Bette wälzte, las ich in ihrem Gesicht: »Ach, wenn doch der Morgen endlich käme!«
Am Morgen fuhr sie ab.
Ich blieb in Dubetschnja noch drei Tage und wartete, ob sie nicht doch noch zurückkommen würde. Dann legte ich alle unsere Sachen in einem der Zimmer zusammen, sperrte es ab und ging in die Stadt. Als ich am Hause des Ingenieurs klingelte, war schon Abend, und in unserer Großen Adelsstraße brannten die Laternen. Pawel sagte mir, daß niemand zu Hause sei: Viktor Iwanowitsch sei nach Petersburg verreist und Maria Viktorowna auf einer Probe bei den Aschogins. Ich erinnere mich noch, mit welcher Aufregung ich zu den Aschogins ging, wie mein Herzschlag stockte, als ich die Treppe hinaufging und lange oben auf dem Treppenabsatz stand, ehe ich es wagte, in diesen Musentempel einzutreten! Im Saale brannten auf dem Tische, auf dem Klavier und auf der Bühne je drei Kerzen, überall drei; die erste Vorstellung war für den Dreizehnten angesetzt, und die erste Probe fand an einem Montag, einem gefürchteten Unglückstag statt. Das war der Kampf gegen die Vorurteile! Alle Liebhaber der Bühnenkunst waren schon versammelt. Die Aelteste, die Mittlere und die Jüngste gingen auf der Bühne auf und ab und lasen ihre Rollen. Abseits von allen stand Rettich, mit der Schläfe gegen die Wand gelehnt, und blickte, in Erwartung der Probe, andächtig auf die Bühne. Alles war genau so wie einst!
Ich ging auf die Dame des Hauses zu, – ich mußte sie doch begrüßen, – aber alle begannen plötzlich zu zischen und mit den Füßen zu stampfen, daß ich leiser auftrete. Es wurde still. Man hob den Deckel des Klaviers, eine Dame setzte sich vor das Instrument und richtete ihre kurzsichtigen Augen auf die Noten, und nun erschien meine Mascha. Sie war schön und elegant, aber von einer eigenen, ganz neuen Schönheit und glich gar nicht jener Mascha, die mich im Frühjahr auf der Mühle besuchte. Sie sang das Lied:
»Warum lieb ich dich so, du strahlende Nacht?«
Seitdem ich sie kannte, hörte ich sie heute zum erstenmal singen. Sie hatte eine schöne, kräftige, volle Stimme, und solange sie sang, hatte ich das Gefühl, als ob ich eine reife, süße, duftende Melone verzehrte. Nun war sie zu Ende, man applaudierte ihr und sie lächelte sehr zufrieden, blätterte in den Noten und nestelte an ihrem Kleid wie ein Vogel, der sich endlich aus der Gefangenschaft befreit hat und in Freiheit sein Gefieder in Ordnung bringt. Ihre Haare waren hinter die Ohren gekämmt, und ihr Gesicht hatte einen unangenehmen Ausdruck, wie wenn sie alle herausforderte oder uns wie die Pferde anschreien wollte: »He, ihr lieben!«
In diesem Augenblick sah sie wohl ihrem Großvater, dem Kutscher sehr ähnlich.
»Auch du bist hier?« fragte sie, mir die Hand reichend. »Hast du gehört, wie ich sang? Wie findest du es?« Ohne meine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort: »Es ist sehr gut, daß du hergekommen bist. Heute nacht reise ich für kurze Zeit nach Petersburg. Willst du es mir erlauben?«
Um Mitternacht begleitete ich sie zum Bahnhof. Sie umarmte mich zärtlich, wohl aus Dank dafür, weil ich keine überflüssigen Fragen stellte, und versprach mir zu schreiben. Ich aber drückte und küßte lange ihre Hände, sagte kein Wort und hielt mit Mühe meine Tränen zurück.
Und als sie fort war, blickte ich lange den Lichtern des Zuges nach, liebkoste sie in Gedanken und wiederholte leise vor mich hin:
»Meine liebe Mascha, meine herrliche Mascha …«
Ich übernachtete in der Vorstadt Makaricha bei der Karpowna, und überzog schon am nächsten Morgen mit Rettich die Möbel bei einem reichen Kaufmann, der seine Tochter mit einem Doktor verheiratete.
XVII
Am Sonntag Nachmittag kam meine Schwester zu mir und trank mit mir Tee.
»Jetzt lese ich sehr viel,« sagte sie, auf die Bücher zeigend, die sie sich auf dem Wege zu mir aus der Stadibibliothek geholt hatte. »Ich bin deiner Frau und Wladimir dankbar, sie haben in mir die Selbsterkenntnis geweckt. Sie haben mich gerettet und es erreicht, daß ich mich als Mensch fühle. Früher konnte ich nachts keinen Schlaf finden, weil mein Kopf voller Sorgen war: ›Ach, wir haben in dieser Woche so viel Zucker verbraucht! Ach, daß die Gurken nur nicht zu salzig werden!‹ Auch jetzt schlafe ich schlecht, aber es sind schon ganz andere Gedanken. Ich ärgere mich, daß ich die Hälfte meines Lebens so dumm, so kleinmütig vertrödelt habe. Ich verachte meine Vergangenheit, ich schäme mich ihrer, den Vater sehe ich aber als meinen Feind an. Oh, wie dankbar bin ich doch deiner Frau! Und Wladimir, was ist das für ein prächtiger Mensch! Sie haben mir die Augen geöffnet.«
»Es ist nicht gut, daß du nachts nicht schläfst,« sagte ich.
»Du glaubst wohl, ich bin krank? Keine Spur! Wladimir hat mich untersucht und gefunden, daß ich vollkommen gesund hin. Es handelt sich aber nicht um die Gesundheit, die ist nicht so wichtig … Sage mir nur: bin ich im Recht?«
Sie, brauchte moralische Unterstützung, – das war mir klar. Mascha war verreist, Doktor Blagowo befand sich in Petersburg, und sie hatte in der ganzen Stadt niemand außer mir, der ihr sagen könnte, daß sie im Recht sei. Sie blickte mir gespannt ins Gesicht, als wollte sie meine geheimen Gedanken lesen, und wenn ich in ihrer Gegenwart nachdenklich war und schwieg, bezog sie es auf sich und wurde traurig. Ich mußte immer auf der Hut sein, und wenn sie mich fragte, ob sie recht hätte, beeilte ich mich, ihr zu sagen, daß sie im Rechte sei und daß ich sie aufrichtig achte.
»Weißt du, man hat mir bei den Aschogins eine Rolle gegeben,« fuhr sie fort. »Ich will auf der Bühne spielen. Ich will leben, mit einem Wort, ich will auch einmal aus vollem Kelche trinken. Ich habe gar kein Talent, und die Rolle besteht nur aus zehn Worten, und doch ist es unermeßlich erhabener und edler, als fünfmal am Tage Tee einzuschenken und aufzupassen, ob die Köchin nicht ein Stück zu viel gegessen hat. Vor allen Dingen soll aber der Vater endlich sehen, daß auch ich zu einem Protest fähig bin.«
Nach dem Tee legte sie sich auf mein Bett und lag eine Zeitlang mit geschlossenen Augen. Sie war sehr blaß.
»Diese Schwäche!« sagte sie, als sie nach einer Weile wieder aufstand. »Wladimir behauptet, daß alle Frauen und Mädchen in der Stadt vor lauter Müßiggang blutarm sind. Wie klug ist doch Wladimir! Er hat recht, er hat tausendmal recht. Man muß arbeiten!«
Nach zwei Tagen kam sie mit ihrer Rolle zu den Aschogins zur Probe. Sie trug ein schwarzes Kleid, eine Korallenkette um den Hals, eine Brosche, die aus der Ferne wie ein Blätterteigkuchen aussah, und große Ohrringe mit je einem Brillanten. Als ich sie ansah, mußte ich mich genieren, ihre Geschmacklosigkeit machte mich bestürzt. Die Brillantohrringe waren so unpassend; auch die anderen bemerkten, wie sonderbar sie gekleidet war; ich sah die Leute lächeln und hörte sogar jemand sagen:
»Die ägyptische Kleopatra!«
Sie bemühte sich, ungezwungen, ruhig und mondän zu erscheinen und erschien darum manieriert und sehr sonderbar. Ihre frühere Einfachheit und Anmut hatten sie verlassen.
»Als ich eben dem Vater erklärte, daß ich zur Probe gehe,« sagte sie, auf mich zugehend, »schrie er mich an und erklärte, daß er mir seinen Segen entziehe; beinahe hätte er mich geschlagen. Denke dir nur, ich kann meine Rolle nicht,« sagte sie, in ihr Heft blickend. »Ich werde mich ganz bestimmt blamieren. Die Würfel sind gefallen,« fuhr sie in höchster Erregung fort. »Die Würfel sind gefallen....«
Sie glaubte, daß alle auf sie sehen und über den bedeutungsvollen Schritt, zu dem sie sich entschlossen hatte, staunen; sie glaubte, daß alle von ihr etwas Ungewöhnliches erwarteten, und es war mir ganz unmöglich, sie davon zu überzeugen, daß niemand sich um solche kleine und uninteressante Menschen, wie wir beide, kümmerte.
Bis zum dritten Akt hatte sie nichts zu tun, und ihre Rolle einer Provinztante bestand nur darin, daß sie vor der Tür horchen und dann einen kurzen Monolog zu sprechen hatte. Bis die Reihe an sie kam, also mindestens anderthalb Stunden, während die andern Darsteller auf der Bühne herumgingen, lasen, Tee tranken und stritten, wich sie nicht von meiner Seite, murmelte in einem fort ihre Rolle und zerknüllte nervös ihr Heft. In der Meinung, daß alle sie ansähen und auf ihr Auftreten warteten, nestelte sie mit zitternder Hand an ihren Haaren und sagte zu mir:
»Ich werde mich ganz bestimmt blamieren … Wenn du nur wüßtest, wie schwer es mir ums Herz ist. Ich habe solche Angst, als ob man mich gleich zum Schafott führen würde.«
Endlich kam sie an die Reihe.
»Kleopatra Alexejewna, jetzt!« sagte der Regisseur.
Unschön und linkisch trat sie auf die Mitte der Bühne mit dem Ausdruck von Entsetzen im Gesicht und stand eine halbe Minute unbeweglich wie im Starrkrampfe da; nur die beiden großen Ohrringe bewegten sich.
»Das erstemal können Sie die Rolle auch ablesen.« sagte jemand.
Es war mir klar, daß sie vor Angst weder sprechen, noch das Heft aufmachen konnte; ich sah, daß sie am wenigsten an ihre Rolle dachte. Ich wollte schon auf sie zugehen und ihr etwas sagen, als sie plötzlich mitten auf der Bühne niederkniete und laut schluchzte.
Alles kam in Bewegung, alle lärmten, nur ich allein stand an die Kulisse gelehnt, von dem Vorgefallenen erdrückt, und wußte nicht, was anzufangen. Ich sah, wie man ihr aufstehen half und sie fortführte. Ich sah, wie Anjuta Blagowo auf mich zuging; ich hatte sie vorher im Saale nicht gesehen, und sie schien wie aus der Erde gewachsen. Sie hatte ihren Hut auf und den Schleier vor dem Gesicht und sah wie immer so aus, als ob sie nur auf dem Sprunge hier wäre.
»Ich hab' ihr doch gesagt, daß sie nicht spielen darf,« sagte sie rot vor Empörung, jedes Wort kurz hervorstoßend. »Das ist Wahnsinn! Sie hätten sie davon abhalten müssen!«
Nun näherte sich mir die magere und flache Frau Aschogin-Mutter in ihre kurzen Bluse mit kurzen Aermeln und Zigarettenasche auf der Brust.
»Mein Freund, es ist ja entsetzlich,« sagte sie, die Hände ringend und nur wie immer scharf ins Gesicht blickend. »Das ist ja entsetzlich! Ihre Schwester ist in Umständen … sie ist schwanger! Führen Sie sie doch fort, ich bitte Sie darum …«
Sie war furchtbar erregt und atmete schwer. Etwas abseits standen ihre drei Töchter, ebenso mager und flach wie sie, und drängten sich ängstlich aneinander. Sie waren so erschrocken und bestürzt, als ob man in ihrem Hause einen, Zuchthäusler erwischt hätte. Wie schrecklich, diese Schande! Und doch hatte diese ehrenwerte Familie ihr Leben lang gegen die Vorurteile gekämpft; offenbar hatten sie geglaubt, das alle Vorurteile und Verirrungen der Menschheit nur in der Furcht vor den drei Kerzen, vor der Zahl Dreizehn und vor dem Montag bestünden.
»Ich bitte Sie darum …« wiederholte Frau Aschogin mit gespitztem Mund. »Ich bitte Sie, bringen Sie sie doch nach Hause.«