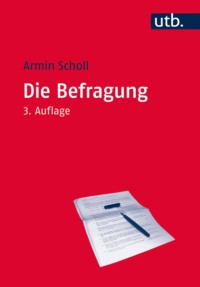Kitabı oku: «Die Befragung», sayfa 4
| 2.1.3 | Vorteile des persönlichen Interviews |
Alle Formen von Stichprobendesigns sind bei der persönlichen Befragung – beim Passanteninterview und bei der Klassenzimmer-Befragung allerdings nur eingeschränkt – möglich. Wenn Adresslisten oder Telefonnummern nicht verfügbar sind, kann auf eine räumliche Gebietsstichprobe mit einer eigenen Adressermittlung (etwa beim Random Route bzw. Random Walk) zurückgegriffen werden, wie dies beim ADM-Mastersample der Fall ist.
Der persönliche Kontakt mit dem Interviewer kann in mehreren Hinsichten die Qualität der Befragungsergebnisse erhöhen:
Bei unmotivierten oder unwilligen Befragten kann der Interviewer zur Teilnahme an der Befragung motivieren. Bei längeren Befragungen ist die Abbruchwahrscheinlichkeit geringer, wenn ein Interviewer sie persönlich durchführt. [38]Durch den Aufbau einer »persönlichen Beziehung« kann ein Vertrauensverhältnis entstehen, das zu einer höheren Akzeptanz der Befragung und des Fragebogens beim Befragten führt. Insgesamt ist die Ausschöpfungsquote der Stichprobe wegen des größeren Verbindlichkeitsgrades höher als bei den anderen Befragungsformen. Dies gilt für die Klassenzimmer-Befragung besonders, allerdings nur sehr eingeschränkt für das Passanteninterview.
Bei unverständlichen Fragen oder Antwortvorgaben kann der Interviewer Hilfestellung für die Beantwortung geben.
Bei ungenauen oder nicht passenden Antworten des Befragten kann der Interviewer in geeigneter Weise nachhaken, um die Antwort an die Frage bzw. die Antwortvorgaben anzupassen oder um sie zu vervollständigen.
Bei komplexen Instruktionen oder Sequenzen (zum Beispiel Filterführung) kann der Interviewer für die akkurate Befolgung durch den Befragten sorgen. Der Befragte wird dadurch von strukturellen Aufgaben, die für ihn zutreffende Frage im Fragebogen zu suchen, entlastet.
Für die Präsentation zahlreicher visuellen und optischen Unterstützungen sind Interviewer erforderlich. Bei langen Listen, die als Kartenspiele vorgelegt werden, kann der Interviewer die Reihenfolge systematisch rotieren oder zufällig auswählen (vgl. Noelle-Neumann / Petersen 2000).
Bei Mehrmethoden-Designs mit Selbstausfüller-Modulen, mit eingebauten Beobachtungsteilen (der Interviewer beobachtet die Wohnungseinrichtung oder das Verhalten des Befragten bei der Beantwortung der Fragen) oder mit experimentellen Anlagen ist die Anwesenheit des Interviewers erforderlich.
Bei qualitativen Interviews ist ein kompetenter Interviewer immer erforderlich und ein persönlich anwesender Interviewer gegenüber einem Telefoninterviewer zusätzlich im Vorteil, um vom Befragten komplexere und tiefere Informationen zu bekommen (vgl. Fowler 1988: 70ff.).
| 2.1.4 | Nachteile des persönlichen Interviews |
Aufwand und Kosten des persönlichen Interviews sind größer als in anderen Befragungsformen. Nur professionelle Institute können einen Interviewerstab organisieren, der für bundesweite Repräsentativstichproben geografisch flächendeckend eingesetzt werden kann. Rekrutierung, Einsatz, Kontrolle und Bezahlung der Interviewer sind sehr kostenintensiv. Für Passanteninterviews und Klassenzimmer-Befragungen entfällt dieser Nachteil weitgehend.
Die Feldphase dauert meist länger als bei anderen Befragungsformen, da die Interviewer die Befragten selbst aufsuchen müssen. Gerade bei mobilen Zielpersonen [39]kann dies zu einem höheren Aufwand führen. Passanteninterviews und Klassenzimmer-Befragungen haben dagegen eine kürzere Feldphase.
Einige Teilpopulationen sind mit anderen Befragungsarten besser erreichbar: Dazu gehören Bewohner oberer Stockwerke in Hochhäusern, Befragte, die in Gebieten mit hoher Kriminalitätsrate wohnen, Eliten, mobile Personen, nicht sesshafte bzw. obdachlose Personen.
Der Interviewer hebt nicht nur die Qualität von Interviews, sondern stellt in einigen Hinsichten auch ein Risiko für deren Qualität dar:
Aufgrund der persönlichen Situation im Interview können sich Befragte eingeschüchtert fühlen und deshalb ausweichend oder unehrlich antworten. Andere Formen der Befragung sind anonymer und ermöglichen den Befragten eine freiere Meinungsäußerung. Dies ist insbesondere bei heiklen Themen (abweichendes Verhalten, Sexualität usw.) problematisch, wenn der Befragte dazu neigt, dem Interviewer gegenüber eine als sozial erwünscht eingeschätzte Antwort zu geben, um einen guten Eindruck bei ihm zu hinterlassen.
Interviewer können die Fragen und Antwortvorgaben fehlerhaft vorlesen, Fehler bei der Filterführung begehen, die Angaben der Befragten falsch verstehen oder die geäußerten Antworten den Antwortvorgaben falsch zuordnen.
Interviewer können sich absichtlich falsch verhalten, um den Aufwand und die Kosten zu senken. Darunter fallen nicht regelgerechte Adressermittlungen gemäß der Begehungsvorschriften beim Random-Route-Verfahren bzw. Random-Walk-Verfahren, Unterschlagung einzelner Fragen bzw. Fälschung einzelner Antworten bis hin zur Fälschung gesamter Interviews. Bei Klassenzimmer-Befragung treffen diese Befürchtungen kaum zu, da ihr Aufwand erheblich geringer ist. Dagegen besteht bei Passanteninterviews durchaus die Gefahr der subjektiven Stichprobenziehung, weshalb diese nicht von den Interviewern selbst durchgeführt werden sollte (vgl. Fowler 1988: 70ff.).
| 2.2 | Das telefonische Interview |
| 2.2.1 | Beschreibung und Varianten |
Das telefonische Interview ist als fernmündliche Befragung weniger persönlich als das direkte face-to-face Interview, aber es basiert ebenfalls auf einer Beziehung zwischen einem Interviewer und einem Befragten.
[40]Voraussetzung ist, dass die Zielpersonen einen Telefonanschluss haben bzw. telefonisch erreichbar sind. Dies ist vor allem in Industrieländern westlicher Prägung der Fall. In den USA ist der Einsatz von Telefoninterviews schon seit längerer Zeit sehr populär, und er ist mit einer gewissen Verzögerung auch in Deutschland gestiegen. Durch die Wiedervereinigung erlitt diese Befragungsform zunächst einen Rückschlag, weil in der DDR die Telefondichte relativ gering und die technische Qualität der Telefonanschlüsse schlecht war. Diese Probleme waren jedoch nur vorübergehend, sodass Telefoninterviews mittlerweile sehr häufig verwendet werden. Sie bieten eine Reihe von Vorteilen, die sie besonders für die angewandte Meinungsforschung attraktiv machen.
| 2.2.2 | Stichprobe |
Die Stichprobenziehung für eine Telefonbefragung ist ebenso anspruchsvoll wie die für eine persönliche Befragung. Es sind aber andere Anforderungen und Probleme zu beachten. Folgende Varianten werden für die Ziehung einer repräsentativen Stichprobe verwendet19:
Zufallsauswahl aus dem Telefonbuch oder von der CD: Das Telefonbuchverfahren ist zwar mittlerweile veraltet, wird aber gelegentlich noch angewendet, zumal wenn nicht die bundesweite Bevölkerung die Grundgesamtheit bildet. Die Stichprobenziehung erfolgt mehrstufig: Zuerst wird das Telefonbuch, dann die Seite, die Spalte und zuletzt der Zielhaushalt ausgewählt. Wird die Stichprobe über CD gezogen, kann sie einstufig erfolgen und der Zielhaushalt direkt ausgewählt werden. Das Verfahren hat den Vorteil, dass alle Nummern tatsächlich existieren. Außerdem fällt im Vergleich zum ADM-Stichproben-System der persönlichen Befragung die erste Stufe weg, also die Auswahl der geografischen Einheiten, der Sample Points. Von Nachteil ist, dass viele Haushalte nicht eingetragen sind, was zu systematischen Verzerrungen führt: Im Telefonbuch oder auf der CD nicht eingetragene Personen haben entweder kein Telefon, wohnen in Gemeinschaftsunterkünften oder haben Geheimnummern. Seit einigen Jahren nimmt ferner die Zahl der Personen mit mehreren Festnetzanschlüssen (etwa über ISDN) zu, die bei Zufallsauswahlen überrepräsentiert werden, wohingegen Personen, die nur noch einen Mobilfunkanschluss haben, unterrepräsentiert werden, weil sie selten in ein Verzeichnis eingetragen sind.
[41]Zufalls-Ziffern-Anwahl (Random-Digit-Dialing): Bei diesem Verfahren werden die Telefonnummern per Zufall vom Computer generiert. Damit können prinzipiell auch Geheimnummern in die Stichprobe gelangen. Allerdings sind zahlreiche vom Computer erzeugte Nummern überhaupt nicht registriert, sodass der Streuungsverlust relativ groß ist. Aus diesem Grund wird in der Regel die Zufalls-Addition-Anwahl (Random-Last-Digit-Dialing) angewendet. Dabei werden im ersten Schritt Nummern aus dem Telefonbuch ausgewählt und im zweiten Schritt die letzte oder die letzten beiden Ziffern zufällig ergänzt20 (vgl. Fuchs 1994: 154ff., 158ff.; Gabler / Häder 1997).Weder bei der Telefonbuch- oder Telefon-CD-Auswahl noch bei der Zufallsnummern-Auswahl werden direkt Zielpersonen ermittelt, sondern nur Telefonnummern. Dieses Problem stellt sich entsprechend dem Prinzip der Haushaltsauswahl bei Flächenstichproben (Random Route, Random Walk). Für die Auswahl der Zielpersonen gibt es mehrere Möglichkeiten: Wird derjenige befragt, der sich am Telefon meldet, ist die Stichprobe auf der Personenebene nicht mehr zufällig, weil zu bestimmten Tageszeiten bestimmte Personen innerhalb des Haushalts ans Telefon gehen. Alternativ könnte man zur Bestimmung der Zielperson nach dem Haushaltsmitglied fragen, bei dem die zeitliche Differenz zwischen dem letzten oder dem nächsten Geburtstag am geringsten ist. Das aufwändigste Verfahren ist ein Haushaltsscreening, bei dem alle Haushaltsmitglieder zunächst aufgelistet werden, sodass mit Hilfe einer Auswahltabelle die Zielperson ausgewählt werden kann (vgl. Fuchs 1994: 165ff.).
Personenstichproben aus Einwohnermelderegister: Bei dem Verfahren werden Personen ausgewählt, deren Telefonnummer unbekannt ist. Diese muss in einem gesonderten Schritt ermittelt werden, sodass das Verfahren aufwändiger als die anderen ist (vgl. Blasius / Reuband 1995: 66f.).
Oft werden Mastersamples von etwa vier bis acht Millionen Privatadressen generiert. Dazu werden alle Telefonbucheinträge nach Kreisen und Gemeindegrößeklassen geschichtet und pro Schicht systematisch ausgewählt. Damit kann ein Teil der Stichprobenbereinigung (etwa die Identifizierung von Firmeneinträgen oder falschen Nummern) bereits im Vorhinein erledigt werden, sodass auf das Mastersample schnell zugegriffen werden kann. Das Mastersample muss allerdings jährlich aktualisiert werden (vgl. Meier 1999: 95ff.).
| [42]2.2.3 | Vorteile des telefonischen Interviews |
Kosten und Aufwand von Telefoninterviews sind deutlich geringer als bei persönlichen Interviews. Der Interviewerstab muss nicht so groß sein, kann zentral eingesetzt werden und ist geografisch unabhängig. Außerdem bestehen bessere Möglichkeiten der Kontrolle und Supervision der Interviewer.
Aufgrund der zentralen Organisationsform kann die Forschungsleitung bei unerwarteten Problemen flexibel reagieren, und die Interviewer können wechselseitig voneinander lernen (vgl. Frey / Kunz / Lüschen 1990: 175f.).
Die Reichweite von Telefoninterviews ermöglicht Repräsentativerhebungen, bei denen auch spezielle Populationen erreichbar sind.
Die Datenerhebungsphase ist vergleichsweise kurz. Die Interviewer müssen die Zielpersonen nicht persönlich aufsuchen. Durch die Verbreitung mobiler Telefongeräte dürfte sich die Erreichbarkeit erhöhen.
Der Interviewer kann die Qualität der Befragungsergebnisse steigern. Viele Vorteile, die im Zusammenhang mit dem persönlich-mündlichen Interview aufgeführt wurden, treffen auch auf das Telefoninterview zu. Da die Gesprächsbeziehung anonymer ist – auch weil Dritte fast immer ausgeschlossen sind –, sinkt zudem die Wahrscheinlichkeit, dass die Befragten unaufrichtig antworten; außerdem ist das Gespräch konzentrierter. Insgesamt können die Interviewer im Telefoninterview weniger Fehler begehen als im persönlichen Interview, weil sie besser kontrollierbar sind und weil ihr Verhalten, auf die akustische Dimension reduziert, weniger exponiert ist (vgl. Fowler 1988: 70ff.; Fuchs 1994: 188f.).
| 2.2.4 | Nachteile des telefonischen Interviews |
Die Repräsentativität von Telefonstichproben ist von der Telefondichte abhängig. Personen, die keinen Telefonanschluss haben, werden in der Stichprobe nicht repräsentiert. Die Ausfälle, die aufgrund der automatischen Zufallsziehung (Random-Digit-Dialing oder Random-Last-Digit-Dialing) entstehen, sind nicht kontrollierbar, weil eine Nichtantwort entweder bedeuten kann, dass es die betreffende Telefonnummer nicht gibt oder dass die Person mit dem betreffenden Telefonanschluss nicht erreichbar ist.
Die Ausschöpfung von Telefonstichproben ist in der Regel niedriger als die persönlicher Umfragen und reicht in Deutschland kaum über 50 Prozent (vgl. Stögbauer 2000). Dieser Wert lässt sich auch kaum steigern durch die vorherige Zustellung des Fragebogens, sondern allenfalls mit aufwändigen Kombinationen mit den anderen Befragungsverfahren (vgl. Friedrichs 2000).
[43]Der Fragebogen muss relativ einfach gestaltet sein. Der Einsatz optischer Skalen, visueller Hilfsmittel (Bildblätter) und sonstiger Gegenstände ist nicht möglich (zum Beispiel auch keine Copytests). Die Bildung von Rangreihen kann nur begrenzt eingesetzt werden, da sie nur mit optischer Unterstützung gut funktioniert. Noelle-Neumann und Petersen (1996: 309ff.) nennen zahlreiche weitere Beispiele für nicht oder nur eingeschränkt einsetzbare Mittel, die bei mündlicher Befragung möglich sind.
Der Interviewer hat nur eingeschränkte Möglichkeiten, den Befragten zur Teilnahme zu motivieren oder eine persönliche Beziehung aufzubauen, aufgrund derer es möglich ist, auch sensible und heikle Fragen zu stellen. Insgesamt ist die Gesprächssituation am Telefon unverbindlicher als im persönlich-mündlichen Interview. Außerdem ist die Interviewdauer kürzer als beim persönlichen Interview, was damit einhergeht, dass die Antworten in der Regel oberflächlicher sind. Dies ist die Kehrseite der größeren Anonymität (vgl. Fowler 1988: 70ff.; Frey / Kunz / Lüschen 1990: 57).
| 2.3 | Die schriftliche Befragung |
| 2.3.1 | Beschreibung und Varianten |
Bei der schriftlichen Befragung wird kein Interviewer eingesetzt, und die Befragten füllen den verschickten oder verteilten Fragebogen selbst aus.
Die schriftliche Befragung gleicht zwar dem individuellen Briefverkehr (vgl. Richter 1970: 142), umfasst aber mehr Varianten der Verteilung als die postalische Verschickung von Fragebögen.
Bei der postalischen Befragung wird der Fragebogen als Brief verschickt. Dazu ist es erforderlich, dass dem Fragebogen ein Anschreiben mit adressiertem und frankiertem Rückumschlag beigelegt wird. Der Rücklauf kann mit Nachfassaktionen verbessert werden. Wenn die Befragung nicht anonym ist, können die Nicht-Antworter gezielt angeschrieben werden. Eine Variante ist die Postwurfsendung mit Rückantwortschein, bei der allerdings der Rücklauf nicht kontrollierbar ist.
In Ländern, in denen ein hoher Anteil der Bevölkerung mit Computern ausgestattet ist, oder bei Fragestellungen, für die spezielle Populationen mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Computerausstattung befragt werden sollen, ist es auch möglich, den Fragebogen per Diskette zu verschicken. Das Verfahren [44]»Disk by Mail« (DBM) findet im Unterschied zum elektronischen Versand mit dem herkömmlichen Postversand statt.
Bei der Beilagenbefragung werden die Fragebögen einer Zeitschrift beigelegt oder in sie eingeheftet. Dies sind zumeist entweder vierseitige Fragebögen in der Heftmitte oder zweiseitige heraustrennbare Fragebögen bzw. Fragekarten im Postkartenformat, die irgendwo im Heft platziert werden. Die Beilagenbefragung senkt die Kosten der postalischen Befragung, da keine Versendungskosten entstehen. Allerdings muss ein Rückumschlag mit dem Aufdruck »Gebühren zahlt Empfänger« eingeheftet oder punktuell aufgeklebt werden.
| 2.3.2 | Stichprobe |
Die Bildung repräsentativer Stichproben erfolgt bei schriftlichen Befragungen vom Prinzip her ähnlich wie bei persönlichen oder telefonischen Befragungen; sie hängt aber insbesondere von der gewählten Variante ab. Eine postalische Verschickung von Fragebögen erfordert die Kenntnis von Adressen. Diese können etwa von Einwohnermelderegistern oder aus Telefonbüchern bzw. von CD-ROMs mit Telefonverzeichnissen ermittelt werden. Je nach Fragestellung der Untersuchung liegen Adressen mitunter bereits vor, etwa wenn die Abonnenten einer Zeitung befragt werden sollen (vgl. Nötzel 1987a: 153). Für die Beilagenbefragung gilt dies ebenfalls. Hier kann eine einfache Zufallsauswahl aus dem Abonnentenstamm gezogen oder – wenn der Anteil des freien Verkaufs hoch ist – der Fragebogen jedem x-ten Exemplar beigelegt werden.
Eine besondere Variante ist die Einrichtung von Access-Panels. Das ist ein Pool von vorrekrutierten Haushalten, die sich zur Zusammenarbeit bereit erklärt haben und ad hoc für Befragungen und Tests zur Verfügung stellen. Diese Panels werden auf unterschiedliche Weisen rekrutiert: Entweder kauft sich das betreffende Institut die Adressen, oder der Interviewer fragt im Anschluss an mündliche oder telefonische Interviews den Befragten, ob er prinzipiell zur Panelteilnahme bereit sei. Als Schneeballaktion werden die Befragten auch um die Namen weiterer Personen gebeten, um diese dann für die Teilnahme am Access-Panel zu gewinnen. Bei der »Panelpflege« muss darauf geachtet werden, dass die Panelhaushalte weder zu oft noch zu selten (durchschnittlich sechsmal im Jahr) befragt werden. Wichtig ist auch ein abwechslungsreicher Themenmix. Ist ein solches Panel aufgebaut, erfolgt die Befragung schriftlich (vgl. Hoppe 2000: 147, 151, 159f.).
| 2.3.3 | Vorteile der schriftlichen Befragung |
Schriftliche Befragungen erfordern organisatorisch, zeitlich und finanziell deutlich weniger Aufwand als andere Formen der Befragung. Sie benötigen [45]keinen Interviewerstab, der Ablauf der Erhebung ist zeitlich gestrafft. Bei der Online-Befragung ist der Aufwand – zumindest für den Forscher – noch geringer, weil die wesentlichen Schritte des Forschungsprozesses, die Erstellung und Gestaltungsmöglichkeiten des Fragebogens, die Durchführung der Befragung, die Datenerfassung und die Datenanalyse automatisiert und protokolliert werden (vgl. Gadeib 1999: 108f.).
Es gibt kaum Probleme bei der Erreichbarkeit der Zielpersonen: Die postalische Befragung kann geografisch sehr weit streuen, und die Fragebögen können zeitlich fast simultan zugestellt werden. Das Verhältnis zwischen der Stichprobengröße (Anzahl der zu befragenden Personen) und dem Zeitraum und der geografischen Verbreitung der Stichprobe ist günstig. Außerdem sind Zielpersonen, die zu bestimmten Tageszeiten nicht interviewt werden können, weil sie zum Beispiel berufstätig sind, besser erreichbar.
Externe Effekte durch sichtbare Merkmale, Erwartungen und Verhaltensweisen von Interviewern treten nicht auf. Das bei mündlichen und telefonischen Interviews gelegentlich auftretende Problem der sozial erwünschten Beantwortung der Fragen wird auf diese Weise entschärft, obgleich es auch hier nicht ganz zu vermeiden ist (etwa bei heiklen Fragen nach Normverletzungen, vgl. Nötzel 1987a: 152). Da es keinen persönlichen Kontakt zwischen Forscher bzw. Interviewer und Befragtem gibt, ist die Anonymität der Befragung für den Befragten offensichtlicher gewahrt.
Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität bei der Beantwortung. Der Befragte kann sich in einem gewissen Rahmen den genauen Zeitpunkt selbst aussuchen, kann ferner seine Antworten überdenken, sich benötigte Informationen beschaffen und den Kontext der Fragen bzw. die Logik des Fragebogens erkennen. Die schriftliche Befragung ist also insbesondere geeignet, wenn es um Themen geht, bei denen der Befragte über die Antworten nachdenken muss. Sie nimmt damit die Selbstbestimmtheit des Befragten ernst.
Der Fragebogen kann visuelle Unterstützungen und lange Batterien mit ähnlichen Fragen enthalten, da diese nicht von einem Interviewer vorgelesen werden müssen. Der Befragte hat dann viel stärker die Möglichkeit, das Tempo seines Antwortprozesses selbst zu bestimmen (vgl. Bourque / Fielder 1995: 9ff.).
| 2.3.4 | Nachteile der schriftlichen Befragung |
Die Grundgesamtheit muss bekannt sein, damit aus ihr konkrete Adressenstichproben gezogen werden können. Gerade bei postalischen Befragungen ist nicht jede Grundgesamtheit definierbar, etwa die Leser einer Zeitschrift, [46]da nur aus der Abonnentenkartei Stichproben gezogen werden können. Dieser Nachteil tritt dagegen bei einer Beilagenbefragung weniger auf, weil damit alle Leser der betreffenden Zeitschrift erreichbar sind. Andere in der Umfragepraxis übliche Verfahren der Zufallsstichprobe wie das Random-Route-Verfahren sind nicht einsetzbar.
Bei postalischen Befragungen schwankt die Ausschöpfungs- bzw. Rücklaufquote erheblich und ist in der Regel deutlich geringer als bei den auf Interviews basierenden Befragungsformen. Dabei bleiben die Ausfallursachen weitgehend unbekannt. Die Zielpersonen vergessen oft einfach, den Fragebogen auszufüllen. Außerdem ist es durch die fehlende Interviewsituation leichter, die Beantwortung insgesamt oder einzelner Fragen zu verweigern. Die Motivationsleistung durch den Interviewer fallen aus. Dies gilt verschärft für die Beilagenbefragung, bei der selten Rücklaufquoten mit mehr als zwanzig Prozent realisierbar sind, weil Nachfassaktionen mit diesem Verfahren nicht durchführbar sind. Sie ist deshalb überhaupt nur dann einsetzbar, wenn die Grundgesamtheit sehr homogen ist, wie im Fall der Leserschaft einer Zeitschrift.
Verzerrungseffekte treten vor allem dadurch auf, dass durch die postalische Zustellung der Eindruck einer behördlichen Zustellung erweckt wird. Diese Kommunikationsform wirkt einerseits verbindlicher, weckt andererseits aber auch eher die Angst, kontrolliert zu werden, als dies beim konversationsähnlichen Interview der Fall ist. Weiterhin dürfte der Mittelschichtbias bei der schriftlichen Befragung noch stärker sein, als er für andere Befragungsformen bereits festgestellt wurde, weil die Beantwortung eines Fragebogens vergleichsweise hohe Lese- und Schreibfähigkeiten voraussetzt. Insbesondere offene Fragen sind davon betroffen und eignen sich für schriftliche Befragungen deshalb weniger. Die Selbstselektion der Befragten vermindert die Stichprobe damit nicht nur quantitativ, sondern auch in qualitativer Hinsicht.
Der Anwendungsbereich erstreckt sich aufgrund der schriftlichen Fixierung der Meinungen hauptsächlich auf im weiteren Sinn kognitive Sachverhalte. Spontane, unreflektierte und irrationale Äußerungen dürften eher die Ausnahme sein und eignen sich weniger als Untersuchungsziel einer schriftlichen Befragung. Auf der anderen Seite sind jedoch Abfragen über individuelles Wissen ebenfalls kaum möglich, da der Befragte auf fremdes Wissen zurückgreifen kann (vgl. Richter 1970: 142ff.; Bourque / Fielder 1995: 14ff.).
Die Befragungssituation ist nicht kontrollierbar. Weder ist hinreichend zu garantieren, dass die angeschriebene Zielperson den Fragebogen selbst oder allein ausfüllt noch dass sie ihn gemäß den Instruktionen bearbeitet und die Reihenfolge der Fragen einhält. Für spontane Antworten ist die schriftliche [47]Befragung aufgrund der mangelnden Kontrollierbarkeit ungeeignet. Schließlich sind keine Stichtagserhebungen möglich (vgl. Hafermalz 1976: 23).
Da kein Interviewer eventuelle Nachfragen zur Verständlichkeit beantworten kann, hängt die korrekte Beantwortung allein vom Fragebogen ab. Er muss inhaltlich vollständig selbst erklärend und visuell klar gestaltet sein (vgl. Mangione 1995: 6, 27ff.). Außerdem fällt mit der Abwesenheit des Interviewers eine Quelle für die Einschätzung der Qualität der Antworten weg.
| 2.3.5 | Spezielle Empfehlungen für schriftliche Befragungen |
Sowohl die aufgeführten Vorteile als auch die Nachteile sind nicht absolut, sondern relativ zu verstehen und hängen weitgehend vom Untersuchungszweck, von der Definition der Grundgesamtheit und von der Untersuchungsanlage ab. Die Vorteile der relativ niedrigen Kosten und des geringen Aufwandes können verloren gehen, wenn die Rücklaufquote so gering ist, dass umfangreiche Nachfassaktionen erforderlich sind. Umgekehrt können die Probleme der postalischen Befragungen gemindert werden. Deshalb werden in den Lehrbüchern zahlreiche Empfehlungen zur Gestaltung des Fragebogens gegeben (vgl. Hafermalz 1976: 28ff., 63ff., 192ff.). Das Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf die Erhöhung der Ausschöpfungsrate, um die Repräsentativität der Stichproben zu gewährleisten.
Das Anschreiben (der Begleitbrief) muss kurz, inhaltlich prägnant, klar gestaltet sowie inhaltlich und visuell motivierend sein. Es sollte persönlich gehalten sein und ein Datum des Einsendeschlusses angeben (vgl. Hafermalz 1976: 111; Koch 1993: 79; Bourque / Fielder 1995: 106ff.). Zusätzlich kann eine gesonderte Benachrichtigung der eigentlichen Fragebogenaktion vorgeschaltet werden. Da die Gefahr besteht, dass der Begleitbrief eine bestimmte selektive Wirkung ausübt, die sich negativ auf die Repräsentanz auswirkt, muss er so formuliert und gestaltet sein, dass er auf alle Subgruppen der Stichprobe passt (vgl. Richter 1970: 149f.).
Für das Rückschreiben muss ein adressierter und frankierter Rückumschlag beiliegen.
Der Fragebogen muss klar anonym sein und darf keine versteckten Zeichen zur Identifizierung des Befragten enthalten.
Zur Erhöhung des Rücklaufs dienen auch Erinnerungsschreiben, die mehrfach wiederholt werden können. Bei anonymen Befragungen werden dadurch Kosten und Aufwand deutlich erhöht, sodass vor dem Einsatz eine Kosten-Nutzen-Analyse erfolgen sollte (vgl. Mangione 1995: 63ff.).
[48]Um die Kooperationsbereitschaft zu erhöhen, werden oft Geschenke (»incentives«) – Kugelschreiber, Briefmarken oder Telefonkarten – mitgeschickt, entweder bereits im Voraus oder erst nach erfolgter Rücksendung. Letzteres funktioniert allerdings nur, wenn die Befragung nicht anonym erfolgt. Ob die Belohnung in Geld ausgezahlt oder ein Geschenk zugeschickt werden soll, ist ebenso umstritten wie die Höhe oder der Wert des Geschenks. Eine Variante besteht in der Teilnahme der Rücksender an einer Lotterie oder einem Preisausschreiben (vgl. Mangione 1995: 79ff.).21
Eine systematische Vorgehensweise zur Optimierung schriftlicher Befragungen entwickelte Dillman (1978) mit der »Total Design Method«, die er zur »Tailored Design Method« ausbaute (vgl. Dillman 2000). Sie umfasst konkrete Vorschriften zum Design des Fragebogens und zur Durchführung der Befragung. Der Fragebogen soll als Booklet gestaltet werden, wobei Vorderseite und Rückseite frei bleiben. Äußerliche Ähnlichkeiten zu Werbebroschüren sind zu vermeiden. Im Fragebogen werden nach der Einstiegsfrage zuerst die interessanten Fragen platziert, während problematische und demografische Fragen nach hinten gestellt werden (vgl. Dillman 1978: 362).Besonders wichtig ist der Versand, der zur Wochenmitte stattfindet. Eine Woche nach dem Erstversand wird eine Postkarte oder ein Brief verschickt, um den Teilnehmern zu danken und die Nicht-Teilnehmer freundlich zu erinnern und zur Teilnahme zu motivieren. Drei Wochen nach dem Erstversand wird der Fragebogen erneut verschickt zusammen mit einem weiteren, kürzeren Mahnschreiben. Eine letzte freundliche, aber bestimmte Mahnung erfolgt sieben Wochen nach dem Erstversand per Einschreiben (vgl. Dillman 1978: 366.; Bourque / Fielder 1995: 149ff.). Auf diese Weise kann der Rücklauf enorm erhöht werden, eine Erfahrung, die sich interkulturell übertragen und bei verschiedenen Populationen anwenden lässt (vgl. Hippler 1988: 247f.).
Generell darf die Feldzeit nicht zu stark mit der Urlaubszeit (auch Feiertage) überlappen (vgl. Nötzel 1987a: 154).
Der Rücklauf sollte kontrolliert und detailliert analysiert werden, um Subgruppen zu identifizieren, deren Rücklauf unterdurchschnittlich groß ist, und um Rücklaufcharakteristiken zu ermitteln (vgl. Richter 1970: 225ff.; Nötzel 1987a: 155; Blasius / Reuband 1996).
| [49]2.4 | Computerunterstützte Befragungsverfahren |
| 2.4.1 | Beschreibung und Varianten |
Ergänzend zu den herkömmlichen Verfahren der Befragung gibt es für jedes Verfahren eine computerunterstützte Variante, um deren Planung, Durchführung und Verwaltung effizienter und kostengünstiger zu machen.
Folgende Varianten sind derzeit hauptsächlich im Einsatz (vgl. Frey / Kunz / Lüschen 1990: 179ff.; Saris 1991: 30; Fuchs 1999: 120; Knobloch / Knobloch 1999: 63):
Persönliches Interview: Die konventionelle Vorgehensweise beim persönlichen Interview wird »Paper-and-Pencil Personal Interviewing« (PAPI) genannt, weil der Interviewer die Fragen von einem Fragebogen aus zusammengehefteten oder gefalteten Papierblättern abliest und mit einem Schreibstift die Antworten in den Fragebogen einträgt. Im Fragebogen stehen neben den Fragen und – bei standardisierten Varianten – den Antwortvorgaben auch Anweisungen an den Interviewer, in welcher Reihenfolge er die Fragen stellen muss, wie er vorgehen muss bei bestimmten Antworten usw. (→ Kapitel 5). Beim computerunterstützten Interview, »Computer Assisted Personal Interviewing« (CAPI), führt der Interviewer entweder einen Laptop mit, liest die Fragen (und Antwortvorgaben) vom Bildschirm vor und tippt die Antworten bzw. die zu den Antwortkategorien passenden Zahlen in den Computer ein, oder er benutzt ein Pentop, bei dem der Befragte selbst mit einem Stift die Antworten in die entsprechenden Felder antippt.
Selbstausfüller-Befragung: Bei diesem Hybridverfahren zwischen persönlicher und schriftlicher Befragung verteilt ein Interviewer entweder den Fragebogen einer bestimmten Gruppe von Befragten an einem Ort (Klassenzimmer-Befragung) und bleibt in dem Zeitraum, in dem die Befragten den Fragebogen ausfüllen, anwesend, oder er hinterlässt dem Befragten den Fragebogen und sammelt den ausgefüllten Fragebogen zu einem vereinbarten Termin wieder ein. Beide Varianten des »Self Administered Questionnaire« (SAQ) sind auch computerunterstützt möglich: Der Interviewer überlässt dem Befragten einen mitgebrachten Computer, damit er selbstständig den Fragebogen am Bildschirm durcharbeitet. Diese Vorgehensweise wird »Computer Assisted Self-Interview« (CASI) oder »Computer Assisted Self-Administered Questionnaire« (CSAQ) genannt. Hier übernimmt der Befragte neben der Bearbeitung des Fragebogens auch noch – nebenbei – die Dateneingabe. Die Dateneingabe mit der Tastatur kann durch den Touchscreen ersetzt werden.[50]Neuere Varianten mit Spracherkennungsprogrammen, »Audio Computer Assisted Self-Administration« (ACASI), erlauben es, dass der Befragte nur noch die Fragen vom Bildschirm ablesen, aber die Antworten nicht mehr eintippen muss, sondern mündlich in den Computer sprechen kann. Es gibt auch die umgekehrte Variante der »Audio Computer Assisted Self-Administration« (Audio SAQ), bei der der Befragte die Fragen vom Walkman oder Diktiergerät abhört und die Antworten in den Computer eintippt.
Telefoninterview: Während die bisher genannten Techniken noch nicht flächendeckend verbreitet sind, ist das computerunterstützte Telefoninterview, »Computer Assisted Telephone Interviewing« (CATI), weitgehend etabliert; ein CATI-Studio gehört für die meisten Markt- und Sozialforschungsinstitute zum Inventar. Die zentrale Organisation des Interviewerstabs bei telefonischen Befragungen begünstigt die computerunterstützte Variante, weil hierfür keine portablen Computer notwendig sind. Die CATI-Technik erlaubt nicht nur die Unterstützung und Kontrolle der Durchführung, sondern integriert die Stichprobenziehung durch rechnergesteuerte Erzeugung von Zufallszahlen.
Auch über das Telefon sind weitere technische Varianten möglich: Beim »Touchtone Data Entry« (TDE) gibt der Befragte Ziffern über das Telefon ein, die für bestimmte Antwortmöglichkeiten stehen; beim »Voice Recognition Entry« (VRE) spricht der Befragte ins Telefon, und die Antworten werden über Spracherkennung automatisch digitalisiert.