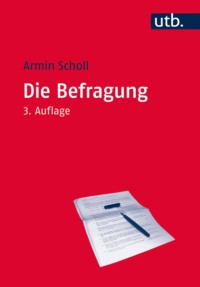Kitabı oku: «Die Befragung», sayfa 6
| [61]3 | Formen der Befragung |
Befragungen können unterschiedlich stark reguliert sein. In der ganz offenen Form gibt der Forscher oder Interviewer möglichst nur das Thema und wenige ungerichtete Fragen vor. Im Leitfadeninterview werden bestimmte Fragen vorformuliert, aber der Befragte antwortet offen. Im fokussierten Interview wird ein Stimulus vorgegeben, über den völlig offen oder mit Hilfe bestimmter Leitfragen gesprochen wird (einen Überblick über die vielzähligen qualitativ-offenen Formen und Varianten gibt Helfferich 2011: 36f.). In der standardisierten Befragung sind die Fragen und die Antwortmöglichkeiten festgelegt. Noch weiter standardisierte Formen sind Tests, bei denen vollständige Fragebatterien entworfen, standardisiert und normiert werden. Im Experiment werden sowohl das Instrument – in der Regel ein Fragebogen – als auch die Befragungssituation standardisiert.
Nichtstandardisierte Befragungen werden auch als unstrukturierte bzw. wenig strukturierte, aktive oder verstehende Interviews bezeichnet. Diese Begriffe sind jedoch problematisch. Ein unstrukturiertes Gespräch verläuft chaotisch und ohne erkennbare Regel. Nichtstandardisierte Befragungen sind dagegen strukturiert: Beim narrativen Interview strukturiert der Befragte weitgehend das Gespräch, während sich der Interviewer zurücknimmt. Beim Leitfadeninterview, problemzentrierten oder fokussierten Interview strukturiert der Interviewer das Gespräch zu einem großen Teil, da er nicht nur das Oberthema der Befragung, sondern auch gliedernde Aspekte (in Form der Leitfragen) vorgibt. Bei der Gruppendiskussion wirkt sich die Gruppensituation und Gruppendynamik strukturierend auf den Gesprächsverlauf aus (→ Kapitel 4.3). Die Bezeichnung »aktiv« geht implizit davon aus, als gäbe es auch passive Interviews, und spielt damit auf die reduzierte Rolle des Befragten bei standardisierten Interviews an (vgl. Holstein / Gubrium 1995: 7ff.). Die Kennzeichnung »verstehendes« Interview (vgl. Kaufmann 1999) unterschlägt, dass auch im standardisierten Interview Verstehensprozesse stattfinden. Der Befragte konstruiert vielmehr in jedem Interview aktiv Informationen (Daten), Mitteilungen (Antworten) und Verstehen (der Fragen).
Weitere Unterscheidungen betreffen die Struktur des Fragebogens und der Befragungsabfolge: Befragungen können monothematisch oder mehrthematisch (Omnibus-Befragung) sein; sie können als einmalige Querschnittserhebung oder als mehrfache Längsschnitterhebung konzipiert sein. Bei der Mehrfachbefragung besteht wiederum die Möglichkeit, mehrmals dieselben Personen (Stichproben) mit demselben oder einem ähnlichen Fragebogen zu befragen (Panelbefragung) oder mehrmals denselben bzw. ähnlichen Fragebogen bei unterschiedlichen Personen (Stichproben) einzusetzen (Trendbefragung).
| [62]3.1 | Das narrative Interview |
Das narrative Interview hat zwei Ziele: Zum einen will es Informationen über22 die Erlebnisse von Personen in einem bestimmten individuell-biografischen oder kollektiv-historischen Zusammenhang gewinnen, zum anderen will es herausarbeiten, wie dieses Wissen seitens der Befragten als (Stegreif-)Erzählung konstruiert und strukturiert wird (vgl. Holstein / Gubrium 1995: 56; Schütze 1987: 237; Küsters 2009: 29ff.).
Einige Lehrbücher erwähnen deshalb seine Nähe zu Forschungsrichtungen, die wissenschaftstheoretisch die Subjektivität, Konstruktivität und Interpretation sozialer Wirklichkeit in den Mittelpunkt stellen (symbolischer Interaktionismus, Ethnomethodologie, Cultural Studies, Konstruktivismus u.a.). Dennoch lassen sich die folgenden Ausführungen eher von methodisch-praktischen Gesichtspunkten als von methodologisch-theoretischen Erwägungen leiten.
Da der Befragte von sich und seinen Erlebnissen erzählen soll, hat das Interview einen Geschichtencharakter mit dem Ziel, dass daraus eine abgerundete Erzählung entsteht. Das vom Interviewer vorgegebene (Ober-)Thema muss demzufolge breit angelegt sein, der Befragte muss es als Geschichte erzählen können, und es muss für ihn sinnvoll sein, diese Geschichte zu erzählen (vgl. Schütze 1987: 238; →  www.utb-shop.de, Kapitel 1.1.2).
www.utb-shop.de, Kapitel 1.1.2).
Dementsprechend orientiert sich die Auswahl der Befragten an ihrer narrativen Kompetenz. Damit ist nicht allein die Sprach- oder Kommunikationsfähigkeit gemeint23, sondern auch, ob die Zielperson inhaltlich zur Fragestellung passt. Es kann dabei sogar vorkommen, dass sich die Auswahl während eines Interviews verändert, wenn sich herausstellt, dass der Befragte unter ganz anderen Gesichtspunkten antwortet, als es seine Rolle oder Position (etwa in einer Organisation), wegen der er ausgewählt worden war, vorsah oder erwarten ließ (vgl. Holstein / Gubrium 1995: 25ff., 75). Vor allem ist zu vermeiden, dass nur diejenigen ausgewählt [63]werden, die bereits kommunikativ aktiv sind und sich anbieten. Das bedeutet, dass sich der Interviewer bereits ein gewisses Vorwissen über die Zielpersonen oder zumindest über das Feld der potenziellen Befragten verschafft haben muss, um auswählen zu können, wer sich besonders gut eignet. Dazu benötigt der Interviewer Hintergrundwissen über diese Lebensumstände, das ihm beim Fragestellen und Interpretieren der Antworten behilflich ist. Deshalb ist es sinnvoll, narrative Interviews mit ethnografischen Beobachtungen zu kombinieren (vgl. Holstein / Gubrium 1995: 46).
Der Ablauf des narrativen Interviews lässt sich in mehrere Phasen unterteilen (vgl. Schütze 1987: 238ff.; Holstein / Gubrium 1995: 39):
In der Aushandlungsphase gibt der Interviewer dem Befragten das Untersuchungsthema vor, trägt ihm seine Idee zur Erzählthematik vor und richtet einen ersten Appell an die Erzählfähigkeit und den Erzählwillen des Befragten. Dazu lenkt er dessen Aufmerksamkeit auf seine Erinnerung. Voraussetzung für die Erzählung ist eine gewisse Lust des Befragten, seine Erlebnisse darzustellen und sich damit seiner Erlebnisse selbst zu vergewissern. Es ist deshalb notwendig, dass in dieser Anfangsphase Interviewer und Befragter die endgültige Erzählthematik abstimmen. Dazu muss der Interviewer darauf achten, seine Rolle nicht als (sozialwissenschaftlicher) Experte, sondern als Interessierter zu definieren und kommunizieren. Die erste Phase abschließend, erläutert der Interviewer dem Befragten den Ablauf des Interviews.
Durch eine erzählgenerierende Frage wird die Anfangs- oder Haupterzählung eingeleitet, in welcher der Befragte seine Schilderungen monologisch ausbreitet. Voraussetzung ist, dass es sich um eine Stegreiferzählung handelt und nicht um eine durch ein Vorgespräch bereits systematisch ausgearbeitete Erzählung. Der Interviewer darf in dieser Phase nicht thematisch-inhaltlich intervenieren, sondern nur aufmerksam zuhören, um in einer späteren Phase inhaltliche oder bewertende Fragen stellen zu können. Um sich nicht alle Details merken zu müssen, kann er sich auch Notizen machen. Sämtliche »Kommentare« haben nur gesprächsunterstützenden Charakter und zeigen Anteilnahme am Gespräch und an der Person des Befragten.Die reine Zuhörerrolle in dieser Phase ist für den Interviewer nicht einfach durchzuhalten, weil sich bei den Erzählungen der Befragten oft Ungereimtheiten ergeben, bei denen man im Alltagsgespräch sofort nachhaken würde (vgl. Hermanns 1995: 185). Während sich der alltägliche Zuhörer unmittelbar der Interaktionssituation hingibt, bewahrt der professionelle Interviewer Zurückhaltung, beobachtet die Situation und greift steuernd ein, um den Erzählfluss nicht zu behindern, sondern dessen Entfaltung zu fördern und ihn offen zu halten. Das Verhalten des Interviewers ist demnach äußerst strategisch, [64]wenn auch nicht im Sinn einer Täuschung des Befragten (vgl. Maindok 1996: 116, 122).
Erst wenn der Befragte seine Stegreiferzählung beendet hat, motiviert ihn der Interviewer dazu, weitere Aspekte oder Hintergrundgeschehnisse des Ereignisablaufs zu erzählen. Diese narrativen Nachfragen müssen sich auf Aspekte beziehen, die der Befragte bereits bei der Anfangserzählung angedeutet, aber nicht ausgeführt hat. Die Nachfragen können sich auch aus vorangegangenen Interviews ergeben, wenn sie thematisch in diesem Rahmen bleiben. Sie haben das Ziel, weitere (Teil-)Geschichten auszulösen und die Erzählung fortzusetzen, sind aber nicht als im Interview abzuarbeitende Fragen vorformuliert und notiert. Sie dürfen sich (noch) nicht auf Motive, (strukturelle) Zustände oder Routinen beziehen, um beim Befragten weder Erwartungsunsicherheit noch Erwartungsdruck zu erzeugen. Informative, neue Themen initiierende Fragen oder gar evaluative Nachfragen sind in dieser Phase ebenfalls ungeeignet (vgl. Hermanns 1995: 185).
Nachdem das durch Nachfragen aktualisierte Erzählpotenzial des Befragten ausgeschöpft ist, stellt der Interviewer weitere Fragen zur Charakterisierung der (individuellen und kollektiven) Akteure im berichteten Geschehen und zum sozialen Rahmen der erzählten Geschichte. Erst diese Beschreibungsnachfragen zielen darauf ab, wie der Befragte die Erlebnisse, seine Rolle und die der anderen an der Geschichte Beteiligten interpretiert und kommentiert.
Abschließend stellt der Interviewer argumentative Nachfragen, die sich aus den Kommentaren des Befragten, aus möglichen Widersprüchen oder offenen Fragen ergeben. In dieser Phase entwickelt sich das Interview zu einem argumentativen Gespräch über die Eigentheorien des Befragten.Die beiden letzten Phasen dienen der vom Interviewer und Befragten gemeinsam ausgehandelten Explikation der Erzählung. Sie steuern den weiteren Gesprächsverlauf und werden deshalb erst dann eingesetzt, wenn die offene Erzählung beendet oder ausgeschöpft ist, weil sie sonst vom Befragten als dominant empfunden und den Erzählfluss hemmen könnten.
In einigen Beschreibungen des narrativen Interviews wird der Abschluss des Gesprächs Bilanzierungsphase genannt, weil der Befragte seine eigenen Ausführungen generalisieren und abstrahieren soll (vgl. Hopf 1995: 179; Hermanns 1995: 184). Je nach Gesprächsverlauf kann sie bereits in der Phase des argumentativen Nachfragens enthalten sein oder als gesonderten letzten Gesprächsabschnitt markiert werden.Selbst nach dem Abschalten des Aufzeichnungsgerätes kann es sein, dass der Befragte noch themenrelevante Anmerkungen macht. Der Interviewer sollte [65]folglich auch nach der formellen Beendigung des Gesprächs noch aufmerksam bleiben und sich von den Ausführungen ein Gedächtnisprotokoll anfertigen (vgl. Fuchs 1984: 257).
Obwohl sich der Interviewer in den ersten Phasen des Interviews inhaltlich sehr stark zurückhält und nur seine Anteilnahme an dem Gespräch kommuniziert, führt er in einem gewissen Sinn das Gespräch insofern, als er die Ausführungen des Befragten durch seine Nachfragen auch wieder zum Gesamtthema der Untersuchung zurückführt, das Gespräch bis zu einem gewissen Grad ordnet und dem Befragten dabei hilft, die Aufgabe des Erzählens seiner Geschichte zu bewältigen (vgl. Holstein / Gubrium 1995: 48ff.).
Das narrative Interview gleicht insofern einer Konversation, als es sich bei dem Gespräch um ein Geben und Nehmen handelt. Es kann durchaus sein, dass der Interviewer dem Befragten auch Formulierungshilfe gibt, sofern diese nicht suggestiv oder einschränkend ist. Der Interviewer muss die unterschiedlichen Deutungshorizonte, die dem Befragten möglicherweise selbst nicht bewusst sind, erkennen und ihm dabei behilflich sein, subjektive Relevanzen, Orientierungen und Verbindungen herzustellen. Ziel ist die Entfaltung einer Erzählung, die unter Beteiligung des Interviewers und des Befragten zustande kommt und als Erzähltext einen Wert bekommt (vgl. Holstein / Gubrium 1995: 47, 50, 59).
Im narrativen Interview gibt der Befragte nicht nur Antworten auf Fragen wie im standardisierten Interview, sondern erläutert sie und ihr Zustandekommen. So referiert der Befragte nicht nur eine Einstellung zu einem bestimmten Sachverhalt, sondern stellt ihn in einen situationalen Kontext, indem er bestimmte Aspekte erwähnt, andere dagegen auslässt (»Relevanzfestlegung und Kondensierung«), Beispiele erzählt und deutet (»Detaillierung«). Er stellt weiterhin Zusammenhänge zwischen verschiedenen Antworten her und rundet seine Schilderungen ab (»Gestaltschließung«), das heißt, es sind keine zunächst voneinander unabhängigen Variablen wie in der standardisierten Befragung. Diese kommunikativen Verhaltensweisen im Rahmen des Geschichten Erzählens entstehen aus dem Zugzwang des Erzählens selbst24, äußern sich aber weniger in einem Frage-Antwort-Interview. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass die Befragten – aus der Sicht des Forschers – widersprüchliche Antworten geben, bestimmte Ausführungen wieder zurücknehmen oder relativieren und über ihre eigenen Aussagen reflektieren. Dieses Theoretisieren ist eine »subdominante Aktivität« [66]in jedem Gespräch, die den sozialen Rahmen der Erzählung herstellt und für den Forscher von hohem analytischem Wert ist (vgl. Holstein / Gubrium 1995: 53ff., 78f.; Schütze 1987: 241, 255).
Es gibt dementsprechend keinen ausgearbeiteten Fragebogen, sondern allenfalls notierte Fragen, die aber durch einen Interviewverlauf ergänzt werden können, sodass der nächste Befragte möglicherweise eine neue Frage gestellt bekommt, die sich aus den Antworten des vorherigen Befragten als sinnvoll erwiesen hat (vgl. Holstein / Gubrium 1995: 56).
Das narrative Interview kann auch gleichzeitig mit mehreren Befragten aus dem gleichen Lebenskontext stattfinden, etwa mit Partnern, um die Erzählperspektiven zu erweitern. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn zu erwarten ist, dass der Befragte von sich aus auf diese Referenzpersonen (meist Familie oder Arbeitskollegen) zu sprechen kommt (vgl. Holstein / Gubrium 1995: 66ff.).25
Bei der Analyse werden beide Ziele des narrativen Interviews gleichzeitig berücksichtigt, das heißt, die Informationen im Einzelnen und ihre Verbindungen (»Was«) sowie das Mitteilungsverhalten und die sprachliche Umsetzung der Erzählung (»Wie«) werden zueinander in Beziehung gesetzt (vgl. Holstein / Gubrium 1995: 79f.; Schütze 1987: 249). Deshalb wird das Gespräch aufgezeichnet, manchmal sogar per Video. Anstelle einer Videoaufzeichnung empfiehlt sich ein Interviewerbericht, der unmittelbar nach dem Interview angefertigt wird. Dabei sollten folgende Beobachtungen festgehalten werden (vgl. Fuchs 1984: 258f.):
Rahmendaten: Art des Kennenlernens, Kontaktaufnahme, Dauer, Zahl und Ort(e) der Kontakte;
Interviewsituation: anwesende Dritte, Störungen, Gesprächssituation;
Einschätzung des Befragten durch den Interviewer: vermutete Interessen, Gesprächshabitus, Erzählbereitschaft, Wohnumfeld;
Einschätzung des Interviewers durch den Befragten: Charakterisierungen, die sich aus dem Gespräch vor und nach dem eigentlichen Interviewen ergeben;
Interaktion im Interview: geschlechts- und altersbezogene Rollenbeziehungen, Symmetrie der Beziehung zum Interviewer;
Probleme im Interview: Nichtthematisierung wichtiger Aspekte, emotionale und kommunikative Probleme wie Peinlichkeiten oder Irritationen, Verständnisschwierigkeiten, Reflexionen durch das Interview selbst.
[67]Die Transkription erfasst nicht nur die Inhalte der Erzählung, sondern auch den Kommunikationsstil, notiert also auch nonverbales und paraverbales Verhalten des Befragten. Bei der Analyse und Reorganisation des Textes darf diese sequenzielle Ordnung nicht verändert werden, sondern das Material muss chronologisch und am Einzelfall ausgewertet werden (vgl. Schneider 1988: 233ff.).
Da bereits die Durchführung sehr zeitaufwändig ist und durch die elaborierte Transkription (vgl. Dittmar 2009; Fuß / Karbach 2014) eine große Menge an Textmaterial entsteht, muss sich der Forscher auf eine überschaubare Anzahl von Fällen beschränken, die allerdings groß genug sein muss, um die theoretische Variabilität der sozialen und biografischen Prozesse im Untersuchungsfeld sicherzustellen. Unerheblich ist dagegen die Verteilung soziodemografischer Merkmale, da die analysierten Prozesse grundlegender ansetzen und prinzipiell in jeder Stichprobe gelten können (vgl. Schütze 1987: 245, 249f.).
Mit dem analysierten Textmaterial ist es möglich, (neue) Prozesse in der sozialen Wirklichkeit zu entdecken und zu interpretieren. Deshalb dürfen die Interviewtexte nicht durch inhaltsanalytische Kategorienbildung beeinträchtigt werden, sondern müssen in ihrer Prozesshaftigkeit analysierbar bleiben. Demnach bleibt das detailliert transkribierte und aufbereitete Primärmaterial die Basis für alle Analysen. Nach dem »Exhaustionsprinzip« wird in mehreren Durchgängen sowohl des Einzelfalls und seinen Besonderheiten als auch zwischen den Interviews vergleichend-kontrastiv das sprachliche Aufzeige- und Ausdruckspotenzial für soziale und kommunikative Prozesse herausgearbeitet. Dieser Interpretationsprozess erfordert zum einen die Analyse der indirekten sprachlichen Indikatoren, Indizien oder Symptome, also wie der Befragte seine Geschichte erzählt, um einordnen zu können, was der Befragte meint, auch wenn er es nicht ausdrücklich sagt. Der Interpretationsprozess ist zum anderen iterativ, denn er wird so lange fortgesetzt, bis ein saturiertes integriertes theoretisches Modell entsteht. Saturiert (gesättigt) ist das Theoriemodell, wenn es durch keine weiteren empirischen Aspekte mehr ergänzt werden muss und in der gesamten Stichprobe gültig ist (vgl. Schütze 1987: 245ff., 254).
Voraussetzung für die Eignung des narrativen Interviews ist der Prozesscharakter der erzählten Erlebnisse oder Vorkommnisse, und dieser muss den Befragten auch bewusst sein, damit sie ihn rekonstruieren können. Demnach lassen sich Routinen im Alltag oder Arbeitsablauf und Organisationsstrukturen weniger gut mit narrativen Interviews erfassen, weil oder insofern sie unter der täglichen Aufmerksamkeitsschwelle liegen. Selbst wenn die Befragten im Rahmen ihrer Erzählungen immer wieder abstrahieren, argumentieren und auf Strukturen hinweisen, hängen diese zusätzlichen interpretierenden Schilderungen von der eigentlichen Erzählung ab (vgl. Schütze 1987: 243f.; Hermanns 1995: 183).
| [68]3.2 | Das Leitfaden- und Experteninterview |
Das Leitfadeninterview nimmt eine mittlere Position zwischen dem narrativen und dem standardisierten Interview ein. Der Interviewer strukturiert zum einen durch mehr und spezifische Fragen das Gespräch viel stärker als beim narrativen Interview. Zum anderen lässt er dem Befragten mehr Möglichkeiten zu antworten, weil er nur Fragen stellt, aber keine Antwortmöglichkeiten vorgibt. An die Stelle eines teil- oder vollstandardisierten Fragebogens tritt ein Interviewleitfaden, der die zu behandelnden Themen und Themenaspekte mit vorgeschlagenen Fragen beinhaltet.
Der Leitfaden kann in seinem Umfang und Standardisierungsgrad variieren: Die Anzahl der Fragen schwankt zwischen fünf allgemein gehaltenen bis zu zahlreichen detaillierten Fragen, deren Reihenfolge entweder eingehalten werden muss oder die je nach Gelegenheit in das Gespräch eingestreut werden können. Die Anzahl der Frage richtet sich auch nach der Interviewdauer, die eine Stunde nicht oder nur in Einzelfällen überschreiten sollte. Der Leitfaden hat eher die Funktion einer Gedächtnisstütze für den Interviewer, wenn er nur wenige und in der Reihenfolge nicht festgelegte Fragen enthält, oder eher die Funktion der Gesprächsstrukturierung und Vergleichbarkeit, wenn er aus vielen Fragen besteht, deren Reihenfolge einer inhaltlichen, an der Gesamtfragestellung ausgerichteten Logik entspricht (vgl. Hirzinger 1991: 92; Gläser / Laudel 2010: 144;  www.utb-shop.de, Kapitel 2.3, 3.2).
www.utb-shop.de, Kapitel 2.3, 3.2).
Die Anwendungsgebiete ähneln eher dem narrativen als dem standardisierten Interview: Es handelt sich um Fallstudien mit kleinen Stichproben, und die Tiefenperspektive der Befragten ist wichtiger als die Vergleichbarkeit der Antworten. Oft sind Subkulturen oder soziale Randgruppen, aber auch Eliten die Forschungsobjekte. Für die Randgruppen ist der Leitfaden eine Gesprächshilfe, mit der der Forscher dem Befragten gegenüber seine Erwartungen strukturiert, während eine völlig offene Narration den Befragten möglicherweise verunsichert, weil er nicht einordnen kann, was genau von ihm verlangt wird. In einigen Fällen gelingt es dem Befragten nicht, das Gespräch selbst zu strukturieren und eine Erzählung aufzubauen, sodass er für (Zwischen-) Fragen dankbar ist.
Ganz anders ist die Bedeutung für Elite-Befragte. Sie lehnen die restriktive Handhabung eines standardisierten Fragebogens mit eingeschränkten Antwortmöglichkeiten oft ab. Dies gilt insbesondere für Experten, deren Wissen auf der einen Seite über vorformulierte Kategorien weit hinausreicht und das mit einer standardisierten Befragung nicht angemessen erfasst werden könnte. Auf der anderen Seite bezieht sich die Forschungsfrage nur auf das Expertentum, ist also [69]rein sachbezogen und abstrahiert von den privaten Lebensumständen. Dafür wäre die offene Narration ungeeignet und könnte zu abschweifenden und irrelevanten Ausführungen führen (vgl. zur Expertenbefragung Bogner / Littig / Menz 2009).
Das Ziel des Experteninterviews besteht in der Generierung bereichsspezifischer und objektbezogener Aussagen, nicht dagegen in der Analyse von allgemeinen Regeln des sozialen Handelns wie beim narrativen Interview. Das Experteninterview weist allerdings auch einige Besonderheiten auf, die nicht generell für das Leitfadeninterview gelten. Dazu zählt die Definition und Auswahl von Experten.
Der Expertenstatus ergibt sich aus der Position oder der Funktion, den die Experten zum Beispiel in einer Organisation innehaben. Experten müssen für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich sein und dafür einen privilegierten Zugang zu den betreffenden Informationen haben (vgl. Meuser / Nagel 1991: 442ff., 466).
In der Expertenbefragung kann der Experte selbst die Zielgruppe sein, wenn er Auskunft über sein Handlungsfeld innerhalb einer Organisation gibt, oder er kann über andere Zielgruppen Auskunft geben. Dies ist der Fall, wenn Sozialarbeiter über Sozialhilfeempfänger, Lehrer über ihre Schüler usw. befragt werden oder wenn der Experte – oft in höherer Position – Auskünfte über seine Organisation (und nicht speziell über seine Rolle und Funktion) gibt (vgl. Meuser / Nagel 1991: 445f.).
Voraussetzung dafür, dass ein Experteninterview zu validen Informationen führt, ist, dass der Experte zur Sache Auskunft geben kann und will. Dazu muss er die Rolle als Informant einnehmen, der
keine Informationen geheim hält;
keine irrelevanten Interna auspackt;
den Interviewer nicht als Ko-Experten ansieht, mit dem man ein Fachgespräch führt, sondern als Laien, dem das Expertenwissen verständlich erläutert werden muss;
den Interviewer nicht für die (strategische) Selbstdarstellung des eigenen Wissens missbraucht (vgl. Meuser / Nagel 1991: 449f.).
Unabhängig davon, ob das Leitfadeninterview mit Experten oder anderen Befragtengruppen geführt wird, können folgende Fragetypen unterschieden werden (vgl. Kvale / Brinkmann 2009: 134-138):
Grundlegend ist die Unterscheidung zwischen Schlüsselfragen und Eventualfragen: Schlüsselfragen sind zentral für die Forschungsfrage und werden, wenn auch nicht notwendigerweise im identischen Wortlaut, immer bzw. allen Befragten gestellt. Eventualfragen kommen dagegen nur zum Einsatz, [70]wenn der Befragte bestimmte Aspekte, von denen der Forscher ausgeht, dass sie relevant sein können, nicht von sich aus anspricht.
Einleitungsfragen: Sie sind nicht mit Eisbrecherfragen im standardisierten Interview zu verwechseln, sondern dienen der Einführung in ein Thema. Sie sollen spontane Antworten ermöglichen und offen formuliert sein. Es handelt sich also nicht um rein instrumentelle, sondern um inhaltsbezogene Fragen mit Informationswert für die Analyse. Da sie in jedem Interview gestellt werden, gehören sie zu den Schlüsselfragen, während alle folgenden Fragetypen Eventualfragen sind.
Folgefragen: Sie dienen dazu, die Erzählung des Befragten fortzusetzen. Dafür genügen oft kleine nonverbale Gesten, manchmal ist auch eine Nachfrage zu bestimmten Schlüsselwörtern in der Antwort des Befragten nötig.
Nachhaken: Diese Fragen dienen der Ergänzung der Antwort und der Ausweitung der Aspekte, die der Befragte in seiner Antwort angesprochen hat.
Spezifizierungsfragen: Damit wird der Befragte gebeten, seine allgemeinen Ausführungen zu konkretisieren und Beispiele zu schildern.
Direkte und indirekte Fragen: Der Interviewer kann bestimmte Fakten oder Sachverhalte direkt abfragen oder indirekt nach der Auffassung anderer Personen fragen.
Strukturierungsfragen: Wenn der Befragte zu sehr abschweift, muss der Interviewer durch überleitende Fragen den roten Faden des Gesprächs wiederherstellen.
Schweigen: Damit das Interview nicht zu einem quasi-standardisierten Frage-Antwort-Spiel wird, sollte der Interviewer Pausen einlegen, um dem Befragten genug Zeit zu geben, ausführlich zu antworten oder nachzudenken.
Interpretationsfragen: Um die Bedeutung von Antworten mit dem Befragten auszuhandeln, stellt der Interviewer auch Fragen, wie die Antwort zu interpretieren sei. Dabei kann er durchaus vermutete Bedeutungen ansprechen.
Vom Interviewer wird folglich eine immense Kompetenz zum Zuhören verlangt. Er wird nicht durch einen (standardisierten) Fragebogen entlastet, sondern muss flexibel auf die Gesprächssituation und die Antwort des Befragten reagieren. Seine Interpretationsfähigkeit ist nicht erst für die Auswertung, sondern bereits während des Interviews wichtig, um geeignete Nachfragen stellen zu können. Ein guter Interviewer ist sowohl Experte für das Sachthema des Interviews als auch für menschliche Interaktion schlechthin. Dabei muss er einfühlsam und offen sein, aber auch kritisch, um geeignete Nachfragen stellen zu können. Sein Erinnerungsvermögen muss ausreichen, um keine Fragen doppelt zu stellen und [71]flexibel Fragen umzustellen oder auszulassen, wenn sie schon durch die Antwort auf andere Fragen mitbeantwortet sind. Außerdem muss er das Gespräch in die vorgegebenen thematischen Bahnen zurückführen, wenn der Befragte allzu sehr abschweift. Um diese Mehrfachanforderung und Belastung bewältigen zu können, kann es sein, dass der Interviewer den Leitfaden als Schutz benutzt und ihn wie einen standardisierten Fragebogen abarbeitet. Auf diese Weise entsteht eine »Leitfadenbürokratie«, die der Offenheit des Leitfadeninterviews zuwiderläuft (vgl. Hopf 1978: 101f., 107ff.).
Ob der Interviewer alle Fragen stellt und in der vorgegebenen Reihenfolge, hängt von der Interviewsituation und den Antworten des Befragten ab. So kann es sein, dass der Befragte in seiner Antwort auf eine Frage bereits Aspekte anspricht, für die eine spätere Frage vorgesehen ist. Der Interviewer kann dann entweder den Befragten darauf hinweisen, dass zu diesem Aspekt eine spätere Frage gestellt wird; dies hat den Vorteil, dass das Gespräch besser strukturiert wird, aber den Nachteil, dass sich der Befragte möglicherweise gemaßregelt fühlt und weniger offen antwortet. Alternativ kann der Interviewer das Gespräch weiterlaufen lassen und diese spätere Frage dann aussparen, sofern der Befragte sie bereits im Rahmen der vorherigen Frage erschöpfend beantwortet hat. Dann muss der Interviewer sehr genau im Gedächtnis behalten, was bereits beantwortet ist.
Da kein Fragebogen vorliegt, auf dem die Antworten protokolliert werden, wird das Interview in der Regel auf Band aufgenommen. Für die Auswertung ist es sinnvoll, aber nicht zwingend, diese Aufnahme zu transkribieren. Bei der Auswertung werden die akustisch aufgezeichneten oder schriftlich transkibierten Rohtexte der Befragtenantworten in der Regel mittels qualitativer Inhaltsanalyse schrittweise abstrahiert und kategorisiert.
Im Unterschied zur Analyse des narrativen Interviews kommt es dabei in erster Linie auf die Informationen und Inhalte der Antworten und weniger auf die Erzählweise und die Sprache an. Insofern ist weder eine aufwändige Notation der Gespräche mit nonverbalen oder paraverbalen Kennzeichnungen und Beschreibungen noch eine konversationsanalytische Vorgehensweise bei der Auswertung notwendig. Auch können grammatische Besonderheiten der mündlichen Sprache oder dialektale Färbungen schriftsprachlich-hochdeutsch zur besseren Auswertbarkeit »geglättet« werden. Weicht das Gespräch phasenweise sehr weit vom Thema ab, sodass diese Stellen für den Informationsgehalt der Aussagen des Befragten irrelevant sind, muss das Transkript nicht einmal das vollständige Gespräch umfassen. Mittlerweile kann auch auf verschiedene Computersoftware zur qualitativen Analyse zurückgegriffen werden (vgl. Meuser / Nagel 1991: 455; Kuckartz 2010; Friese 2006).
[72]Die qualitative Inhaltsanalyse wird dadurch erleichtert, dass der Leitfaden bereits die thematischen Schwerpunkte markiert und die Fragen als Vorformulierungen der relevanten Kategorien dienen können, die in der Auswertung – meist modifiziert – aufgenommen werden (vgl. Meuser / Nagel 1991: 453f., 457ff., 462ff.; Mayring 2010; Gillham 2005: 129ff.; Gläser / Laudel 2010: 198ff.):
Dazu müssen in einem ersten Schritt die Antworten den Leitfragen zugeordnet werden. Dies ist nicht selbstverständlich gewählt wie im standardisierten Fragebogen gewählt, da die Befragten gelegentlich neben der gestellten Frage bereits Aspekte anderer Fragen mitbeantworten. Dieses erste Editieren des Transkripts verändert nichts an den Aussagen der Befragten, sondern sortiert diese nur neu. Sie kann auch hierarchisch erfolgen, indem die Antworten nicht nur den zugehörigen Fragen, sondern auch thematischen Einheiten oder Blöcken zugeordnet werden. Dies ist immer dann sinnvoll, wenn die Fragen kleinteiliger gestellt wurden und sich ihrerseits gut zusammenfassen lassen.
Nach dieser Sortierung werden die Antworten des Befragten paraphrasiert, indem der proportionale Gehalt der Aussagen extrahiert wird, ohne allerdings diese Inhalte voreilig zu klassifizieren, und Überschriften formuliert werden. Diese Überschriften verschiedener Interviews werden dann zur Kennzeichnung der behandelten Themen angeglichen, die entsprechenden Passagen der Gespräche aufgelistet und nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden sortiert. Bei der Bildung der Überschriften darf die Sequenzialität des Gesprächs im Unterschied zum narrativen Interview zerrissen werden. Sofern die Befragten nicht von selbst die Formulierungen aus den Leitfragen übernehmen, sollten die Überschriften aus den eigenen Formulierungen der Befragten gebildet werden. Diese thematischen Auswertungskategorien werden zu einem Leitfaden für die Codierung zusammengestellt.
Jedes Interview wird danach codiert, das heißt, die paraphrasierten Inhalte werden schrittweise zusammengefasst, konzeptionalisiert, klassifiziert und systematisiert. Während der vorangegangene Schritt eine Reduktion durch sprachliche Abstraktion vornimmt, wird in diesem Schritt die Reduktion als inhaltliche Abstraktion durchgeführt. Die Schlüsselfragen im Leitfaden bilden dabei die abstrakten Oberkategorien (Auswertungskategorien). Das Ziel der Codierung besteht nun darin, aus den konkreten Antworttexten geeignete Zwischenkategorien zu finden, die abstrakter sind als der Text selbst, aber konkreter (differenzierter) als die Oberkategorie. Wenn etwa in einer Frage nach dem Grund für ein bestimmtes Verhalten gefragt wird und die Befragten spezifische Gründe angeben, so würden mit der Codierung diese spezifischen Gründe zu Bündel, Gruppen oder Klassen von Gründen zusammengefasst.[73]Jedes Interview wird nach allen aus den Antworttexten induktiv gefundenen oder extrahierten Kategorien durchsucht. Textstellen, die zu mehreren Kategorien passen, werden gesondert markiert. Empfehlenswert ist ein konsensuelles Codieren, bei dem mehrere Codierer gleichzeitig codieren und bei Unterschieden Einigkeit herzustellen versuchen.
Ob quantifizierende Materialübersichten in tabellarischer Form erstellt werden sollen, hängt von der Fragestellung der Untersuchung und von der Größe der Stichprobe ab (mindestens 10 Befragte). Sie ist jedoch nicht Ziel der Auswertung, sondern allenfalls Vorbereitung der weiteren Analyse. Solche Tabellen mit den Ausprägungen der Kategorien machen – ähnlich wie bei der statistischen Analyse die Kreuztabelle – auf Zusammenhänge aufmerksam, die allerdings für jeden (Einzel-)Fall gesondert geprüft werden müssen.
Abschließend werden die Kategorisierungen theoretisch generalisiert, um neue Hypothesen zu bilden, die an jedem Einzelfall überprüft werden. Als methodische Hilfsmittel für die theoretische Generalisierung können wiederum Quantifizierungen behilflich sein, also ob eine Aussagen von mehr als einer Person gemacht wurde, ob es eine qualifizierte Minderheit, eine Mehrheit oder gar einen Konsens unter den Befragten gibt. Die Quantifizierung kann sich auch auf einzelne Befragte beziehen, wenn diese bestimmte Aussagen mehrfach sinngemäß wiederholt haben und damit implizit deren Wichtigkeit betonen. Hilfreich sind auch Hervorhebungen durch den Befragten, wenn bestimmte Aussagen verbal explizit als besonders wichtig herausgestellt werden oder wenn sie nonverbal besonders betont werden.
Jede dieser Stufen ist notwendig und revidierbar, sodass der Auswertungsprozess iterativ und rekursiv gehandhabt wird. Bei besonders elaborierten Analysen kann die Auswertung noch zwei weitere Schritte enthalten, für die das ebenfalls gilt, sofern sie Anwendung finden:
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.