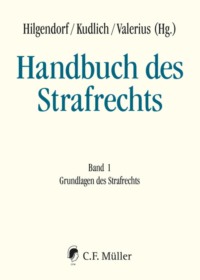Kitabı oku: «Handbuch des Strafrechts», sayfa 12
III. Demokratieprinzip
23
Das Demokratieprinzip des Art. 20 Abs. 1, 2 GG und die aus ihm im Verbund mit dem Rechtsstaatsprinzip entwickelten Grundsätze des Parlamentsvorbehalts[150] und der Wesentlichkeitstheorie[151] gelten ohne jede Einschränkung auch für die staatliche Strafgewalt. Es ist primär der unmittelbar demokratisch legitimierte Gesetzgeber, der aufgrund der sich wandelnden Wertvorstellungen in der Gesellschaft diejenigen individuellen oder kollektiven Rechtsgüter herausfiltern muss, die zum jeweiligen Zeitpunkt als so elementar angesehen werden, dass sie eines besonderen Schutzes durch das Strafrecht bedürfen.[152] Dabei ist der Gesetzgeber nicht durch vorpositive Wertungen gebunden.[153] Auch die strafrechtliche Rechtsgutslehre ist für den Gesetzgeber beim Erlass von Strafvorschriften nicht zwingend. Vielmehr kommt der Legislative bei der Einschätzung und Prognose der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohenden Gefahren sowie der Strafwürdigkeit eines bestimmten Verhaltens ein erheblicher Entscheidungs- und Beurteilungsspielraum zu.[154]
24
Das Demokratieprinzip befreit den Gesetzgeber allerdings nicht von den sonstigen verfassungsrechtlichen Bindungen. Das Strafrecht ist schon aufgrund seiner Freiheitsrelevanz kein beliebiges Instrument sozialer Steuerung, sondern eine rechtsstaatlich sensible Entscheidung über das rechtsethische Minimum des gesellschaftlichen Zusammenlebens.[155] Gerade wegen der besonderen Eingriffstiefe des Strafrechts etabliert das Grundgesetz mit dem nulla poena-Grundsatz in Art. 103 Abs. 2 GG eine Reihe von spezifischen rechtsstaatlichen Ausformungen, die sich nicht nur an den Rechtsanwender, sondern auch an die Legislative wenden. Darüber hinaus bleibt der Gesetzgeber bei der Schaffung von Straftatbeständen auf die objektive Werteordnung der Verfassung, die materiellen Grundrechte und das Verhältnismäßigkeitsprinzip verpflichtet.[156] Lediglich die sozial wichtigsten Interessen und Werte, die die freiheitliche demokratische Grundordnung ausmachen, bedürfen des strafrechtlichen Schutzes.[157] Dies gilt gerade auch in Fällen, in denen Strafvorschriften verfassungskonform ausgelegt werden.[158]
25
Keine Ausprägung des Demokratieprinzips, sondern vielmehr ein lediglich historisch begründbarer basisdemokratischer Gedanke gegen den früheren Inquisitionsprozess gemeinrechtlicher Prägung schlägt sich hingegen in der Mitwirkung von Laien an der Strafjustiz in Gestalt der Schöffen- und Schwurgerichte nieder.[159] Angesichts der verfassungsrechtlichen Verfestigung des demokratischen Rechtsstaats, der den Zugang zum Richterberuf nicht mehr ständisch beschränkt, sieht das Bundesverfassungsgericht die Laienbeteiligung im Strafverfahren zu Recht nicht als vom Grundgesetz geboten an.[160] Die Öffentlichkeit des Strafverfahrens (§ 169 GVG), die eine Kontrolle der Rechtspflege durch das Volk ermöglichen und damit den Missbrauch der Strafgewalt durch die Justiz verhindern soll, basiert neben dem Rechtsstaatsprinzip indes wohl auch auf demokratischen Überlegungen.[161]
IV. Sozialstaatsprinzip
26
Die staatliche Strafrechtspflege ist außerdem dem Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes verpflichtet.[162] Zur Aufgabe, eine soziale Strafrechtspflege zu verwirklichen, zählen etwa die Gewährleistungen gleichen Rechtsschutzes verschiedener Sozialgruppen, die Berücksichtigung der sozialen und finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten im Strafprozess,[163] die Fürsorgepflicht des Gerichts und die – lediglich von der Wahrheitspflicht begrenzte – Fürsprachepflicht des Verteidigers.[164] Auch die resozialisierende Einwirkung auf den zu Verurteilenden sowie auf den Verurteilten kann auf sozialstaatliche Forderungen zurückgeführt werden.[165] Damit soll das Übergewicht der staatlichen Machtmittel gegenüber dem Beschuldigten oder Angeklagten abgemildert werden.[166] Umgekehrt fordert das Sozialstaatsprinzip allerdings auch einen ausreichenden Opferschutz im Strafprozess und die Einbeziehung des Wiedergutmachungsgedankens.[167] Aus dem Sozialstaatsprinzip allein lassen sich zwar keine unmittelbaren subjektiven Rechte herleiten. Es enthält aber einen Gestaltungsauftrag an den Gesetzgeber und bindet den Richter im Rahmen der Gesetzesauslegung.[168]
V. Bundesstaatsprinzip
27
Föderale Einflüsse auf das Gebiet des Strafrechts sind demgegenüber kaum zu verzeichnen. Dies liegt vor allem daran, dass das Grundgesetz das Strafrecht dem Katalog der Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes in Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG zuweist. Zum Strafrecht zählt die „Regelung aller, auch nachträglicher, repressiver oder präventiver staatlicher Reaktionen auf Straftaten, die an die Straftat anknüpfen, ausschließlich für Straftäter gelten und ihre sachliche Rechtfertigung auch aus der Anlasstat beziehen“.[169] Unter Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG fallen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts neben dem Kriminalstrafrecht als sog. „zweite Spur“ die Maßregeln der Besserung und Sicherung[170] sowie das Therapieunterbringungsgesetz.[171] Auch das Ordnungswidrigkeitenrecht ist von Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG erfasst.[172] Darüber hinaus bezieht sich die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz grundsätzlich auch auf die Gerichtsverfassung und den Strafprozess.[173] Ausgenommen sind neben dem Polizeirecht, das allein der Prävention dient,[174] lediglich der Strafvollzug und der Untersuchungshaftvollzug, nicht aber die Strafvollstreckung, die dem Strafverfahren als Teil des gerichtlichen Verfahrens zugeordnet ist.[175]
28
Da der Bundesgesetzgeber von seiner Gesetzgebungskompetenz im Strafrecht, das in Bezug auf die Sperrwirkung des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Art. 72 Abs. 2 GG rechtsgutbezogen zu bestimmen ist,[176] nahezu vollständig Gebrauch gemacht hat, sind landesrechtliche Vorschriften randständig. Landesstrafrechtliche Normen spielen lediglich auf dem Gebiet des Presserechts und des Versammlungsrechts eine Rolle.[177] Der Bundesgesetzgeber darf aufgrund seiner Kompetenz sogar Landesrecht mit Strafe oder Bußgeld bewehren,[178] soweit und solange er die Kompetenz der Länder zur inhaltlichen Ausgestaltung des Landesrechts nicht beeinträchtigt.[179] Regeln Landesverfassungen das Strafverfahren, wie etwa Art. 88–91 der Verfassung des Freistaates Bayern, geht ihnen das Bundesrecht gemäß Art. 31 GG vor; Landesrecht kommt nur ausnahmsweise ergänzend in Betracht (vgl. § 6 EGStPO). Soweit Landesverfassungen prozessuale Grundrechte gewährleisten, bleiben sie nach Maßgabe des Art. 142 GG zwar in Kraft, können aber weder den Bundesgesetzgeber noch den Bundesgerichtshof binden.[180] Auch wenn Landesverfassungsgerichte Bundesgesetze (etwa die Strafprozessordnung) auslegen und anwenden,[181] verbleibt Raum für die Anwendung von Landesgrundrechten nur, soweit das Bundesrecht keine abschließende Regelung trifft und Spielräume belässt.[182] Für das bundesrechtlich geregelte Strafverfahren ist das Landesverfassungsrecht daher regelmäßig ohne jede Bedeutung.[183]
VI. Materielle Grundrechte
29
Art. 1 Abs. 3 GG, der die staatlichen Gewalten an den grundgesetzlichen Grundrechtsstandard bindet, gilt ohne jede Einschränkung auch für den Bereich des Strafrechts.[184] Daraus folgt zum einen, dass die staatliche Strafgewalt dem Schutz der Rechte des Individuums oder der Allgemeinheit zu dienen und so eine sich aus den Grundrechten des Staates ergebende Schutzpflicht des Staates zu verwirklichen hat.[185] Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Gesetzgeber verpflichtet wäre, Grundrechte Dritter oder der Gemeinschaft stets strafrechtlich zu sichern. Ganz im Gegenteil fordert einzig das absolute Pönalisierungsgebot des Art. 26 Abs. 1 S. 2 GG ein striktes Ergebnis ein; nur diese Norm etabliert einen unmittelbaren Verfassungsauftrag an den Strafgesetzgeber, die in der Vorschrift erfassten Verhaltensweisen unter Strafe zu stellen.[186] Im Übrigen erfasst die Schutzpflichtendogmatik lediglich relative Pönalisierungsgebote. Die Strafbewehrung obliegt der Einschätzungsprärogative und dem Ermessen des Gesetzgebers, der dabei allerdings an das Verhältnismäßigkeitsprinzip gebunden ist.[187] Auch das Bundesverfassungsgericht ist im Rahmen der Schutzpflichtendogmatik zurückhaltend und geht zu Recht nicht davon aus, dass aus einzelnen Grundrechten konkrete Regelungsaufträge oder gar Strafgebote hergeleitet werden können.[188] Jede andere Auffassung würde die Grundrechtsbindung des Staates und die freiheitssichernde, abwehrrechtliche Funktion der Grundrechte in ihr Gegenteil verkehren.[189] Aus diesem Grund wird eine immanente Schutzbereichsbegrenzung von Grundrechten durch strafbewehrte Verbotsnormen, wie dies vor allem in der älteren Literatur vertreten wurde,[190] heute nicht mehr verfochten.[191]
30
Zum anderen greift die staatliche Strafgewalt in vielfältiger Weise nicht nur durch den Erlass von Strafnormen und die Verhängung und Vollstreckung einer Strafe, sondern auch schon bei Ermittlung und Strafverfolgung in Grundrechte des Betroffenen ein.[192] Strafprozessuale Zwangsmaßnahmen sind durchweg mit einem – meist schwerwiegenden – Eingriff in Grundrechte verbunden.[193] Insofern dienen sowohl das materielle Strafrecht als auch das Strafverfahrensrecht als gesetzliche Ermächtigungen zum Eingriff in Grundrechte.[194] Allerdings unterliegt jeder gesetzliche Eingriff in Freiheitsrechte dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, ist also von rechtsstaatlichen Sicherungen nicht ausgenommen.[195] Außerdem folgt aus der Abwehrfunktion der Grundrechte, dass diese ihrerseits begrenzend auf die gesetzliche Eingriffsermächtigung wirken.[196] Lediglich unter bestimmten Voraussetzungen, zu denen vor allem die Disponibilität des Rechtsguts gehört, kann eine Beeinträchtigung von Grundrechten mit Einverständnis des Betroffenen schon auf der Schutzbereichsebene ausscheiden oder aber infolge einer Einwilligung des Rechtsgutsinhabers auf der Schrankenebene gerechtfertigt sein.[197] Ferner gelten Grundrechte, da ein besonderes Gewaltverhältnis mit gutem Recht nicht mehr angenommen wird,[198] auch im Strafvollzug.[199] Deshalb können etwa Zwangsdurchsuchungen von Gefangenen, die mit einer Entkleidung verbunden sind, als Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht nur gerechtfertigt sein, wenn sie der Sicherheit und Ordnung der Haftanstalt dienen und ausschließlich in Einzelfällen und in schonender Weise durchgeführt werden.[200]
31
Schließlich ist Grundrechtsschutz durch und im Strafverfahren zu verwirklichen.[201] Soweit sie nicht schon in der Strafprozessordnung ausdrücklich geregelt sind (etwa in § 136a Abs. 3 StPO), werden die sog. Beweisverwertungsverbote unmittelbar aus den Grundrechten abgeleitet.[202] Hier tritt der grundrechtliche Verfahrensbezug neben den objektivrechtlichen Aspekt des Rechtsstaates. Beide Komponenten führen zu einem Recht des Angeklagten auf ein faires Verfahren.[203] Auch die Fürsorgepflicht des Gerichtes lässt sich nicht nur als eine Emanation des Sozialstaatsprinzips, sondern auch als eine grundrechtlich fundierte verfahrensrechtliche Schutzpflicht verstehen.[204]
VII. Rechtsschutzgarantie
32
Die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG, wonach demjenigen, der durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird, der Rechtsweg offen steht, stellt eine „Grundsatznorm für die gesamte Rechtsordnung“[205] und eine besondere Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips dar.[206] Zur öffentlichen Gewalt im Sinne dieser Bestimmung gehören aber nicht Akte der Rechtsprechung.[207] Art. 19 Abs. 4 GG gewährt nur Schutz durch, nicht gegen den Richter.[208] Dies bedeutet, dass Art. 19 Abs. 4 GG keinen Instanzenzug garantiert.[209] Dementsprechend wurden über lange Zeit die Bestimmungen der Strafprozessordnung über die Anfechtbarkeit gerichtlicher Durchsuchungsanordnungen für mit Art. 19 Abs. 4 GG vereinbar erachtet. Dies galt insbesondere für diejenigen Fälle, wo die Durchsuchung bereits abgeschlossen war (sog. prozessuale Überholung).[210] Mittlerweile fordert das Bundesverfassungsgericht allerdings, dass auch richterlich angeordnete Ermittlungseingriffe, die sich typischerweise erledigen, bevor präventiver Rechtsschutz erlangt werden kann, einer eigenständigen nachträglichen gerichtlichen Kontrolle unterliegen.[211] Dies gilt vor allem deshalb, weil das Strafverfahren auf ein anderes Rechtsschutzziel gerichtet ist als die Überprüfung individueller Ermittlungsmaßnahmen aufgrund des Richtervorbehalts.
33
Darüber hinaus ist Art. 19 Abs. 4 GG im Kontext mit Art. 104 GG i.V.m. Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG zu sehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts besteht ein durch Art. 19 Abs. 4 GG geschütztes Rechtsschutzinteresse an der Fortführung oder Einlegung eines Rechtsmittels auch in Fällen fort, in denen sich das Rechtsschutzziel durch zwischenzeitliche Beendigung der angegriffenen Hoheitsmaßnahme erledigt hat, wenn es um einen tiefgreifenden Grundrechtseingriff geht.[212] Ein Freiheitsverlust durch Inhaftierung indiziert deshalb ein Rehabilitationsinteresse des Betroffenen, das ein von Art. 19 Abs. 4 GG umfasstes Rechtsschutzbedürfnis für die Feststellung der Rechtswidrigkeit auch dann begründet, wenn die Maßnahme erledigt ist. Diese Garantie kann weder vom konkreten Ablauf des Verfahrens und dem Zeitpunkt der Erledigung der Maßnahme noch davon abhängen, ob Rechtsschutz typischerweise noch vor Beendigung der Haft erlangt werden kann.[213] Außerdem hat Art. 19 Abs. 4 GG erhebliche Bedeutung für den Strafvollzug, denn diese Grundgesetzbestimmung verlangt Vorkehrungen dafür, dass der Einzelne staatliche Eingriffe nicht ohne fachgerichtliche Prüfung zu tragen hat.[214]
34
Des Weiteren garantiert Art. 19 Abs. 4 GG die Effektivität des Rechtsschutzes. Der Bürger hat einen substantiellen Anspruch auf eine wirksame gerichtliche Kontrolle.[215] Allerdings hält das Bundesverfassungsgericht es grundsätzlich für nicht geboten, die Einleitung und Führung eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens vor Abschluss der Ermittlungen gerichtlicher Kontrolle zu unterwerfen. Die Rechtsschutzgarantie verlange nur Rechtsschutz zur „rechten Zeit“, weshalb ein Zuwarten dem Beschuldigten bis zur Entschließung der Staatsanwaltschaft nach § 170 StPO in der Regel zuzumuten sei.[216] Ausnahmen dürften allerdings bestehen, wenn der Beschuldigte durch das gegen ihn geführte Erkenntnisverfahren als solches bereits eine grundrechtliche Einbuße (etwa an gesellschaftlichem Ansehen) erfährt, die im weiteren Verfahren, selbst wenn es zu einer Einstellung oder einem Freispruch kommt, nicht mehr folgenlos ausgeräumt werden kann.
VIII. Beschleunigungsgebot
35
Das Gebot effektiven Rechtsschutzes enthält implizit auch die Pflicht zur Gewährung von Rechtsschutz innerhalb angemessener Zeit.[217] Dabei ist die Angemessenheit der Dauer eines Verfahrens nach den besonderen Umständen des Einzelfalles zu bestimmen.[218] Die Pflicht zu Beschleunigung leitet das Bundesverfassungsgericht jedoch nicht aus der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG, sondern unmittelbar aus den Freiheitsgrundrechten[219] oder – unter Rückgriff auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK, der die Angemessenheit der Frist sogar ausdrücklich statuiert – dem allgemeinen Rechtsstaatsprinzip her.[220] Speziell für Haftsachen ist die Beschleunigungspflicht in Art. 104 Abs. 3 S. 2 GG verankert; §§ 163 Abs. 2, 229 Abs. 1, 2 StPO greifen dieses verfassungsrechtliche Gebot auf der einfachgesetzlichen Ebene auf. Auch weitere Einzelvorschriften der StPO dienen der Verfahrensbeschleunigung (z.B. §§ 115, 121 f., 128 f., 228 f. StPO). Im Strafprozess besteht im Allgemeinen ein erhebliches Interesse an einer raschen Strafrechtspflege, da sie in Grundrechte des Beschuldigten empfindlich eingreift und die Güte der Beweismittel, vor allem die Erinnerungskraft der Zeugen, im Laufe der Zeit abnimmt.[221] Ferner steht das Beschleunigungsgebot im öffentlichen Interesse an zügiger Wiederherstellung des Rechtsfriedens.[222]
36
Die Rechtsfolgen einer durch Verfahrensverzögerung veranlassten überlangen Verfahrensdauer waren über lange Zeit umstritten. So führte nach der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Verfahrensverzögerung nicht zu einem Verfahrenshindernis, sondern war lediglich bei der Strafzumessung oder einem späteren Gnadenerweis zu berücksichtigen.[223] Diese Judikatur fand im Grundsatz die Billigung des Bundesverfassungsgerichts.[224] Lediglich in Extremfällen komme von Verfassungs wegen ein Verfahrenshindernis in Betracht.[225] Demgegenüber sah der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zwar eine Strafmilderung als prinzipiell adäquates Mittel als Reaktion auf überlange Verfahren an,[226] hielt es jedoch für unzureichend, wenn der Betroffene bei Verletzung des Beschleunigungsgebotes nur in den Genuss eines besonderen Strafmilderungsgrundes komme.[227] Die Konventionsstaaten seien aus Art. 6 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Art. 13 EMRK außerdem verpflichtet, eine Rechtsbehelfsgarantie zur Beschleunigung des Verfahrens und zur Sicherung fristgerechter Gerichtsentscheidungen bereitzuhalten.[228] Deshalb forderte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Bundesrepublik Deutschland mehrfach nachdrücklich dazu auf, einen wirksamen Rechtsbehelf gegen überlange Gerichtsverfahren zu schaffen.[229] Diese Mahnung nahm der Große Senat für Strafsachen zum Anlass, die bisherige Strafzumessungslösung durch eine Vollstreckungslösung zu ersetzen, die für den Fall der vom Staat zu vertretenden Verfahrensverzögerung vom Tatrichter verlangt, zum Zwecke der Kompensation der hierin liegenden Verletzung von Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK einen numerisch bestimmten Teil der verhängten Strafe für verbüßt zu erklären.[230] Daneben seien in außergewöhnlichen Fällen auch Verfahrenshindernisse als Folge überlanger Verfahrensdauer in Betracht zu ziehen.[231] Auch wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die mittlerweile in alle Prozessordnungen eingeführte kompensatorische Verzögerungsrüge[232] prinzipiell als sinnvollen und wirksamen Rechtsbehelf ansieht,[233] unterstreicht er in seiner jüngsten Judikatur erneut, dass es in Verfahren, in denen sich die Untätigkeit von Behörden oder Gerichten auf das Privatleben des Betroffenen auswirke, eines Rechtsbehelfs bedürfe, der verfahrensbeschleunigende Wirkungen entfalte.[234]
37
Für ablehnende Gnadenentscheidungen soll Art. 19 Abs. 4 GG nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht gelten, da das Begnadigungsrecht gemäß Art. 60 Abs. 2 GG lediglich eine Befugnis begründe, dort helfend und korrigierend einzugreifen, wo die Möglichkeiten des formalisierten Gerichtsverfahrens nicht genügten.[235] Demgegenüber betonen Teile des Schrifttums, dass eine Gnadenentscheidung nicht von der Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung ausgenommen sei, da Art. 19 Abs. 4 GG auf alle Hoheitsakte exekutiver Natur Anwendung finde.[236] Allerdings beschränke sich die gerichtliche Kontrolle von Gnadenentscheidungen auf eine Verfahrens- und Willkürprüfung.[237]
1. Abschnitt: Das Strafrecht im Gefüge der Gesamtrechtsordnung › § 2 Verfassungsrechtliche Vorgaben für das Strafrecht › C. Justizgrundrechte als besondere verfassungsrechtliche Einzelgarantien
C. Justizgrundrechte als besondere verfassungsrechtliche Einzelgarantien
I. Recht auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG)
38
Das in Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG verbriefte Recht auf den gesetzlichen Richter soll die Bestimmtheit und die Vorhersehbarkeit des zuständigen Richters garantieren und „der Gefahr vorbeugen, dass die Justiz durch Manipulation der rechtsprechenden Organe sachfremden Einflüssen ausgesetzt wird“.[238] Dabei ist unerheblich, von welcher Seite die Manipulation ausgeht; die Vorschrift richtet sich sowohl an die Gesetzgebung und die Verwaltung als auch an die Rechtsprechung selbst.[239] Insgesamt will die Garantie des gesetzlichen Richters als besondere Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips die Unabhängigkeit der Rechtsprechung wahren und das Vertrauen in die Unparteilichkeit und Sachlichkeit der Gerichte sichern.[240] Insoweit steht Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG in enger Verbindung mit der richterlichen Unabhängigkeit nach Art. 97 GG, die für alle staatlichen Gerichte gilt und einen unverzichtbaren Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips bildet.[241] Außerdem folgt aus dem Recht auf den gesetzlichen Richter das Verbot von Ausnahmegerichten, also solcher Gerichte, die in Abweichung von der gesetzlichen Zuständigkeit besonders gebildet und zur Entscheidung individueller Fälle berufen sind (Art. 101 Abs. 1 S. 1 GG).[242] Ferner ergibt sich aus der Norm das Erfordernis, Gerichte für besondere Sachgebiete gesetzlich zu errichten (Art. 101 Abs. 2 GG).
39
Gesetzlicher Richter i.S.d. Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG sind das Gericht als organisatorische Einheit oder das erkennende Gericht als Spruchkörper und die zu Entscheidung im Einzelfall berufenen Richter.[243] Die Bestimmung des Richters muss sich von vornherein möglichst eindeutig aus einem Parlamentsgesetz ergeben.[244] Hinzutreten müssen Geschäftsverteilungspläne der Gerichte, die im Vorhinein eine abstrakt-generelle Zuständigkeitsregelung im Rahmen des gesetzlich vorgesehenen Rahmens treffen und Spielräume möglichst vermeiden.[245] Besetzungsfehler stellen deshalb einen absoluten Revisionsgrund i.S.d. § 338 Nr. 1 StPO dar.
40
Im Blick auf den grundrechtsähnlichen Charakter des Rechts auf den gesetzlichen Richter müssen die fundamentalen Zuständigkeitsregeln durch förmliches Gesetz erlassen werden.[246] Bei grundrechtsrelevanten Regelungen muss der Gesetzgeber nach der Wesentlichkeitstheorie die wesentlichen Entscheidungen selbst treffen und darf sie nicht anderen Gewalten, etwa den Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichten, überlassen.[247] Daher begegnen die sog. beweglichen Gerichtsstände im Strafprozess (z.B. § 24 Abs. 1 Nr. 3, § 74 Abs. 1 S. 2 GVG) – entgegen der Ansicht des Bundesverfassungsgerichts[248] – verfassungsrechtlichen Bedenken, da sie der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit eröffnen, unter mehreren zuständigen Gerichten zu wählen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Gesetz der Anklagebehörde ein echtes Wahlrecht (Ermessen) bei Vorliegen mehrerer zuständiger Gerichte einräumt, in denen die Gerichtsstände des Tatorts, des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes und des Ergreifungsortes gleichwertig nebeneinanderstehen und das Gesetz keine Kriterien für die Ermessensentscheidungen enthält.[249] Freilich begründet nicht schon jeder error in procedendo, sondern lediglich eine willkürlich unrichtige Anwendung der Zuständigkeits- und Verfahrensregeln einen Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG.[250]
41
Auch Ausschließung und Ablehnung von Gerichtspersonen aus Gründen der Befangenheit zählen zu den Ausprägungen von Art. 97 und Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG;[251] sie sind einfachgesetzlich in §§ 22 ff. StPO niedergelegt. Sämtlichen Vorschriften liegt der Gedanke zugrunde, dass ein Richter (Berufs- oder Laienrichter), gegen dessen Unvoreingenommenheit in einem bestimmten Verfahren Bedenken bestehen, im Interesse der Prozessbeteiligten wie auch zur Erhaltung des Vertrauens in die Unparteilichkeit der Rechtspflege in diesem Verfahren keine Entscheidungen treffen darf.[252]