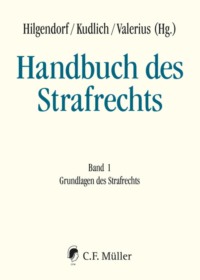Kitabı oku: «Handbuch des Strafrechts», sayfa 11
III. Normenhierarchie und Gewaltenverschränkung
10
Ungeachtet der inzwischen nicht mehr zu übersehenden europa- und völkerrechtlichen Implikationen richtet sich der Auftrag zur Konkretisierung der verfassungsrechtlichen Garantien im Strafrecht freilich nach wie vor zuvörderst an den durch Volkswahl unmittelbar demokratisch legitimierten Gesetzgeber. In zweiter Linie obliegt es den Fachgerichten, die verfassungsrechtlichen Gewährleistungen in den vom Gesetz gezogenen Grenzen bei der ihnen obliegenden Rechtsauslegung und -anwendung zu aktualisieren und weiterzuentwickeln.[54] Als (letztverbindlicher) „Hüter der Verfassung“[55] ist schließlich das Bundesverfassungsgericht dazu aufgerufen, den Gesetzgeber und die Rechtsprechung der Strafgerichte anhand der im Grundgesetz niedergelegten Maßstäbe zu kontrollieren.[56] Insoweit nimmt das Bundesverfassungsgericht auch eine bedeutende materielle Konkretisierungsfunktion wahr, indem es die verfassungsrechtlichen Gewährleistungen auslegt und unter Umständen Korrekturen oder Spezifikationen durch den Gesetzgeber anregt.[57]
11
Die Mitwirkung des Bundesverfassungsgerichts an der Aktualisierung der verfassungsrechtlichen Direktiven und Gebote steht in einem Spannungsverhältnis zu den Aufgaben des Gesetzgebers, dem die Aufgabe der Ausgestaltung des Systems der staatlichen Strafgewalt zukommt und der dabei über einen weiten Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum verfügt.[58] Deshalb muss die Kontrolldichte des Bundesverfassungsgerichts zurückgenommen sein. Eine zu strikte Einzelkontrolle oder eine zu weitgreifende verfassungskonforme Auslegung einfacher Gesetze läuft nicht nur Gefahr, den Aufgaben- und Kompetenzkanon der ersten Gewalt empfindlich zu beschränken, sondern auch strafrechtliche und strafverfahrensrechtliche Zusammenhänge fehlerhaft zu deuten oder die dogmatische Geschlossenheit des Strafrechts zu unterminieren.[59] Dementsprechend enthält die Verfassung nur Mindestgarantien und trifft lediglich unverzichtbare elementare Vorgaben für die staatliche Strafgewalt. Diese gehen jedoch nach ihrem Wortlaut, ihrem Geltungsgrund und ihrem Telos den gesetzlichen Ordnungen des Strafrechts, des Strafprozesses und der Strafvollstreckung eindeutig vor.[60] Da die Tätigkeit der staatlichen Strafgewalt in höchstem Maße grundrechtsrelevant ist, muss vom Verfassungsrecht ein überformender Einfluss auf das einfache Recht ausgehen.[61] Mit anderen Worten sind objektiv-rechtliche Wertedetermination und Ausstrahlungswirkung des Verfassungsrechts für das Strafrecht schlechthin systembildend.[62] In der Rechtspraxis bleibt allerdings entscheidend, dass das Bundesverfassungsgericht bei der Wahrnehmung der ihm obliegenden Kontrollfunktion die funktionell-rechtliche Vorrangstellung des Gesetzgebers respektiert und insbesondere bei der Frage nach der Zwecktauglichkeit von Strafgesetzen die gebotene Zurückhaltung walten lässt, ohne dabei zugleich die grundlegenden rechtsstaatlichen Anforderungen der Verfassung zu übergehen.[63] Parlamentarisch-demokratische Verantwortung und verfassungsgerichtliche Kontrolle sind letztlich gemeinsam dazu aufgerufen, in komplementärer Wechselwirkung und unter Einbeziehung auch internationaler menschenrechtlicher Mindeststandards zur Verwirklichung und Weiterentwicklung der verfassungsrechtlichen Vorgaben gegenüber dem materiellen Strafrecht und dem Strafverfahrensrecht beizutragen.[64]
1. Abschnitt: Das Strafrecht im Gefüge der Gesamtrechtsordnung › § 2 Verfassungsrechtliche Vorgaben für das Strafrecht › B. Staatsstrukturprinzipien und grundlegende allgemeine Verfassungsgebote
B. Staatsstrukturprinzipien und grundlegende allgemeine Verfassungsgebote
I. Achtung der Menschenwürde
12
Der Höchstwert der Verfassung, die Garantie der Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG, ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu einer „Magna Charta“ grundlegender Bindungen der staatlichen Strafgewalt geworden.[65] Im gesamten Bereich des materiellen und prozessualen Strafrechts verlangt die Achtung der Menschenwürde, dass der Beschuldigte oder Täter keinesfalls zum bloßen Objekt der Verbrechensbekämpfung oder Strafvollstreckung werden darf.[66] Daher haben zahlreiche und tragende verfassungsrechtliche wie einfachgesetzliche Einzelgewährleistungen ihre tiefere Wurzel in der Menschenwürdegarantie, so insbesondere der Schuldgrundsatz (nulla poena sine culpa),[67] das Folter- und Missbrauchsverbot (Art. 104 Abs. 1 S. 2 GG, § 136a StPO), das Verbot der Todesstrafe (Art. 102 GG), das Verbot grausamer oder grob unangemessener Bestrafung,[68] das Recht auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) und das Gebot einer menschenwürdigen Ausgestaltung des Freiheitsentzugs, die eine Verpflichtung zur Resozialisierung einschließt.[69] Bei lebenslanger Freiheitsstrafe verlangt die Menschenwürdegarantie die konkrete und grundsätzlich realisierbare Chance des Verurteilten auf Wiedererlangung der persönlichen Freiheit.[70] Auch das Schweigerecht des Beschuldigten wird als Ausdruck der Achtung vor der Menschenwürde angesehen.[71] Die Unantastbarkeit des „Kernbereichs privater Lebensgestaltung“ bei modernen Ermittlungsmaßnahmen wie der Überwachung der Telekommunikation und des Wohnraums hat das Bundesverfassungsgericht ebenfalls mehrfach unterstrichen.[72] Sogar in Fällen mit extraterritorialem Bezug zieht der Menschenwürdevorbehalt des Grundgesetzes der Vollstreckung einer im Ausstellungsstaat erfolgten Verurteilung in absentia im Vollstreckungsstaat Grenzen.[73]
II. Rechtsstaatsprinzip und seine wesentlichen
strafrechtsrelevanten Emanationen
13
In nicht weniger gewichtigem Ausmaß stellt das Rechtstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG eine zentrale Leitlinie für die Ausübung von Strafgewalt dar. Es umfasst als eine der Leitideen des Grundgesetzes die Forderung nach materieller Gerechtigkeit und schließt den Grundsatz der Rechtsgleichheit als eines der grundlegenden Gerechtigkeitspostulate ein.[74] Aus dem Rechtsstaatsprinzip erwächst für den Bereich der Strafrechtspflege eine Reihe von Einzelgewährleistungen, denen ebenfalls Verfassungsrang zukommt, wie etwa die Unschuldsvermutung,[75] die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit[76] und des Willkürverbots,[77] die justizförmige Verfahrensstrenge[78] sowie die Garantie effektiven Rechtsschutzes und das Verbot überlanger Verfahrensdauer.[79] Auch das Legalitätsprinzip, nach dem der Gesetzgeber die Voraussetzungen strafrechtlicher Verfolgung selbst bestimmen muss und nicht den Strafverfolgungsbehörden die Entscheidung im Einzelfall überlassen darf,[80] folgt nicht nur aus dem Demokratieprinzip und dem Gewaltenteilungsgrundsatz, sondern gerade auch aus dem Rechtsstaatsprinzip.[81] Darüber hinaus wirkt das Rechtstaatsprinzip als Auslegungsdirektive bei der Anwendung konkreter gesetzlicher Vorschriften.[82] Als übergreifender allgemeiner Rechtsgrundsatz steuert es die Ausübung der gesamten Strafgewalt.[83] Dem Rechtsstaatsprinzip kommt daher sogar bei Auslegung und Anwendung anderer – normhierarchisch gleichrangiger – strafrechtsrelevanter Verfassungsbestimmungen eine ergänzende und absichernde Funktion zu.[84]
1. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
14
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der überwiegend aus dem Gebot der Rechtsstaatlichkeit abgeleitet wird,[85] ist zur Feststellung der Verfassungskonformität strafrechtlicher und strafverfahrensrechtlicher Bestimmungen und ihrer Anwendung von überragender Wichtigkeit.[86] Speziell für das Strafrecht bedeutet das Verhältnismäßigkeitsprinzip nämlich, dass sowohl jede normative Strafbewehrung als auch jede auf dieser Grundlage verhängte Strafe oder Maßnahme, die in Freiheitsrechte des Beschuldigten eingreift, zur Erreichung des angestrebten legitimen Zwecks geeignet und erforderlich sein muss und außerdem nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache und zur Stärke des bestehenden Tatverdachtes oder der ermittelten Schuld stehen darf.[87]
15
Auf einer ersten Stufe bindet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz den Gesetzgeber, der darüber Rechnung legen muss, dass die Schaffung oder Änderung einer materiellen Strafrechtsnorm dem verfassungsrechtlich legitimen Schutz von Rechtsgütern Dritter oder der Allgemeinheit dient sowie erforderlich und angemessen ist.[88] Zwar verfügt der Gesetzgeber wegen seiner unmittelbaren demokratischen Legitimation über einen erheblichen Beurteilungsspielraum bei der Zweckbestimmung und der Geeignetheit des Mittels, der der verfassungsgerichtlichen Kontrolle weitgehend entzogen ist.[89] Eine absolute Grenze besteht nur dort, wo die Verfassung selbst die Verfolgung eines bestimmten Zwecks von vornherein ausschließt.[90] Allerdings darf auch unterhalb dieser Grenzlinie nicht jeder beliebige zivil- oder verwaltungsrechtliche Verstoß unter Strafandrohung gestellt werden. Das materielle Strafrecht muss sich auf die Sanktion schwerwiegender Beeinträchtigungen von verfassungsrechtlich legitimen Rechtsgütern des Einzelnen oder der Allgemeinheit konzentrieren.[91] Dazu können auch „großflächige“ Rechtsgüter wie die Umwelt oder das Kreditwesen gehören, die wesentliche Gemeinschaftsinteressen schützen.[92] Ein bloß moralwidriges Verhalten kann eine Strafvorschrift aber nicht legitimieren.[93] Unter anderem deshalb ist der Beschluss zur Strafbarkeit des Geschwisterbeischlafs, in dem sich das Bundesverfassungsgericht gegen eine Verfassungswidrigkeit des § 173 Abs. 2 S. 2 StGB ausgesprochen hat,[94] umstritten geblieben. Insbesondere die Begründung, dass die Strafbarkeit des Geschwisterinzests dem Schutz von Ehe und Familie, der sexuellen Selbstbestimmung und der Verhinderung erbkranken Nachwuchses diene,[95] ist in der Literatur vielfach auf Widerspruch gestoßen. Die genannten Verfassungsrechtsgüter seien, wie die Vermeidung von Erbkrankheiten, entweder nicht existent oder, in Bezug auf den Schutz von Ehe und Familie und das sexuelle Selbstbestimmungsrecht, bei einem einvernehmlichen geschwisterlichen Beischlaf nicht berührt.[96] Freilich hat auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Strafbewehrung des Geschwisterinzests keine Einwände erhoben, sondern auf den „margin of appreciation“ der Konventionsstaaten abgestellt.[97]
16
Unter dem Blickwinkel des Verhältnismäßigkeitsprinzips ebenfalls nicht unproblematisch sind Erweiterungen des Kreises derjenigen Rechtsgüter, die unter strafrechtlichen Schutz gestellt werden. So ist fraglich, ob der „Schutz der Integrität des Sports“, der als neu entwickeltes kollektives Rechtsgut dem Antidopinggesetz von 2015 zugrunde liegt,[98] tatsächlich eine Strafbewehrung erfordert.[99] Jedenfalls werfen Rechtsgüterschutzerweiterungen grundsätzliche Bedenken im Blick auf die verfassungsrechtliche Erforderlichkeitsprüfung auf, wonach der Gesetzgeber das mildeste Mittel zur Erreichung des legitimen Rechtsgüterschutzes einzusetzen hat.[100] Insoweit ergeben sich Überschneidungen mit dem strafrechtlichen ultima ratio-Prinzip, wonach Strafe nur die letztmögliche staatliche Reaktion auf sozialschädliches Verhalten sein darf.[101] Die Überlappungen zwischen Verfassungsrecht und Strafrecht gehen allerdings nicht so weit, dass der strafrechtliche ultima ratio-Gedanke mit der verfassungsrechtlichen Erforderlichkeitsprüfung identisch wäre. Nach dem strafrechtsdogmatischen Subsidiaritätsprinzip dürfen Straftatbestände erst geschaffen werden, wenn andere Rechtsmittel zur Wiederherstellung der verfassungsrechtlichen Friedens- und Werteordnung nicht verfangen.[102] Dies gilt nicht nur im Blick auf die Frage, ob zivil- oder verwaltungsrechtliche Ausgleichspflichten gegebenenfalls hinreichend wirksam sind, um den sozialen Frieden wiederherzustellen,[103] sondern auch im Verhältnis zum Ordnungswidrigkeitenrecht, das zwar kein aliud zu einer Straftat ist, aber doch eine leichtere Deliktsart mit geringem Unrechts- und Schuldgehalt darstellt.[104] Die bundesverfassungsgerichtliche Judikatur ist demgegenüber weniger strikt und gesteht dem Gesetzgeber eine Entscheidungsprärogative im Blick auf die „Wahl zwischen mehreren potentiell geeigneten Wegen zur Erreichung eines Gesetzesziels“ zu.[105] Zwar zieht das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit dem Erforderlichkeitsmaßstab regelmäßig auch einen Vergleich zu anderen, nichtstrafrechtlichen Schutzinstrumenten und Schutzkonzepten.[106] Gleichwohl soll das Strafrecht kein subsidiäres Mittel sein, das erst zur Anwendung kommen dürfe, wenn Maßnahmen des übrigen Rechts versagten.[107] Damit relativiert das Bundesverfassungsgericht den ultima ratio-Gedanken und überlässt ihn weitgehend dem Feld der Kriminalpolitik.[108] Lediglich in (umgekehrten) Fällen, in denen es um den Schutz grundlegender Verfassungsrechtsgüter geht, stellt das Gericht klar, dass es aufgrund des verfassungsrechtlichen Untermaßverbotes nicht ohne weiteres möglich sein soll, auf das Strafrecht und die davon ausgehenden Schutzwirkungen zu verzichten. Der Kernbereich sozialethischer Vorwerfbarkeit, insbesondere beim elementaren Rechtsgüterschutz, müsse dem Strafrecht vorbehalten bleiben.[109] Deshalb würde der Gesetzgeber etwa durch die Herabstufung der fahrlässigen Tötung zur bloßen Ordnungswidrigkeit gegen seine Schutzpflicht für das menschliche Leben nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG und das daraus folgende Untermaßverbot verstoßen.[110]
17
Während dem Gesetzgeber auf den Ebenen der Geeignetheit und Erforderlichkeit von Strafgesetzen mithin eine nicht unerhebliche Einschätzungsprärogative zusteht, die nur begrenzt justiziabel ist,[111] nimmt das Bundesverfassungsgericht für sich in Anspruch, die dritte Stufe der Verhältnismäßigkeit in vollem Umfang zu prüfen.[112] Die verfassungsrechtliche Angemessenheitsprüfung (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne) verlange, dass bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Grundrechtseingriffs und dem Gewicht sowie der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit für die Adressaten des Verbots gewahrt sein müsse.[113] Darüber hinaus müssten die Schwere einer Tat und das Verschulden des Täters zu der Strafe zueinander in einem angemessenen Verhältnis stehen.[114] Insgesamt müssen Straftatbestand und Rechtsfolge also sachgerecht aufeinander abgestimmt sein und das Übermaßverbot wahren, das einen engen Zusammenhang mit dem strafrechtlichen Schuldprinzip aufweist.[115] In Anbetracht dessen stehen sich – entgegen der Annahme des Bundesverfassungsgerichts[116] – strafrechtliche Rechtsgutslehre[117] und Verfassungsrecht jedenfalls auf der Ebene der Angemessenheitsprüfung nicht von vornherein unversöhnlich gegenüber.[118]
18
Auf einer zweiten Stufe ist jede strafrechtliche Einzelmaßnahme anhand des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu überprüfen. Nicht zuletzt im Sinne einer Verwirklichung von Einzelfallgerechtigkeit ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als ausgleichendes und individualisierendes Moment bei der richterlichen Entscheidung erforderlich.[119] Dies spiegelt auch das einfache Recht wider, etwa in §§ 62, 74f Abs. 1 StGB, §§ 112 Abs. 1 S. 2, 163b Abs. 2 S. 2 StPO. Insbesondere bei Freiheitsbeschränkungen und -entziehungen ist das Übermaßverbot strikt zu beachten.[120] Beispielsweise ist die Ungehorsamshaft gegen den ausbleibenden Angeklagten (§ 230 Abs. 2 StPO) unverhältnismäßig, wenn die Erwartung gerechtfertigt ist, dass er zum angesetzten Termin erscheinen wird.[121] Bei Anordnung und Vollzug der Untersuchungshaft muss eine detaillierte Abwägung zwischen dem Freiheitsgrundrecht des Inhaftierten und dem Strafverfolgungsinteresse der Allgemeinheit vorgenommen werden,[122] wobei mit zunehmender Dauer der Untersuchungshaft sich das Gewicht des Freiheitsanspruchs gegenüber dem Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung vergrößert.[123] Auch die Sicherungsverwahrung und die Unterbringung nach dem Therapieunterbringungsgesetz unterliegen strikten Verhältnismäßigkeitsanforderungen, insbesondere im Blick auf die Anforderungen an die Gefahrenprognose und die gefährdeten Rechtsgüter.[124]
2. Objektives Willkürverbot
19
Wiewohl es dem Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG entsprungen ist, fußt auch das strafrechtliche Willkürverbot vor allem im Rechtsstaatsprinzip.[125] Denn der in Art. 3 Abs. 1 GG enthaltene Gleichheitssatz wird in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in strafrechtlichen Fällen vom hergebrachten Willkürmaßstab verselbstständigt und von dem sonst üblichen konkreten Vergleich zweier Normadressaten gelöst.[126] Es geht also nicht darum, ob verschiedene Sachverhalte gleich oder ungleich behandelt werden, sondern ob eine Entscheidung, insbesondere die Auslegung einer Strafnorm durch den Richter, als solche und für sich allein betrachtet, schlechthin nicht mehr verständlich ist.[127] Dabei führt freilich nicht jeder Fehler in der Rechtsanwendung bereits zu einer Verletzung des verfassungsrechtlichen Willkürverbots. Auslegung und Anwendung einfachgesetzlicher Vorschriften obliegen den zuständigen Fachgerichten und sind der Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich entzogen.[128] Sind aber Rechtsauslegung und -anwendung eklatant fehlerhaft und drängt sich bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz beherrschenden Prinzipien der Schluss auf, dass sie auf sachfremden Erwägungen beruhen, greift der objektive Willkürschutz ein.[129] Auch dies zeigt, dass die Annahme von Willkür nicht auf eine für die Anwendung von Art. 3 Abs. 1 GG notwendige Vergleichsgruppe, sondern auf den konkreten Anwendungsfall und auf rechtsstaatliche Maximen bezogen ist.[130]
3. Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege
20
Auch das vom Bundesverfassungsgericht in Bezug auf die Einräumung von Aussageverweigerungsbefugnissen aus beruflichen Gründen erstmals entwickelte Postulat der Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen Strafrechtspflege[131] hat seinen maßgeblichen Geltungsgrund im Rechtsstaatsprinzip.[132] Nach Ansicht des Gerichts ist die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege erforderlich, um der materiellen Gerechtigkeit als wesentlichem Bestandteil der Rechtsstaatlichkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Darüber hinaus verpflichteten die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und des Gewaltmonopols den Staat, die Sicherheit seiner Bürger und deren Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit der staatlichen Institutionen zu schützen.[133] Auch die Gleichbehandlung aller im Strafverfahren Beteiligten und die gleichmäßige Verwirklichung und Durchsetzung bestehender Normen erforderten grundsätzlich die Durchsetzung des staatlichen Strafanspruches.[134] Daneben ergibt sich aus institutioneller Sicht der Einrichtung der Strafrechtspflege das Gebot ihres Funktionierens, also der effizienten wie effektiven Aufgabenausübung.[135]
21
Das Prinzip der Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege steht in einem delikaten Spannungsverhältnis zu den Freiheitsrechten des Beschuldigten.[136] In einem Rechtsstaat darf die Ausübung von Strafgewalt nie um ihrer selbst oder allein um ihrer Effektivität willen geschehen.[137] Sie kann vielmehr nur in Abwägung mit kollidierenden Belangen verstanden und umgesetzt werden. Das Gebot der Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege hat dem aus der Schutzpflichtendogmatik entwickelten Untermaßverbot zu folgen und darf keinesfalls als ein Optimierungsgebot verstanden werden.[138] Deshalb darf der Topos von der Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege nicht zur Relativierung grundrechtlicher Verbürgungen und rechtsstaatlicher Justizförmigkeit eingesetzt werden.[139] Von vornherein unübersteigbar ist die absolute Mindestgewährleistung des Art. 1 Abs. 1 GG.[140] Aber auch in anderen grundrechtsrelevanten Konstellationen müssen materielles Strafrecht und Strafverfolgung die verfassungsmäßig verbürgten Rechte des Betroffenen wahren und sich an das Konzept der Formalisierung des Strafverfahrens halten.[141]
22
Demensprechend ist das Grundgesetz auch nicht offen für die Etablierung eines neben das allgemeine Strafrecht tretenden besonderen „Feindstrafrechts“, wonach der Rechts- und Verfassungsordnung feindselig gegenüberstehenden Straftätern, etwa Terroristen, der Schutz der Grundrechte vorenthalten werden könnte.[142] Art. 18 GG macht exemplarisch deutlich, dass das Grundgesetz auch den „Verfassungsfeind“ nicht „hors de la loi“ stellt,[143] sondern allenfalls die in einem rechtsstaatlichen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht auszusprechende Verwirkung bestimmter Grundrechte kennt.[144] Will der Rechtsstaat seine Kernidentität wahren, darf er sich unter keinen Umständen, auch nicht gegenüber seinen „Feinden“, der Last entledigen, Grundrechtseingriffe nach Maßgabe des Übermaßverbots zu rechtfertigen und hierbei bestimmte äußere Grenzen zu beachten.[145] Ohnehin stünde der mit einem „Feindstrafrecht“ verbundene Abbau fundamentaler Beschuldigtengarantien im Widerspruch zur Menschenwürde.[146] Aus vergleichbaren Gründen wäre auch ein „Gesinnungsstrafrecht“ verfassungswidrig.[147] Nicht unbedenklich ist daher die 2015 neu geschaffene Strafnorm des § 89a Abs. 2a StGB,[148] die lediglich auf die terroristische Absicht bei der – im Übrigen grundrechtlich verbürgten – Ausreise aus dem Staatsgebiet abstellt.[149]