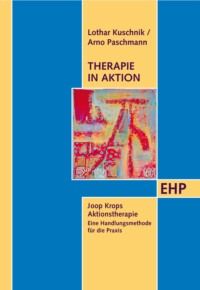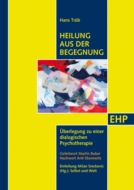Kitabı oku: «Therapie in Aktion», sayfa 5
Bioenergetik
Die Bioenergetische Analyse, kurz Bioenergetik genannt, ist ein psychotherapeutisches Konzept, das von dem amerikanischen Arzt Alexander Lowen seit 1947 entwickelt wurde. Als Patient und Schüler von Wilhelm Reich übernahm er dessen Charakteranalyse, die auf der Körperanalyse basierte. Reich wiederum war in seinem Denken der Psychoanalyse Freuds verhaftet und ‚verkörperte’ dessen intrapsychische Analyse. Der Ausspruch: „Verdrängung ist durch Muskelkraft geleistete Arbeit“, wird Wilhelm Reich zugeschrieben. Allerdings meint sein Energie-Begriff die funktionelle Einheit von Körper-Seele und Kosmos. In den Charakterstrukturen verkörpern sich Gefühle (vgl. Stanley Keleman „Verkörperte Gefühle“). Die Charakterpanzerung entsteht nach Reich durch die Verdrängung von Gefühlen, Begierden, Trieben und den Schutz vor Reizen der Umwelt. „Wir formen uns hin zu dem Zweck, dem wir dienen wollen“, sagt Stanley Keleman. Lowen übernahm die psychoanalytische Diagnostik und ergänzte sie um am Körper beobachtbare Phänomene. Ein psychisches Trauma führt zu einer körperlichen Veränderung - Panzerung. So entstand das Body Reading. Der Therapeut ,liest’ am Körper des Klienten die psychischen Traumata und verdrängten Gefühle. Lowen übernimmt in seiner Einteilung der Charakterstrukturen die Theorien von Freud und Reich und ergänzt sie durch eigene Beobachtungen:
Schizoid
Der schizoide Mensch ist, wie der Name nahelegt, gespalten in seinem Denken und Fühlen. Er zieht sich eher nach innen zurück, wenn ihm der Kontakt zu bedrohlich wird. Bedrohlich wird es immer dann, wenn tiefe Gefühle geweckt werden. Ebenfalls abgespalten ist beim schizoiden Typ der Kontakt zum Körper und seinen Gefühlen. Er hat einfach ein schwaches Selbst-Gefühl und kann sich schwer abgrenzen, deshalb meidet er Beziehungen, in denen tiefe Gefühle entstehen. Ähnlichkeiten zum schizoiden Typ nach Riemann („Grundformen der Angst“) sind evident.
Oral
Die orale Charakterstruktur ist eine lebenslange Fortsetzung der oralen Lebensphase im Babyalter. Der Mensch will versorgt werden, ohne Verantwortung zu übernehmen. Aggressionen sind ihm fremd. Er will gehalten, versorgt und behütet werden und klammert sich gern an den Partner. Innerlich haben oral fixierte Menschen das Gefühl einer großen Leere, intensive Sehnsuchtsgefühle und große Wünsche an ,die Welt’. Manchmal kompensieren Menschen mit oraler Charakterstruktur ihre innere Not durch eine übertriebene Abgrenzung. Stimmungsschwankungen zwischen Depression und Hochgefühl erinnern an bipolare Störungen. Ähnlichkeiten mit der gestalttherapeutischen Kontaktstörung der Konfluenz sind sehr deutlich.
Psychopathisch
Der Mensch mit einer psychopathischen Charakterstruktur leugnet Gefühle. Dabei sind es besonders sexuelle Gefühle, die negiert werden. Stattdessen geht es dem Psychopathen nach der bioenergetischen Analytik um Macht und damit den Wunsch, andere Menschen zu beherrschen. Seine Mittel der Wahl sind die Tyrannei oder die Verführung. Er will sein Umfeld im Griff behalten, fühlt sich für alles verantwortlich und traut anderen wenig zu. Angst hat er vor Erlebnissen des Kontrollverlustes und der Hilflosigkeit. Eigentlich verleugnet er seine tiefen Bedürfnisse, versorgt zu werden oder anders gesagt seine starken oralen Bedürfnisse.
Masochistisch
Das Verhalten des masochistischen Menschen ist sehr different von seiner inneren Gestimmtheit. Äußerlich gibt er sich sehr angepasst, fast unterwürfig. Dabei hat er innerlich eine beharrliche Abwehr und einen fast trotzigen Widerstand, den er unter äußerem Druck offenbaren muss. Der masochistische Charakter hat in sich starke Hassgefühle, er fühlt sich auch ,eigentlich’ oft überlegen. Wenn ein emotionaler Ausbruch droht, wird er durch eine starke Struktur der Muskulatur verhindert. Durchsetzen kann sich dieser Typ nicht.
Aggressiv ist er gar nicht. Er neigt zum Klagen und Jammern. Die Opferrolle nimmt er gern ein. Lowen beobachtet noch, dass das Essen und auch die Defäkation eine besondere Rolle spielen. Es fällt die Nähe zur Retroflektion der gestalttherapeutischen Neurosenlehre auf.
Rigide
Den rigiden Charakter kennzeichnet eine stolze Haltung. Er will eine gewisse Unnahbarkeit signalisieren. Dabei ist er sehr auf der Hut, dass er nicht ausgenutzt oder manipuliert wird. Er will sich um jeden Preis durchsetzen und tritt deshalb oft aggressiv, manchmal auch verletzend auf. Er ist egozentrisch, liebt es sich mit anderen zu messen.
Lowen unterteilt den rigiden Charakter in zwei weitere Kategorien:
phallisch
Bei diesem Typ dreht sich viel um die sexuelle Potenz. Er ist aggressivverletzend und oft auch ungeduldig. hysterisch
Der hysterische Typ nach Lowen neigt zu einem übertriebenen Verhalten. Er will Aufmerksamkeit um jeden Preis. Seine übersteigerten gefühlsmäßigen Reaktionen spiegeln sich im vegetativen körperlichen Bereich. Dabei wird die Sexualität eher als eine Abwehr benutzt, um sich gegen ein tiefes Einlassen zu schützen.
| 4. | Psychomotorische Therapie - Al Pesso |
„Pesso hat mich sehr beeindruckt“, sagt Joop und schildert uns eine Arbeit, die er mit Pesso in den siebziger Jahren gemacht hat. Albert Pesso war ursprünglich ein Tänzer. Wenn er als Trainer in seinen Workshops arbeitete, forderte er die Teilnehmer auf, eine Struktur entstehen zu lassen.
„Als Ausbilder war er nicht so gut“, meint Joop, „er konnte es nicht ertragen, seine Studenten Fehler machen zu lassen. Er übernahm es immer selbst. Er selbst war überragend in der Arbeit mit einer ‚Struktur‘ “.
Struktur meint die Einzelarbeit in der Gruppe. Eine Struktur dauert ungefähr 50 Minuten. Zunächst schildert der Klient sein Anliegen, und der Therapeut führt ihn durch gezielte Fragen zu alten Gefühlen und Reaktionsmustern (old map), die in Beziehung zum aktuellen Anliegen stehen.
Wenn wir sehr in unseren alten Prägungen und Bildern von Beziehungen verhaftet sind, übertragen wir sie in der Regel auf unsere aktuellen Beziehungen. Freud nannte dieses Phänomen „Übertragung“. Pesso nennt diese alten Prägungen und damit verbundenen Gefühle „wahre Szene“. Sein Ziel ist es, den Klienten diese „wahre Szene“ in ihrer Gefühlsqualität empfinden zu lassen. Dann tauchen automatisch Assoziationen und Erinnerungen an Szenen in unserer Lebensgeschichte auf, die mit der „wahren Szene“ in Verbindung stehen. So gelangt Pesso nach der erzählenden Ebene einen Schritt weiter in eine therapeutische Tiefung und exploriert mit dem Klienten die „historische Szene“. Diese historische Szene wird dann mit Rollenspielern genau so auf die Bühne der Struktur gebracht, wie der Klient sie damals erlebt hat. Das erinnert uns an die Arbeit des Psychodramas nach Moreno. Im Durchleben der „historischen Szene“ tauchen natürlich starke Gefühle im Klienten auf. Gefühle, die er damals nicht ausdrücken konnte. Durch die Erfahrung von Schutz und Gehaltensein kann er so in Kontakt mit seinen wirklichen Bedürfnissen kommen und sie ausdrücken. Jetzt geht es um die Reaktion der Umwelt. Zum einen der Umwelt von damals, in der Regel die Eltern, und dann um ein „ReProgramming“ der alten Erfahrung durch „ideale Eltern“. Diese Rolle nimmt der Therapeut mit Unterstützung der Gruppenteilnehmer ein. So entsteht eine heilende Gegenszene (Antidot). Durch das tiefe Erleben dieses Geschehens auf Gefühls- und Körperebene kann eine neue mentale Programmierung geschehen. Wir finden hier den gleichen erlebniszentrierten Ansatz wie in der Gestalttherapie wieder, die sagt: „In jedem wirklichen zweiten Erleben geschieht Heilung.“ Pesso war der Respekt vor der Freiheit und damit auch der Autonomie des Klienten ein großes Anliegen, darin stimmt er mit Joop Krop ganz überein. Der Klient bestimmt, ebenso wie jeder Rollenspieler ganz allein, wie weit er in seinem Prozess geht.
Doch hören wir jetzt Joop weiter zu:
„Ich hatte noch persönlich eine Erfahrung mit Pesso. Die Leute konnten mich nicht als negativen Vater wählen, weil ich zu stark war. Pesso dachte, dass ich dem nicht zustimmen würde. Aber das war nicht das Problem.
Ich war damals schon Leiter des Centers und besuchte mehrere Workshops von Pesso in Amsterdam und dann auch in Monterey. Pesso war eigentlich in den USA, aber er ging auch nach Holland, um dort Workshops zu geben. Man kann nicht sagen, dass die Psychomotorische Therapie auf eine andere Therapie aufgebaut ist. Er ist damit auf den Markt gekommen, und hat es ganz genial verbreitet.“
Frage: „Sag mal Joop, was würde passieren, wenn ich mit einem Anliegen in einer Gruppe von Pesso wäre?“
Joop: „Er würde die Teile deines Anliegens benennen lassen. Wenn es ein Problem mit dem Vater wäre, würde er jemanden aus der Gruppe bitten, der Vater zu sein. Aber er würde einen negativen und einen positiven Vater wählen. Dann würde eine Interaktion passieren. Natürlich funktioniert das Ganze auch mit der Mutter. Wenn es eine Mutter geben würde, würde er fragen, welche speziellen Sätze sie gesagt hat. Die werden der Vertreterin dann eingegeben.
Bleiben wir beim Vater. Zuerst wird mit dem negativen Vater abgerechnet. Man geht in ein Gefecht mit ihm. Aber der Rollenspieler des negativen Vaters wird nicht zum Schauspieler. Er bekommt die Sätze, die er sagen soll, vom Klienten. Der Therapeut fragt: ,Was würde er nun sagen?’ Am Ende dieser Sequenz wird der negative Vater aus dem Raum geschickt. Er bleibt draußen, bis die Struktur abgeschlossen ist. Der Klient sagt dann: ,Ich hab dich nicht mehr nötig, lass mich in Ruh.’ Der Vater kann aber auch noch Widerstand leisten: ,Du hast mich nötig.’ Wenn er weg ist, ist da eine Erleichterung aber auch ein Bedauern. Der Vater fehlt. Man gibt dann Zeit, um zu bedauern, dass man keinen Vater mehr hat. Ich muss es in meiner Seele mitkommen, ich muss spüren, wie es ist, ohne Vater zu sein. Man kann dann eine Weile dasitzen und dann fragen: ,Ist es nun Zeit für den positiven Vater? Bist du nun bereit dafür? Wo soll er sitzen, wo willst du sitzen?’ Das ist eine ganz emotionale Situation. Der positive Vater spricht auch nicht selbst. Er bekommt seine Sätze von dem Klienten. Der Therapeut fragt: ,Was wird er nun sagen?’. ,Was willst du nun hören?’ Wenn der positive Vater das sagt, wird Zeit gegeben: ,Kannst du das hören?’ ‚Nein.’ ‚Willst du das noch mal hören?’ ‚Ja.’ ‚Ich liebe dich wirklich.’ ‚Wirklich?’ ‚Ja, ich liebe dich wirklich.’ Das geht so lange, bis der Klient es akzeptiert und genug gehört hat. ‚Willst du noch mehr hören? Bist du fertig. Danke deinem positiven Vater. Kann der nun aus der Rolle gehen?’ ,Ok, ich bin nicht länger dein positiver Vater. Ich bin wieder Joop, dein Therapeut.’
Wenn die Struktur beendet ist, kommt auch der negative Vater wieder herein. Aber es kann schon ein bisschen schwierig sein, wenn der negative Vater wieder herein kommt. Er muss dann ebenfalls aus der Rolle entlassen werden.
Die meisten Strukturen wurden mit den Eltern ausgearbeitet.
In der Gestalt hat man bei Perls nur den Vater hinausgeschickt, aber dann hat man keinen mehr.“
Jetzt kehrt Joop wieder zu seiner Arbeit mit Pesso zurück. „Ich hatte mich in Truus in Holland verliebt. (s. u.) Sie war in einer meiner Supervisionsgruppen, die ich 1974 in Holland gab. Sieben Gruppen mit sieben Leuten. Ich lud Truus in die USA ein. Sie wollte eigentlich nur sehen, wie ich lebte. Aber ich machte ein sehr ambitioniertes Programm mit ihr. Mexiko, Monterey und so. Ich wollte ihr zeigen, wie schön es hier ist. Aber sie entschied sich hierher zu kommen, weil meine Kinder hier waren.
Mir hat Pesso in der Situation geholfen. Ich war in einem Workshop mit ihm, und es war meine Zeit, um zu arbeiten, eine Struktur zu machen. Ich erzählte, womit ich beschäftigt war und er gab der Gruppe den Auftrag: Ihr seid Truus, ihr seid die Kinder, ihr seid die Berge und Täler Kaliforniens, ihr seid Holland. Ich stellte sie auf, und ich sagte ihnen, was sie zu sagen hatten. Die Berge und Täler von Kalifornien sagten: ,Wir sind hier für dich. Komm’
Von Holland die sagten: ,Du bist hier aufgewachsen. Komm.’“
Jetzt ist Joop ganz eingetaucht in die Erinnerung. Tränen stehen in seinen Augen und mit belegter Stimme spricht er weiter.
„Und Truus sagte: ,Ich liebe dich. Ich will tun, was du willst.’“
Joop kommen Tränen und erzählt weiter: „Ich war sehr aufgeregt. Mir half das, zu verstehen, was ich nun wirklich wollte. Ich endete in Kalifornien mit Truus. Das war mein Wunsch.“
Frage: „Wie hast du das gespürt, Joop? Wie hast du das Feeling dafür bekommen?“
Joop: „Ich bin auch auf die verschiedenen Plätze gegangen und habe gespürt, wie es sich anfühlt. Ich habe dann auch zu den verschiedenen Vertretern etwas gesagt. Und die Kinder haben zum Beispiel gesagt: ,Wir wollen dich hier.’ Ich habe vorher mit einem Gestalttherapeuten gearbeitet. Der hat gesagt: ,Setz Holland auf diesen Stuhl und Kalifornien auf diesen Stuhl. Und mach einen Dialog. Das wirkte auch. Irgendwie. Aber Pesso war total beeindruckend für mich. Mir war dann klar, was ich wollte. Aber dennoch war es entscheidend, was Truus wollte. Eine gute Freundin von Truus war auch in dem Workshop. Und ich bat sie, Truus zu sein. Sie hat Truus erzählt, was in der Struktur geschehen ist.
Von Pesso habe ich gelernt, wie gearbeitet wird, wenn es ,schlechte Eltern‘ bei einem Klienten gab. Es wurde erst die Arbeit mit den ,schlechten Eltern‘ gemacht. Dann kamen die guten Eltern herein. Und er fragte, was willst du von den guten Eltern hören? Und sie sagten es. So wie ich es euch erzählt habe. (s.o.)
In meiner Therapie habe ich den Rat von Pesso befolgt: ,Sei als Therapeut nie das schlechte Elternteil. Du kannst das gute Elternteil sein, nicht das negative. Für den negativen Teil, nimm jemanden aus der Gruppe.‘ Wenn ich allein arbeitete, habe ich den negativen Vater auf den Stuhl gesetzt (wie in der Gestalttherapie). Und dann die Frage: ,Wo willst du deinen negativen Vater haben?’ Und dann konnte ich den Stuhl nehmen und ihn hinaustragen. ,Was willst du nun hören, das wichtig für dich ist? Ich will nun dein idealer Vater sein. Ich bin dein idealer Vater. Was willst du hören?’ Meistens wollten die Klienten dann auf dem Boden sitzen. Und dann sagte ich es: ,Ich liebe dich. Unbedingt. Du brauchst nicht immer gut zu sein.’ Alle Dinge, die sie hören wollten. Dann am Ende: ,Hast du genug gehört?’ Dann gehe ich wieder aus der Rolle. ,Ich bin nicht mehr dein idealer Vater, ich bin Joop, dein Therapeut.’ Das war wichtig. Also die negativen Eltern in den Stuhl und die positiven Eltern in den Vollzug der Therapie. Ich habe die Methode von Pesso ein wenig verändert. Ich habe immer alles genommen, und habe es genommen, wie ich es brauchte. I did it my way. Ich war Eklektiker.“
| A | A | Die Aktionstherapie IIIBody Architecture in der Einzeltherapie/Einzelsupervision |
| 1. | Die Rolle des Therapeuten - ein Beispiel aus der Einzelsupervision |
Bei der Arbeit mit Body Architecture in der Einzeltherapie und Einzelsupervision muss der Therapeut oft eine Doppelrolle einnehmen. Mal ist er Antagonist (Gegenspieler), mal ist er Therapeut.
Hier ein Beispiel aus der Einzelsupervision:
Dora beklagt sich, dass immer wieder Kollegen in ihren Arbeitsbereich kommen, um mit ihr zu plaudern. Das ist in Ordnung, aber manchmal wird es ihr zu viel, speziell, wenn sie viel zu tun hat.
Th.: „Sie kommen in deinen Bereich, und das ist manchmal o.k. und manchmal nicht. Und dann ist es für dich schwierig, ,nein‘ zu sagen?“
Dora: „Ja“
Th.: „Dann schlage ich dir vor, damit ein Experiment zu machen, einverstanden?“
Dora: „Wie?“
Th.: „Diese Hälfte des Raums ist dein Bereich, wo dein Schreibtisch steht. Und ich bin dein Kollege oder deine Kollegin, der/die plaudern will. … Ich komme jetzt“.
Der Therapeut betritt ihr Gebiet (in der Rolle des Kollegen), und sie setzt dem keinen Widerstand entgegen. Das besprechen nun beide (der Therapeut in seiner originären Rolle), und anschließend wird das Experiment so lange wiederholt, bis sie mit ihrer Reaktion zufrieden ist.
Beispiele aus der Einzeltherapie: „Ich fühle mich so deprimiert, so niedergedrückt.“
Der Therapeut bittet den Klienten irgendwo im Raum eine Haltung einzunehmen, die sein ,Deprimiertsein‘ symbolisiert. Er setzt sich mit gebeugtem Kopf in eine Ecke mit dem Gesicht zur Wand.
Th.: „Ich bin jetzt der Teil von dir, der dich niederdrückt.“
Er drückt den Klienten noch weiter nach unten und sagt Sätze, die er vorher von ihm gehört hat: „Du bist unwürdig, du kannst nichts, bist unfähig.“ Und er nimmt wahr, wie der Klient reagiert. Wird er ärgerlich oder beklagt er sich, nimmt es aber hin; reagiert er böse und richtet sich auf. Nach der Auswertung kann der Therapeut anbieten, selbst die Haltung des Klienten anzunehmen und dieser wird zum Unterdrücker.
Beim Zuhören kann im Therapeuten oft ein Bild auftauchen. Hört er vom Klienten: „Ich bin überlastet!“, kann er auf die Idee kommen, diesem in die nach vorne ausgestreckten Arme einen Stuhl zu hängen und zu warten, wie er mit der Zeit reagiert. Kommt irgendwann „Jetzt reicht es aber! Jetzt habe ich die Nase voll!“, dann kann er den Klienten bitten, diesen Satz zu verstärken, ihn lauter und mit mehr Nachdruck auszusprechen. Kommt lange keine Reaktion, obwohl dem Klienten anzusehen ist, dass er am Rande der Erschöpfung steht, kann er ihn bitten, zu sagen: „Bevor ich aufgebe werde ich lieber…“, oder noch stärker „Lieber breche ich zusammen, als dass ich …“.
Klienten können vergessen, was in einer Sitzung besprochen wurde, nie aber eine solche Skulptur mit ihren Folgen.
| 2. | Die vier Phasen der Sitzung |
Der Verlauf einer solchen therapeutischen Sitzung kann in vier Phasen unterteilt werden. Hier ein Beispiel:
Deskriptive Phase
Der Therapeut bittet den Klienten, in wenigen Worten sein Problem zu beschreiben.
Ein Beispiel:
Klient: „Am Arbeitsplatz habe ich Schwierigkeiten, mit anderen in Kontakt zu kommen. Sie sagen, dass ich alles in mich hineinfresse.“ Zusammengefasst heißt das: Ich bin anderen Menschen gegenüber verschlossen und daraus entstehen Konflikte.
Darstellungsphase
Der Therapeut kann jetzt den Klienten fragen, ob er aus ihm (dem Therapeuten) eine Statue machen will, die ,Verschlossen-Sein‘ ausdrückt. Gelingt diese Darstellung, bittet der Therapeut den Klienten, seinen Platz einzunehmen.
Ziel ist es, dass der Klient sich so gut wie möglich mit dem Bild der Verschlossenheit identifiziert. Die Darstellung ist ‚fertig‘, wenn der Klient meint, dass er seinem Ausdruck von Verschlossenheit nichts mehr hinzufügen kann.
Vertiefung
Klient und Therapeut versuchen nun im Gespräch gemeinsam eine Bilanz zu ziehen aus dem, was sie erfahren haben. Z.B.:
Kl.: „Anfangs versuchte ich, eine Statue zu machen, bei der die Hände vor den Augen sind. Aber das ist es nicht, was in der Realität passiert. Wenn ich verschlossen bin, fühle ich vor allem Spannung in mir. Deshalb versuchte ich, das Gespannt-Sein zu betonen und machte ein straffes Bild. Anfangs fand ich das schwierig. Ich fand es auch sonderbar, dass ich dich (den Therapeuten) modellieren musste. Aber als ich erst einmal damit zugange war, bekam ich Freude daran. Es war dann einfach, als Statue der Verschlossenheit deinen Platz einzunehmen.“
Th.: „Was hast du körperlich gespürt, als du die Statue warst?“
Kl.: „Die Verschlossenheit war besonders in meinem Gesicht und in meinen Augen.“
Th.: „Was passiert, wenn du dich im Alltag verschlossen fühlst?“
Kl.: „Ich habe den Eindruck, dass ich dann auf einen Punkt starre, und dass auch meine Gedanken sich fixieren.“
Th.: „Achte mal auf deine Schultern und auf deinen Atem. Versuche noch mal, in die verschlossene Haltung zurückzukehren.“
Kl.: „Meine Schultern gehen nach vorn, und mein Atem wird flacher.“
Th.: „Lass das geschehen. Wenn du da etwas länger drin bleibst, was kommt dann in dir hoch?“
Kl.: „Das fühlt sich nicht angenehm an; ich fühle mich ängstlich und verlegen.“
Th.: „Wenn ich dich noch mal bitten würde, eine Statue zu machen, was würdest du dann aussuchen, das Bild der Angst oder das Bild der Verlegenheit?“
Kl.: „Das der Verlegenheit.“
Th.: „Dann tu es mal.“
Der Klient setzt zuerst den Therapeuten und dann sich selbst auf die Kante eines Stuhls und wendet dann sein Gesicht zur Seite.
Th.: „Was geht in dir vor?“
Kl.: „Dieses Bild kenne ich sehr gut von mir aus der Zeit, als ich noch ein Kind war, aber auch als Erwachsener bei Gelegenheiten, wenn viele Menschen zusammen sind. Bei Feiern fühle ich mich nie wohl.“
Th.: „Hast du etwas an dir, was du selbst nicht angenehm findest?“
Kl.: „Früher hatte ich eine Hasenscharte. Daran bin ich mit Erfolg operiert worden; man sieht fast nichts mehr davon. Dennoch quälte man mich in der Schule; man nannte mich ‚Kaninchen‘ und ich blieb am liebsten im Hintergrund.“
Th.: „Was würdest du jetzt ändern wollen?“
Kl.: „Ich würde gerne etwas lockerer auf Menschen zugehen.“
Th.: „Stell dich mal gegen die Wand. Nimm die verschlossene Haltung an. Mach dich ganz langsam los und versuche, das Gegenteil von Verschlossenheit auszudrücken. Dann kommst du langsam zu mir. Übertreibe ruhig deine Haltung.“
Der Klient tut das und kommt mit ausgestreckten Armen auf den Therapeuten zu. Sein Gesicht bleibt dabei starr.
Th.: „Bist du jetzt zufrieden? Wie fühlt sich dein Gesicht an?“
KL.: „Mein Gesicht ist immer noch straff. Ich werde mal versuchen, zu lächeln. Ja, das fühlt sich viel besser an, aber ich finde es doch noch sehr gemacht und unecht.“
Th.: „Versuche es noch mal, aber bewege dich jetzt so, wie du dich am wohlsten fühlst.“
Der Klient kommt mit ruhigen Schritten auf den Therapeuten zu; seine Arme sind locker, und er sieht frei im Zimmer umher.
Th.: „Ich habe das Gefühl, dass du dich so o.k. fühlst. Stimmt das? … Geh dem mal nach, was sich alles bei dir geändert hat.“
Kl.: „Ich fühle mich weniger straff, weniger gespannt. Ich fühle mich locker, und das finde ich angenehm. Ich spüre mich jetzt mehr. Ich konnte mich frei im Zimmer umsehen. Das bin ich nicht gewohnt; meistens schaue ich auf einen Punkt und sehe dann eigentlich nichts.“
Th.: „Vielleicht kannst du das für dich selbst etwas mehr üben.“
Kl.: „Das möchte ich jetzt schon.“
Er geht durch den Raum und schaut sich um.
Kl.: „Merkwürdig, ich sehe jetzt schon viel mehr Sachen im Raum, die ich zuerst nicht gesehen habe. Das will ich gerne üben.“
Th.: „Ich kann mir ein solches Gefühl sehr gut vorstellen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich auch zu wenig wahrnehme. Ich habe den Eindruck, dass wir gemeinsam etwas erlebt haben.“
Kl.: „Das finde ich auch.“
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.