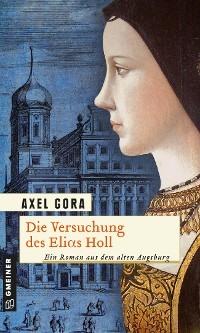Kitabı oku: «Die Versuchung des Elias Holl», sayfa 2
Doktor Häberlin schwieg.
»Was muss ich tun, damit es ihr bald wieder besser geht, Doktor?«
»Ruhe und beten ist das oberste Gebot. Stündlich Kräuterwickel, viel Hühnerbrühe und getrockneter Ingwer; Adelgund weiß Bescheid. Sie wird noch eine Woche bleiben, dann müsst Ihr um ein Haus- und Kindermädchen schauen, unbedingt. Mich wundert ohnehin, dass noch keines bei Euch in Diensten steht. Bei Eurem Stand ist ein Hausmädchen längst anempfohlen.«
»Rosina wollte nichts aus der Hand geben. Sie sagte immer: ›Bei uns zuhause hatten wir das auch nicht.‹ Und bislang hat sie ja auch alles bestens bewerkstelligt. Jedes unsrer vier Kinder ist wohlauf.«
»Jetzt wird sie aus der Hand geben müssen. Zumindest für die nächste Zeit. Da führt kein Weg vorbei.«
»Ich werde mich umgehend um eine Hilfe kümmern. Wann, meint Ihr, wird es Rosina wieder besser gehen?«
»Ich meine gar nichts, werter Holl. Außer unsrem lieben Herrgott weiß das niemand.«
»Aber sie wird doch nicht … Ich meine …«
»Wir wollen es nicht heraufbeschwören. Aber ausschließen können wir es nicht.« Doktor Häberlin legte seine Hände auf die meinen. »Betet fleißig zu unserem Herrn und er wird Euch erhören.«
»Als ich kam, war ich heilfroh, dass der Herr Pfarrer nicht zugegen war, jetzt spricht er aus Euch heraus.«
Die Instrumententasche umgehängt, schritt der Doktor aus der Tür und verließ das Haus. Ich sah aus dem Fenster und ihm nach, wie er im Trippelgang durch den Schnee die Werbhausgasse hinunterschlitterte. Lange noch blieb ich am Fenster stehen, den Blick erhoben von der weiß bedeckten Gasse nach oben über die Fassaden der Häuser hinweg, über die Gesimse, die Dachfirste und Kamine. Ich blinzelte in den milchweißen Himmel und sah Schneeflocken. Abermillionen und überall. Vom Wind gepeitscht taumelten sie durch die Luft. Höschels Worte tauchten auf. »Rosina«, sprach ich leise und strich mir die Tränen von der Wange.
1 Thomas Harriot, 1560 – 1621, englischer Naturphilosoph und Astronom
2 Stil der italienischen Spätrenaissance
3 Augsburger Werkschuh = 29,5 cm. Das Maß ist in Eisen an der Westseite (Frontfassade) des Augsburger Rathauses angeschlagen
4 Zwischengeschoss
5 Damalige Bezeichnung für die Patrizier
6 Joseph d. Ä., 1564 – 1609, Maler und Zeichner für Architektur
7 Die Männer waren i. d. R. von den Geburten ausgeschlossen
2
»Grüß Gott die Herrschaften. Scho’ was ausg’sucht?«
Die stämmige Wirtin vom Gasthaus ›Zum Eisenhut‹ beim Obstmarkt stand wartend am Tisch, die Fäuste gestemmt in die beschürzten Hüften. Das krause Haar hatte sie unter einer Leinenhaube verdeckt, deren lose Bänder in die massige Oberweite ihres Ausschnitts baumelten, von einer vom Bratenfett verschmierten Kordel zusammengehalten.
Remboldt zeigte zur Holztafel an der Wand, auf der mit Kreide geschrieben drei Gerichte zur Auswahl standen: Schweinsbraten, Tellersulz, Bohnensuppe.
»Ein gestauchtes Dunkles8, Theresa, und den Schweinsbraten. Holl, was nehmt Ihr?«
»Mir auch ein gestauchtes Dunkles und nur die Bohnensuppe, bitte.«
»Bloß die Supp? Des is fei net viel. Wollt Ihr net au von der Sau kosten? Mit deftige Semmelknödl?«
»Die haben hier den besten Schweinsbraten von Augsburg, Holl«, unterstützte Remboldt die Wirtin.
»Lasst gut sein. Mein Appetit ist zurzeit nicht allzu groß.«
»Man sieht’s Euch an. Ihr wart schon mal besser beieinander. Wollt Ihr nicht doch den Schweinsbraten …?«
Ich schüttelte den Kopf. Die Wirtin zuckte mit den Schultern und wandte sich ab. Den Hals gereckt, sah Remboldt ihr nach, wie sie mit ihrem breiten Gesäß an den Tischen vorbei in die Küche schwappte.
»Mei, die Theresa, ein Ackergaul von einem Weib. Aber was will ich sagen, die meinige hat mit den Jahren auch ganz schön zugelegt. Anders die Eurige, die ist nach wie vor zart wie eine Ricke.«
Ich verschwieg Remboldt meine Sorge um Rosina. Er war zu wenig mitfühlend, als dass man ihn mit persönlicher Seelennot strapazieren durfte; sein Interesse an den Menschen war begrenzt – »Ich bin weder Pfarrer noch Arzt. Allein die Stadt ist mein Schützling!«, lauteten seine Worte, mit denen er jedwedes Leidklagen eindämmte, das sein überschaubares Quantum an Anteilnahme zu überschreiten drohte. Zusammen mit fünf Ratsherren bildeten er und Marx Welser die Spitze des Augsburger Ämtergefüges. Dieser Stand wollte mit gebührlicher Distanz demonstriert sein. Obgleich Remboldt seinem Gegenüber stets nur ein begrenztes Maß an Interesse entgegenbrachte, so erhob er doch den Anspruch, dass man sich ihm stets mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu widmen habe, wenn er ausschweifend über seine mannigfaltigen Aufgaben und deren einhergehende Sorgen sprach; das konnte mal mehr mal weniger interessant sein, immer jedoch waren seine Ausführungen langatmig, zeitraubend und wenig bis gar nicht ergiebig. Natürlich hatte er viel zu erzählen; als Träger des höchsten städtischen Amts – in einer Freien Reichsstadt, einer von Fürsten unabhängigen Stadtrepublik, einzig dem Kaiser Untertan – traf er sich fast nur mit Vertretern der Freien Stände, des Adels und der Kunst. Das ergab Anekdoten in Fülle.
»Prost die Herrschaften!«
Theresa stellte die angewärmten Steinkrüge auf den Tisch. Wir stießen an und tranken. Ich verschwieg Remboldt meine Hoffnung darauf, dass Rosina zunehmen möge – die ›zarte Ricke‹ war zum todkränkelnden Kitz abgemagert –, worüber ich täglich betete in unserer Kirche Sankt Anna, in der wir geheiratet hatten und alle Kinder getauft. Nur mehr Haut und Knochen, behielt Rosina kaum die Suppe, die ihr Adelgund einträufelte, und wenn, dann schwitzte sie bis zum nächsten Teller alles wieder aus sich heraus. Vier Tage waren seit der Entbindung vergangen. Gestern früh war die Taufe gewesen, das erste Mal ohne die Mutter. Das war mir arg. Unser Bub hatte auf Rosinas Wunsch den Vornamen Hieronymus erhalten. »Wenn der kleine Hieronymus auch mal so eifrig wird, wie der große bei uns«, hatte ich ihr beigepflichtet, »dann dürfen wir uns freuen.« Der große, bereits fünfzehn, war sein Namensvetter Hieronymus Thoman und würde nächstes Jahr die Gesellenprüfung absolvieren. Bereits mit zwölf Jahren, ein Jahr früher als üblich, hatte ich ihn zu mir in die Lehre genommen, nicht weil er kräftiger und klüger gewesen war als die anderen Buben, sondern weil er als einziges Kind, der Vater gestorben, für seine schwache Mutter zu sorgen hatte. Was für ein Christenmensch wäre ich, hätte ich ihm nicht geholfen?
Remboldt wollte sich aus einem hoffnungsträchtigen Anlass mit mir zum Mittagessen treffen, wie er mich bereits vor Tagen hatte wissen lassen – und rätseln, worum es sich handeln sollte. Gern den Geheimnisvollen gebend, rückte er auch jetzt nicht gleich mit dem Grund unseres Hierseins heraus. Er erzählte mir, nachdem Suppe und Braten kamen und wir uns guten Appetit gewünscht, Tratsch über den Großen Rat. Im Grunde wusste er, dass mich das nicht interessierte, obwohl ich ihm ebenfalls angehörte.
Die ersten Stücke Fleisch zwischen die Zähne geschoben und den Geschmack überschwänglich gelobt, fuhr er fort mit den Unwichtigkeiten: »Imhof ist mir immer noch Gram wegen des Herkulesbrunnens. Ihr wisst doch, diese …«
Ich vermied es, ihn dabei anzusehen. Der Anblick von eingespeicheltem Fleisch- und Knödelbrei zwischen schwefelfarbigen Schiefzähnen und Spuckefäden machte mich schaudern. Schon als Kind hatte mir das Gänsehaut beschert und nie hatte ich verstanden, warum allerorts die Menschen bei Tisch mit vollem Munde redeten; es konnte doch nicht angehen, dass niemand außer mir daran Anstoß nahm. War mein ästhetisches Empfinden zu zart für alltägliche Unzulänglichkeiten?
»… alte Geschichte. Wie kann man nur so starrköpfig sein? Zu allem Überfluss haben sich jetzt auch noch seine Frau und die Rehlingerin eingemischt. Als ob Weibsbilder damit was zu schaffen hätten. Ihr glaubt nicht, was mir das an Magendrücken heraufbeschwört. Jeden Morgen spüre ich dieses unsägliche Gefühl, als ob ich Wackersteine in meinem …«
Remboldts müßige Plauderei verblasste mit jedem weiteren Wort und waberte ungehört mit dem Dunst des Bratenfleischs durch die Wirtsstube. Die auf mich plätschernde Einförmigkeit seines Monologs zwang mich geradezu, mich auf den Löffel Suppe zu konzentrieren, den ich im Munde hatte, und dabei an Rosina zu denken. Bei Maria – Gott habe sie selig –, meiner ersten Frau, war es auch so angegangen; und was war dann geschehen? Von der Geburt unseres achten Kindes hatte sie sich nicht mehr erholt … Ihren Todestag, den 30. Januar vor sechs Jahren, würde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Ich hatte erneut und zum neunten Mal – der Tod meiner Mutter, der Tod meines Vaters und die Tode von sechs Kindern – schwere Zeiten der Trauer durchlebt. Allein die bis an Besessenheit grenzende Flucht in die Arbeit ließ mich den Schmerz vergessen und Erinnerungen niederhalten, die sich mir aufzuzwingen suchten. Ich wäre nicht der Sohn meines Vaters Hans Holl gewesen, hätte ich nicht für meine beiden verbliebenen Kinder Johannes und Rosina nach einer neuen, liebevollen Mutter geschaut, die auch mir ein gutes Weib sein wollte. Noch mehr als mein Sohn hatte sich mein kleines Töchterchen gefreut, als ich nach der zehnwöchigen Trauerzeit ein neues Eheweib ins Haus brachte – rief man sie doch beide mit dem gleichen Vornamen. Rosina war nicht nur meinen beiden Kindern eine fürsorgliche Mutter, sie gebar mir bis zum heutigen Tag fünf weitere. Sie führte den Haushalt mit Freude und war mir auch eine seelische Stütze. »Wir können froh sein, dass du so viel Arbeit hast. Andere müssen Hunger leiden!«, hatte sie mich bestärkt, als ich in schwachen Momenten darüber grübelte, dass mir die ganze Rennerei über den Kopf wüchse: Von den Baustellen zum Amt, vom Amt zu den Baustellen, von dort zum Atelier. Vom Atelier zum Amt und von dort wieder zu den Baustellen und zurück und dann wieder von vorne. Ich selbst hatte nie Hunger leiden müssen. Schon als kleiner Bub hatte Vater mich an die Arbeit gestellt, und später in der Lehre mich angetrieben, niemals weniger oder schlechter zu arbeiten als die anderen. Ich sollte stets nach dem Fleißigsten schauen und versuchen, diesen zu übertreffen. Wenn ein Lehrling im vierten Jahr zwölf Steine trug, sollte ich, gerademal im ersten Jahr, sechzehn tragen, wenn einer einen Kübel Speis vermauerte, mussten es bei mir anderthalb, besser zwei sein. »Du bist des Meisters Sohn, das schafft Neid von Haus aus«, hatte er mir eingebläut, »guck, dass dir niemals einer am Kittel flicken kann. Sei rege und tu immer mehr, als das, was man dir anschafft!« Daran hatte ich mich alle Tage gehalten. Und der Erfolg gab mir Recht. Ich erreichte es, mit Verstand, Disziplin und nicht zuletzt mit meiner bloßen Hände Arbeit ein wohlhabender Mann zu werden, den man manierlich auf der Straße grüßte. Was jedoch nützte mir Geld, was Ansehen, wenn der Herrgott schon wieder drohte, mir meine Liebe zu nehmen – mein Eheweib und Mutter von fünf Kindern? Was hatte ich begangen, dass er mich erneut zu züchtigen suchte? Kümmerte ich mich zu wenig um Rosina und die Kinder? War ich ein schlechter Ehemann und Vater? Suchte ich fleischliche Befriedigung im Frauenhaus? Ging ich zu wenig in die Kirche? War ich gar ein Sünder? Nein und nochmals nein! Beileibe nichts von alledem! Niemals! Ich arbeitete viel, sehr viel! Über die Maßen und immer bis tief in die Nacht, manchmal sogar bis zum Morgengrauen. Doch ich wusste: Arbeit ist ein Geschenk Gottes! Hatten wir doch lange schwere Zeiten durchzustehen gehabt, da Handwerker die Obrigkeit um Arbeit ersuchen mussten. Das war jetzt nicht mehr so. Unser Augsburg strebte auf. Alle Welt sollte von uns erfahren. Wir hatten die vermögendsten Kaufleute und Geschlechter bei uns versammelt: die Fugger, Welser, Imhof, Paler, Rehlinger, … Sie waren es, die uns Aufträge gaben und Wohlstand brachten. So wollte ich die Arbeit stets in Ehren halten und überdies ein Gutmensch sein.
»… ist es nicht so, Meister Holl? … Meister Holl! Ist es nicht so?«
»Äh? Was?«
»Ihr nickt die ganze Zeit und es kommt kein Wort der Gegenrede. Also, wie lautet nun Euer Vorschlag?«
»Genickt? Habe ich …? Mein Vorschlag? Ja, … mein Vorschlag! Natürlich …«
»Eure Entwürfe liegen doch schon seit Jahren bei Euch im Atelier. Immer wieder habt Ihr mich damit bedrängt und jetzt, wo die Zeit gekommen ist, druckst Ihr herum? So kenne ich Euch gar nicht.«
»Verzeiht, ich war in Gedanken.«
»Ah? Ihr hört mir also nicht zu?«
»Meinem Weib ergeht es nicht gut.«
»Wie bitte? Der Große Rat zählt, Euch eingeschlossen, dreihundert Mitglieder: Hundertvierzig Gemeine, achtzig Kaufleute, sechsunddreißig Mehrer und vierundvierzig Geschlechter. Glaubt Ihr, dass nur ein einziger darunter wäre, der mir nicht mit ganzem Ohr zuhörte, nur weil es seinem Weib ›nicht gut‹ erginge?«
Es trat ein, was ich zu vermeiden suchte; ich hatte Augsburgs obersten Amtmann in seiner Ehre gekränkt. Das war bitter. Doch würde ich nicht zu Kreuze kriechen. Remboldt war wohl ein Herr des höchsten Dienstes und stand über mir, doch ich war nicht weniger ein Mann, der um seine eigenen Fähigkeiten und Ämter wusste. Freilich sprachen zwei Dinge gegen mich: Ich gehörte den oft nicht nur vom römischen Klerus ungeliebten Protestanten an und ich war nur von einfachem bürgerlichen Stand. Remboldt wusste das, doch niemals hätte er es ins Feld geführt. Er war nicht der klerikalen Obrigkeit ein Diener, sondern der weltlichen und ebenfalls nicht von Adel.
»Das mag angehen, werter Remboldt. In diesem Fall ist es aber das Weib des Stadtwerkmeisters. Es gibt nur einen und der bin ich! Vor zwölf Jahren von den drei Baumeistern Wolfgang Paler, Constantin Imhof und Johann Bartholomäus Welser gewählt, und damit aufgestiegen zum Oberherrn des bedeutendsten Ressorts des reichsstädtischen Baumeisteramtes. Ich bin de facto für das komplette reichsstädtische Bauwesen verantwortlich!«
Ich erzählte in einem fort, so, wie Remboldt es für gewöhnlich tat, und tischte ihm die große Palette meiner gängigen Aufgaben auf, angefangen vom Begutachten von Gebäuden mit Anordnung des Abrisses oder der Erhaltung, über die Planung neuer Projekte mit Vermessen von Grundstücken, dem Erstellen von Material- und Handwerkerlisten und der Kostenvoranschläge, zusätzlich dem Anfertigen von Aufrissen und Visierungen und der Konstruktion von Baugerüsten, Flaschenzügen und Lastkränen, letztlich meine Verpflichtungen zum bestmöglichen Ankauf und zur gewissenhaften Bewertung aller Materialien wie Steine, Sand, Kalk, Eisen, Holz zu deren sachgerechte Lagerung, gründliche Kontrolle und Verwaltung.
»Ich renne Sommer wie Winter auf den Baustellen umher und bin mir nicht zu schade, mitanzupacken. Ich sorge dafür, dass Augsburg mit jedem Bau, den ich vollende, ein neues Meisterwerk erhält und sein reichsstädtisches Antlitz mehr und mehr verschönert. Ich arbeite achtzehn Stunden am Tag und ich …«
»Ja, Holl! Ist ja gut! Es reicht! Ich weiß das alles! Ich weiß aber auch, Ihr seid wie kein Zweiter an Konditionen gutgestellt: Zweihundert Gulden Jahresgehalt9 – Euer Vorgänger Eschay bekam bloß achtzig. Einen Gulden Wochengeld, fünf Gulden für Arbeitskleidung und zehn Gulden für Euren Hauszins. Dazu fünf Pfund Forellen und sechs Pfund Karpfen pro Jahr. Und nicht zu vergessen die freien Rationen aus den Kalkhütten und die zwölf Klafter Holz aus dem städtischen Forst. Zusätzlich bekommt Ihr Gratifikationen für Sonderleistungen. Die Verdienste für Eure privaten und außerstädtischen Arbeiten bringe ich gar nicht zur Sprache. Was also Eure Vergütung angeht, seid Ihr ganz weit vorn.«
»Selbst wenn ich das Doppelte bekäme … Ich habe nur dieses eine Weib, das todkrank im Bett liegt und, wenn es sich zum Schlechten wendet, sterben wird. Dann steh ich wieder allein da, und diesmal mit fünf Kindern. So seht’s mir nach, wenn ich abwesend war. Fasst in einem Satz zusammen, um was es geht. Ich werde sofort im Bilde sein.«
Remboldt hob die Brauen, schwieg einen Moment, trank aus dem Steinkrug und sah mich an.
»Also darum keinen Appetit … Holl, ich bin kein Unmensch, lasst Euch das gesagt sein. Als frommer Katholik weiß ich das heilige Sakrament der Ehe zu würdigen und auch die Gunst eines holden Weibes. Zudem besteht ein Unterschied zwischen ›nicht gut ergehen‹ und ›im Sterben liegen‹. Ihr hättet mir davon erzählen können.«
»Ich wollte Euch nicht damit behelligen.«
»Ihr müsstet mich gut genug kennen, um zu wissen, wann bei mir das Maß in punkto Behelligung erreicht ist. Ein paar Worte der Aufklärung und die Bitte um Verständnis hätten genügt. Also erzählt.«
Ich fasste mich kurz. Remboldt nickte bestätigend; für einen Moment glaubte ich sogar Anteilnahme in seinen Augen aufblitzen zu sehen. Als ich das Problem mit der Haushilfe ansprach, bekannte er, wie schwer es sei, eine nützliche und zuverlässige zu bekommen. Es helfe ja nichts, gab er mir zu bedenken, irgendeine anzustellen. Es müsse eine sein, die mit kleinen und großen Kindern umzugehen wisse, die Besen und Feudel beherzt in die Hand nähme, den Ofen schüre, günstig und gut Essen kaufe und schmackhaft zubereite.
»Sie muss das Plätteisen beherrschen«, pflichtete ich ihm bei, »und ebenso den Umgang mit Nadel und Faden. Kinder zerreißen ständig was, da springt man nicht immer zur Näherin.«
»Ich sag’s Euch, Holl, entweder taugen sie nichts oder sie stehlen. Die meisten schleppen Krankheiten an.«
»Ihr macht mir Mut.«
»So ist es aber. Bei mir waren fünf im Haus, bis die richtige kam.«
»Dann hab ich noch drei gut – gleich am Tag der Geburt habe ich zwei in der Unterstadt aufgesucht, die mir die Amme empfohlen hat. Von denen hab ich mich verabschiedet, noch ehe drei Worte gesprochen waren. Die erste war noch magerer als mein armes Weib, die zweite war übersät mit Pusteln.«
»Ein gutes Mädchen kommt von und mit Gottes Gnaden.«
»Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die Amme geht. Dann muss ich eine gefunden haben.«
Remboldt zeigte mehr Mitgefühl als ich erwartet hatte, er überraschte mich geradezu: »Eigentlich geht es mich nichts an, aber ich halte die Ohren für Euch offen, Holl.«
Sein Schulterklopfen mochte ein Zeichen der Ermunterung sein, war aber wohl eher als Signal zum Themawechsel gemeint. Er setzte die Fingerkuppen beider Hände gegeneinander, spreizte die Finger, führte sie zur Nasenspitze und hob an.
»Holl, Ihr wisst, wie gut es mittlerweile um unsere schöne Stadt bestellt ist. Sie hat in ihrer langen Geschichte viel Schlechtes erfahren: Blattern, Franzosenkrankheit und die Pest, Zauberei und Hexenwahn, Neid und Missgunst bis zum Krieg, Hungersnöte, Feuersbrünste, Hochwasser. Über den schwelenden Konfessionszwist möchte ich gar nicht reden. Aber: Augsburg ist dabei nicht zugrunde gegangen! Im Gegenteil, stark ist unsere Stadt geworden. Mächtig sogar! Sie birgt bald an die fünfzigtausend Menschen. In den letzten hundert Jahren hat sich – trotz aller Widrigkeiten – unsere Bürgerzahl verdoppelt. Nach Köln und Nürnberg ist Augsburg die drittgrößte Stadt des Heiligen Römischen Reiches. Und sie hat das Zeug dazu, die größte zu werden! In unseren Warenstraßen vom Roten Tor über Spital-, Bäcker- und Heilig Grabgasse bis zu unseren zahlreichen Märkten reißt der Verkehr nicht ab. Mit der Macht der Fugger und der Welser hat Augsburg seinen wirtschaftlichen Siegeszug bis in die Neue Welt angetreten. Und wir, Holl, ziehen mit! Ich und Ihr: Wir werden dafür sorgen, dass unsere Freie Reichsstadt ein Gesicht zeigt, das nicht nur ihren Status ehrt, sondern ihresgleichen sucht! Mit den Brunnen haben wir einen Anfang gemacht, doch sie sind nur ein Teil im großen Ganzen. Wichtiger sind die Bauten. Das Gymnasium bei Sankt Anna und die Bibliothek mit dem astronomischen Studierzimmer lassen sich nicht nur für die Gelehrten gut an. Mit dem Städtischen Kaufhaus, dem Becken- und dem Siegelhaus sind Euch große Würfe geglückt, die Ihr mit der Stadtmetzg und dem Zeughaus noch übertroffen habt. Und ich bin mir gewiss, der Neue Bau wird ebenfalls ein gelungenes Werk!«
Remboldt war mir stets geneigt und ich wusste, dass er meine Arbeit schätzte, doch so viel Lorbeer unter vier Augen hatte er mir noch nie aufs Haupt gesetzt. Er tat einen kräftigen Schluck aus dem Krug, schob den leeren Teller zur Seite und breitete die Arme aus wie der Pfarrer auf der Kanzel.
»Holl! Die Zeit ist gekommen für unser heroisches Projekt! Ihr wisst, was ich meine.« Remboldt sah mich erwartungsvoll an.
Ich zögerte. »Das neue Rathaus?«
»So ist es. Die Zeit ist reif! Die Stadtkasse ist mit vierhunderttausend Gulden immer noch reichlich gefüllt, dank unsrer rigorosen Spar- und Steuerpolitik. Für den Rathausbau haben wir eigene Rücklagen geschaffen; einen Teil davon verdanken wir der Ablehnung von Kagers und Heintz’ Loggiaentwürfen, gegen die Ihr seinerzeit Gott sei Dank auch gestimmt habt.«
»Die Loggiaentwürfe waren welsche Manier erster Güte, nur die beiden Herren Maler sind in ihrem Überschwang damit weit übers Ziel hinausgeschossen.«
»Ein paar Träumer im Rat wollen bis heute eine Loggia auf dem Perlachplatz sehen. Wie stellen die sich das vor … ein offener Säulenbau, tz … Bei unseren Wintern … Der sollte dann zum Repräsentieren taugen und gegenüber stünde das eigentliche Rathaus als heruntergekommener Verwaltungsbau, notdürftig renoviert. Was ist denn das für eine Politik, frage ich Euch? Und was die welsche Manier angeht, diese in aller Ehren, Holl, und ohne sie scheint es nicht zu gehen, wie ich mich nicht nur von Euch schon des Öfteren belehren ließ. Trotzdem sage ich, wir brauchen ein eigenes Bild für den Perlachplatz und keine Theaterkulisse, die Rom oder Venedig nachäfft.«
»In jeder Kunst lässt man sich von Vorgängern inspirieren. Und das Welschland ist dafür nun mal die erste Inspirationsquelle.«
»Inspiration ist eine Sache, Holl, kopieren eine andere. Wir bauen keine Werke nach. Wir schaffen Eigenes!«
Remboldt war – im Gegensatz zu David Höschel, Marx Welser, Georg Henisch und mir – kein Anhänger des stundenlangen Studierens von Büchern, Visierungen und Stichen. So entging es ihm, dass Inspiration und Kopie des Welschen bei meinen Bauten enger beisammen lagen, als ihm womöglich Recht gewesen wäre. Zu Beginn meiner Laufbahn hatte ich mich erst wahllos an allem orientiert, was ich an Stichen von Bauwerken aus dem Welschland in die Hände bekam. Später begrenzte ich mich auf wenige begnadete Baumeister wie Andrea Palladio, Sebastiano Serlio und Donato Bramante. Mehr als die bloßen Abbildungen ihrer Bauwerke, so brillant sie auch gestochen waren, beeinflussten mich die Originale, die ich in Venedig mit Matthias besucht und eingehend studiert hatte; dort konnte ich dreidimensional und lebensgroß erleben, was ich zuvor nur als gedruckte und verkleinerte Abbildungen auf Pergament und Papier in Augenschein nehmen durfte. Fürs Bäckerzunfthaus war Palladios Convento della Carità in Venedig mein Vorbild und beim Neuen Bau hielt ich mich an je ein Vorbild10 der beiden Künstler. Die Synthese ihrer Entwürfe ergab das Gesicht meiner eigenen Schöpfungen; von Georg Henisch wusste ich, dass schon die Eklektiker bei den alten Griechen so verfahren hatten. »Es ist kein Frevel, anfangs alle Eindrücke und Strömungen in sich aufzunehmen, um hernach, wenn man routinierter und erfahrener geworden ist, Neues und Originäres zu erschaffen«, hatte er mich gelehrt.
»Na gut, werter Stadtpfleger, wie lautet Euer Plan?«
»Euren ersten Vorschlag, nur die Fassade des alten Rathauses zu renovieren und die Innenräume neu aufzuteilen, hatten wir aus guten Gründen seinerzeit schon komplett verworfen. Der zweite Vorschlag war mir schon besser eingegangen, ein Neubau, bei dem Kaisererker, Wanduhr und Glockenturm erhalten blieben.«
»Meine Reminiszenz an Vergangenes, gewiss, aber auch ein unglücklicher Kompromiss. Mit diesem Entwurf war ich damals schon nicht glücklich und bin es heute noch weniger. Die baufälligen Wände hätten wir nur zum Teil beseitigt, und die Proportionen der Achsen hätten nicht gestimmt, weil ich mich an den alten Grundriss hätte halten müssen. Zudem, den dürftigen gallischen11 Glockenturm stehen zu lassen, wäre ein riskantes Spiel, auch er ist inzwischen von Wind und Wetter zerfressen.«
»Ergo?«
»Das alte Rathaus gehört abgerissen, werter Remboldt, und ein neues her! Ein imposantes, eines, das Augsburgs Stand in der Welt Ehre macht, wo selbst gekrönte Häupter achtungsvoll staunen! So eines bau ich Euch: wohlproportioniert, größer und schöner als das vorige!«
»Ich weiß, dass Ihr das könnt. Und so eines will auch ich, wie ich mich Euch wohl unmissverständlich erklärte. Aber was ist mit dem alten Pferdefuß? Der Rathausturm mag ›dürftig‹ sein, er ist dennoch der ehrenvolle Hort der Ratsglocke! Und diese ist wie kein zweites akustisches Insignium unserer weltlichen Macht! Die Ratsglocke ist die wichtigste, wichtiger noch als die Sturmglocke im Perlachturm und die Glocken der umliegenden Kirchen. Seit Jahrhunderten stehen die Menschen mit ihrem Schlag auf, richten sich bei den Arbeits- und Brotzeiten nach ihr und gehen mit ihr zu Bett. Die Ratsglocke ist für uns alle Ankündiger von weltlicher Freud wie Leid – kein großes urbanes Ereignis ohne deren Läuten! Keine Stadt kann ohne sie sein.«
Remboldt zog die Stirn in Falten. Das tat er immer, wenn er um eine Lösung rang, sich ihm aber keine zu bieten schien.
»Was, Remboldt, wenn ich einen Ort fände, an dem die Ratsglocke noch besser präsent ist als jetzt?«
»Die Glocke wiegt mächtige fünfundvierzig Zentner, so viel hatte zumindest die städtische Heuwaage angezeigt; dazu kommt noch das eiserne Schlagwerk. Wo wollt Ihr einen geeigneten Platz für dieses Monstrum finden?«
»Lasst das meine Sorge sein. Ich will nur eines wissen: Wenn es mir gelingt …?«
»Ich wiederhole mich: Die Zeit ist reif! Löst das Glockenproblem, Holl … und ein neues Rathaus wird gebaut!«
»Hand drauf?«
»Hand drauf!«
Ich hielt ihm den ausgestreckten Arm entgegen. Remboldt schlug ein und zuckte unter meinem starken Zugriff; nach den ganzen Jahren endlich die Gelegenheit für den Bau eines neuen Rathauses zu bekommen, durchströmte mich dermaßen mit der Kraft der Freude, dass ich an mich halten musste, ihn nicht geradewegs zu umarmen.
»Ihr habt eingeschlagen, Remboldt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.«
»Pacta sunt servanda12. Das gilt für mich und für Euch auch!«
»Ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt gehe? Ich brenne, Euch meine Lösung zu präsentieren!«
»Geht, Holl, geht! Und präsentiert mir! Ich bin gespannt!«
Ich trat aus der Tür und eilte durch den Schnee über den leeren Obstmarkt direkt nach dem Neuen Bau. Dort meinen Zollstock und einen Bogen Pergament aus der Poliernische geholt, machte ich Hans’ neugierigen Fragen eine hoffnungsträchtige Andeutung, und strebte geradewegs zum Perlachturm.
Niemals zuvor war ich fiebernder die engen und niedrigen Stufen bis nach oben unter den Dachstuhl geeilt. Es lag auf der Hand, dass nur hier und nirgendwo anders der neue ehrenvolle Hort der Ratsglocke sein konnte. Nachdem ich die Maße der Höhen, Breiten und Tiefen, die Stärken von Wänden und Balken abgenommen hatte, fertigte ich noch oben im Dachstuhl bei eisigen Graden mit meinem Silberstift, den ich stets bei mir trug, eine Skizze an; sie würde mir neben alten Zeichnungen im Atelier für die neue Visierung dienen. Der Perlachturm barg bereits die Sturmglocke, für die Ratsglocke samt Schlagwerk war kein Platz. Beide Glocken waren aber vonnöten, so blieb mir nur, den Turm zu erhöhen. Ich musste ihm ein neues, zusätzliches Stockwerk aufmauern – eigens für die Ratsglocke! Mindestens zwanzig Schuh hoch musste es sein und würde mit einem gefälligen Kuppeldach abschließen. Das vertrug sich bestens mit Remboldts Wunsch nach mehr Erhabenheit Augsburgs; der Perlachturm würde mit einer erneuten Aufstockung über sich hinauswachsen und noch mehr Größe und Würde ausstrahlen. Die Wandstärke jedoch, die mir als Fundament für den Aufbau dienen musste, betrug nur fünfzehn Zoll13; wenig für ein massives und offenes Glockenhaus, dass das ›akustische Machtsymbol‹ für alle Zeit beherbergen sollte, doch es musste reichen.
Als ich den Perlachturm verließ, dämmerte es bereits. Ich ging geradewegs nach Hause, um mich an die Visierung zu machen. Am Eingang zum Atelier im Hinterhof unseres Hauses, die Klinke bereits in der Hand, blieb ich stehen. Sollte ich vorher noch hoch gehen und nach Rosina schauen? Ich rieb mir das Kinn. Die Zeit drängte. Adelgund war ja bei ihr. In Gedanken an Rosina bekreuzigte ich mich und trat ein.
Das Atelier war ausgekühlt. Im Ofen schwelte nur noch ein Rest Glut. Ich warf ein paar Späne ein, die sogleich entflammten, und legte neue Buchenscheite auf. Mit großen Decken verhängte ich die Fenster und legte eine zusammengerollt gegen den Türspalt; die Kälte kroch durch alle Ritzen.
Auf dem Zeichentisch entzündete ich sämtliche Kerzen – zwölf an der Zahl, in einem elliptischen Bogen von den Stirnseiten über die hintere Längsseite angeordnet – und zog alte Risse und Visierungen des Perlachturms aus dem Kartenregal. Diese als Vorlage hergenommen, zeichnete ich zwei Dutzend Entwürfe des neuen Glockenhauses. Das erste Dutzend verwarf ich komplett; nichts davon gefiel mir, noch zu sehr war ich der alten Form des Turms verhaftet. Ich musste Neues wagen, musste mich loslösen vom Althergebrachten; doch mir war auch bewusst, allzu kühn durfte mein Gestalten nicht sein, zu leicht wären konservative Räte vor die Stirn geschlagen und mir der Auftrag abgelehnt. Die ersten Entwürfe des zweiten Dutzends waren mir schon eingängiger, ich orientierte mich an Konstruktionen von Türmen, die ich bereits erbaut hatte, wie den der Sankt Anna Kirche oder den des Wertachbrucker Tors. Die letzten drei Entwürfe brachten dann die Ergebnisse hervor, die mein Gemüt erhellten und von denen ich überzeugt war, einer hiervon fände den einmütigen Anklang des Rates. Diese drei unterschieden sich nur noch in Details; ich legte mich fest auf einen achteckigen Grundriss mit dorischen Säulen.