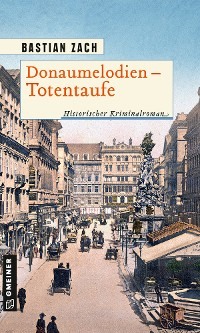Kitabı oku: «Donaumelodien - Totentaufe», sayfa 4
»Sei versichert, ich bin nicht hier, um dir deinen Platz streitig zu machen. Ich bin auf der Suche nach jemandem.«
»Auf der Suche?«, wiederholte Camillo, nachdem er sich gefangen hatte. »Ich fürchte, da bist du bei uns Strottern falsch. Hier unten will keiner gesucht, geschweige denn gefunden werden.«
»Kein Haar will ich demjenigen krümmen, nach dem ich suche. Oder besser gesagt: nach dem sein Weib mich suchen lässt.«
Camillo lachte auf, dass es nur so hallte. »Ich kann mir wahrlich angenehmere Verstecke vor einem Weib vorstellen als hier unten. Im Schoß einer anderen, als Beispiel. Aber jeder, wie er will.«
»Leoš Svoboda heißt der, den ich suche.«
Der andere schüttelte den Kopf. Er überlegte, dann schien er einen Entschluss gefasst zu haben. »Also gut, wie heißt es so trefflich? In der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot.«
»Ich glaube zu wissen, dass es heißt: In der Not schmeckt jedes Brot.«
»Papperlapapp«, insistierte Camillo. »Was ich damit sagen will, ist, ich werde dir helfen. Du kannst mit mir mitkommen, womöglich kennt ja der eine oder andere den, den du suchst.«
Der Strotter hob die Bütte, die er handhoch mit Tierknochen, an denen aufgeweichtes Papier und Fettklumpen hingen, gefüllt hatte, und wies mit dem Kescher den Weg in Richtung eines engen Rohres.
»Hier entlang, buckliger Franz. Und lass Vorsicht walten. Selbst einer wie du muss hier unten zuweilen den Kopf einziehen.«
Franz nickte dankend und folgte dem Strotter in die Dunkelheit der Unterwelt.
Zwei Uhr Nachmittag.
Hieronymus steckte die Taschenuhr zurück in seine Weste. Eigentlich sollte dies die geeignete Zeit sein, dass die Frau sich bereits von den Strapazen der vorangegangenen Nacht erholt hatte, aber noch nicht zu neuem Schaffen aufgebrochen war. Er griff den ehernen Ring, der im Maul eines Löwen hing, und pochte damit dreimal gegen die Tür.
Nichts.
Er wiederholte das Signal. Nun hörte er, wie ein kleines Kind auf der anderen Seite der Tür zu weinen begann.
Schritte eilten herbei.
Die Tür wurde entriegelt … und geöffnet.
Die Frau, die durch den Türspalt lugte, runzelte ungläubig die Stirn. »Hieronymus Holstein?«
»Elsbeth Fränkel«, entgegnete dieser mit einem Lächeln ob der gegenseitigen Bekanntgabe ihrer Namen.
Die blond gelockten Haare völlig zerzaust und nur in ein einfaches helles Leinenkleid gehüllt, öffnete die Frau die große Flügeltür gerade weit genug, damit er eintreten konnte. Dennoch stellte sie sich mitten in den Weg.
»Was in aller Welt wollen S’ von mir?«
»Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Darf ich?«
Elsbeth prüfte mit schnellem Blick, ob sich außer Hieronymus noch andere Personen im Flur befanden. Dann winkte sie ihn unwillig herein.
»Das Peterchen haben S’ auch aufgeweckt«, zischte sie und eilte zu dem Kleinkind, das in eine wollene Decke gewickelt auf einem Sessel lag. Liebevoll nahm sie es in den Arm und wiegte es.
Hieronymus schloss die Tür. »Ich wollte Ihnen kein Ungemach verursachen, Frau Fränkel«, sagte er und meinte es auch so.
»Das wollten S’ das letzte Mal auch nicht, und schauen S’ mich an. Der Wilhelm hat sich seither nicht mehr blicken lassen. Oppenheim hat sich in seiner Zelle erhängt, der wird also in naher Zukunft auch keine Gesellschaften mehr veranstalten. Frau Barbara musste ich auf zwei Tage die Woche beschränken, an denen ich schauen muss, wie ich das Geld für die restliche Woche aufstelle. Erzählen S’ mir also bitte nichts von dem, was Sie wollen, wenn sich doch alles zum Argen wandelt.«
Kraftlos setzte sie sich auf den Sessel, wischte sich trotzig die Tränen aus den Augen. Sie wirkte übermüdet, die üppigen Lippen rau, die unzähligen Sommersprossen auf Gesicht und Hals stumpf.
Hieronymus seufzte. Natürlich tat ihm die Frau leid, war er es doch gewesen, der sie erpresst hatte. Der sie erpressen musste, um seine eigene Haut zu retten. Dass sie dabei Schaden nehmen würde, hatte er zwar vermutet, aber hintangestellt.
»Umso anmaßender klingt dann wohl der Grund meines Besuchs«, sagte er und setzte sich ihr gegenüber.
»Ich vermute, Sie brauchen etwas von mir?«
»So ist es, Frau Fränkel.«
»Werde ich danach noch tiefer fallen? Mich gar am Graben oder am Spittelberg feilbieten müssen?«
Hieronymus konnte ein Schmunzeln ob der Offenheit der Frau nicht zurückhalten. »Das müssen Sie mit Sicherheit nicht, mein Wort darauf.«
Elsbeth schnaubte verächtlich.
»Gerne werde ich Ihnen berichten, wie es dazu kam, dass es mich nach Wien verschlagen hat. Das Ausmaß meines Schmerzes, meiner Pein, die mich seit neun Jahren malträtiert.« Er hielt seine rechte Hand in die Höhe, an der der kleine Finger fehlte. »Und ich spreche nicht hiervon. Aber ich vermute, dass Sie das im Augenblick nicht wirklich interessiert.«
»Da haben S’ recht, tut es nicht«, sagte sie knapp und hart. Dann wurde ihre Stimme sanft. »Und doch freue ich mich, dass Sie es geschafft haben, Ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Auch wenn dies gewissermaßen mein Verdienst war.«
»Da haben Sie recht, das war es.«
Elsbeth seufzte schwer. »Dann rücken S’ schon heraus damit. Was brauchen S’ diesmal?«
»An jenem Abend bei Oppenheims Soirée«, begann Hieronymus, »da tummelte sich eine illustre Schar an Gästen im Palais Rasumofsky.«
»Alles Herren der besseren Gesellschaft, die meinen –«, Elsbeth legte beide Hände auf die Ohren des nun schlafenden Kindes, »dass ihre Libido so groß und ihre Schwänze so hart sind wie ihre Bankkonten prall gefüllt. Was natürlich reines Wunschdenken ist.«
Hieronymus und Elsbeth teilten ein Lächeln.
»Sie verstehen es wahrlich, einem Mann den Kopf zu verdrehen«, meinte er und wurde wieder ernst. »Einer der Gäste war ein Böhme namens František Skorkovský. Er hat etwa mein Alter, rötliche Haare, groß gewachsen. Ein zackiger Mann, spricht mit kaum hörbarem Akzent.«
Elsbeths Blick wanderte im Raum umher, immer wieder verengten sich ihre Augen zu Schlitzen. »František … František Skorkovský.« Schließlich schüttelte sie den Kopf. »Der Name ist mir nicht geläufig. Ich kann mich nicht einmal an einen Herrn mit rötlichen Haaren erinnern.« Als sie Hieronymus’ Enttäuschung sah, fügte sie hinzu: »Aber seien Sie versichert, dass es mir aufrichtig leidtut.«
»Schon gut, es war einen Versuch wert«, meinte dieser mit gedämpfter Stimme. »Wie geht es dem kleinen Peterchen?«
Elsbeth hob die Decke vom Gesicht des Buben in ihren Armen. »Schauen S’ selbst. Er wächst so schnell, dass ich ihm dabei zuschauen könnt. Und jeden Tag schaut er seinem Vater ähnlicher, finden S’ nicht?«
Hieronymus schmunzelte ob der Anspielung auf Wilhelm Marx, Präsident der Wiener Polizei, einem glücklich verheirateten Mann mit einem außerehelichen Kind. Er selbst jedoch hatte, wie versprochen, dieses Geheimnis bewahrt, war es doch weder die Ausnahme noch eine Seltenheit. Beinahe jeder Dorfpfaffe könnte davon ein Liedchen singen, das wusste er.
»Ja, ganz der Herr Papa«, stimmte er der Mutter zu. »Apropos, ich werde wohl morgen bei besagtem Papa bezüglich meiner Suche nach diesem František vorstellig. Ich vermeine, es könnte nicht schaden, ihn darauf hinzuweisen, dass er sich ein wenig mehr um seinen Sohn bemühen sollte. Wenn schon nicht persönlich, so zumindest pekuniär?«
Elsbeth lächelte gütig, so wie Hieronymus sie zum ersten Mal getroffen hatte, damals im Café Central. »Das wäre eine schöne Geste von Ihnen.« Sie schien noch etwas hinzufügen zu wollen, besann sich dann jedoch anders und schwieg.
Hieronymus stand auf. »Dann auf bald, Frau Fränkel.«
Sie begleitete ihn zur Wohnungstür. »Ja, auf bald.« Dann gab sie ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Und danke.«
Nachdem Franz und Camillo über drei Griasler, wie man Obdachlose hier nannte, geklettert waren, die eng aneinandergekauert auf einem groben Steinhaufen schliefen, waren sie in einen Stollen gekrochen, gerade groß genug, dass man die fünfzig Meter Länge auf allen vieren überwinden konnte.
Camillo hielt vor sich eine kleine Öllampe, die bei jeder Bewegung einen Schwall an Ruß ausstieß, wie eine Dampflokomotive, die anfuhr.
Daraufhin gelangten sie in einen Raum, aus Ziegeln gemauert, in dem zwar die Luft feuchtschwül drückte, der aber ansonsten einen reinlichen Eindruck machte.
»Ist die Küche«, erklärte Camillo, mit einem Stolz in der Stimme, als würde er durch Wiens Sehenswürdigkeiten führen. »Hier drin haben die Arbeiter, die den Kanal einst erbauten, ihre Mahlzeiten gekocht. Ist ein begehrter Schlafplatz, aber auch eine wahre Todesfalle. Denn bei Überschwemmung sammelt sich das Wasser hier drin bis zur Decke, bevor es in die Wien abfließen kann.«
Im angrenzenden Stollen, der nur marginal breiter war, mussten Franz und Camillo einen Schlafenden überklettern, der so tief schlummerte, als wäre er bereits tot.
Ein weiterer Raum, nur halb so hoch wie ein Mann, verschaffte den gebeugten Rücken der beiden Männer ein wenig Erholung, bevor es einen Schlauch zu durchklettern hieß. Einhundert Meter lang, leicht aufsteigend und nur passierbar, indem man auf dem Bauch vorwärtsrobbte.
Drei Pausen später, völlig außer Atem und in Schweiß gebadet hatte Franz Camillo schließlich eingeholt, der sich bereits den Rücken im nächsten Raum durchstreckte. »Der Schlauch geht uns allen am Arsch«, kommentierte er den Weg. »Aber was willst machen? Die Bauherren haben sicherlich nicht ins Kalkül mit einbezogen, dass hier einmal Menschen hindurch sollten.«
Franz war, als wäre er erneut von einem Fuhrwerk überrollt worden. Schulterblätter, Ellbogen und Hüfte schmerzten kolossal. Und der Schädel brummte ihm, als hätte er die Nacht durchgetschechert, was zwar stimmte, seinen Zustand schrieb er aber dennoch der schlechten Luft zu.
»Ab nun wird es einigermaßen erträglich, zumindest, was die Höhe betrifft«, sagte Camillo und deutete auf eine türähnliche Öffnung in der gegenüberliegenden Mauer. Diese war mit dem Ort, an dem sie standen, nur durch ein schmales Brett verbunden, unter dem es mehrere Meter in die Tiefe ging.
»Jetzt stehen wir genau unter dem Schwarzenbergplatz. Und dort drüben liegt die Zwingburg. Wer länger hier unten haust, erschläft sich irgendwann das Recht auf einen Platz da drin. Ist sicher hier. Denn wenn man das Brett wegzieht, dann können einem nicht einmal die Kieberer auf den Pelz rücken.«
Camillo überquerte das schwankende Brett wieselflink, Franz mit der Bedächtigkeit eines Ochsen, der über eine Stange balanciert.
Hinter einem alten Kotzen, der als Vorhang diente, öffnete sich ein weitläufiger Raum, der voller Menschen war, hauptsächlich Männer jeden Alters. Sie schliefen dicht aneinandergedrängt, damit die Wärme der Leiber nicht unnötig in die Luft entwich, saßen rauchend zusammen oder starrten stumm auf das Gewölbe über ihnen, oftmals eine Flasche in der Hand.
Wellen furchtbarer Ausdünstungen schlugen Franz ins Gesicht, vermischt mit dem Geruch von Rauch und Moder. Er musste sich beherrschen, sich nicht zu übergeben, machte nur kleine Atemzüge, wie ein Fisch, der an Land gestrandet lag.
Mehrere Röhren führten von hier wieder weg, und in kleinen Mauernischen, über die mit Kreide verschiedene Initialen geschrieben standen, horteten die Strotter ihre Beute.
Diebstahl musste man hier wohl nicht fürchten, dachte sich Franz ein wenig überrascht.
»Was für einen Krüppel zahst denn da an, Don Cavallo?« Ein alter Mann mit eingefallenem, ledrigem Gesicht und kehliger Stimme, der auf einer zerschlissenen Filzdecke hockte, blickte zu den beiden Männern auf.
»Reg dich ab, Gurginger«, entgegnete Camillo, »der bleibt eh nicht lang bei uns.«
Franz griff in eine Manteltasche und holte eine der Zigaretten hervor, von denen er wohlweislich im Vorfeld einige erstanden hatte. »Bin der bucklige Franz. Willst eine Tschick21?«
Die stumpfen Augen des Alten blitzten für einen Moment auf, mit überraschend flinkem Griff schnappte er sich die Rauchware. »Ach was, du bist schon recht. Bin ein alter Stänkerer, war nicht so gemeint.«
Franz nickte ihm zu, sah dann ernst Camillo an. »Wen soll ich hier unten fragen?«
Der tätschelte ihm mit seiner vor Schmutz starrenden Hand die Schulter.
»Sternkreuzdiwidomini! Hör zu, mein Freund, so schnell geht das hier bei uns Schrobs nicht. Gut Ding braucht Eile mit Weile. Komm, wir setzen uns zu meinem Lager und du erzählst mir ein wenig von der Oberwelt und wie sie so geworden ist, seit ich sie verstoßen habe. Und wennst noch die eine oder andere Tschick hast, dann kann’s auch nicht schaden.«
19 Großer, ungeschlachter Mann.
20 Begrapscht.
21 Wienerisch: Zigarette.
X
Der Mann der Sicherheitswache mit dem aufgedunsenen Gesicht starrte Hieronymus an, als hätte er ihn noch nie im Leben gesehen. Doch dann schien er sich zu erinnern.
»Ah, weiß schon wieder. Alsdann, Herr Holstein, der Herr Präsident wird Sie empfangen.«
Hieronymus war gerade im Begriff, die Polizei-Direction zu betreten, als die Wache ihm den Weg versperrte. »Immer schön langsam. Warten S’, bis man Sie hier abholt und dann raufbringt, Herr Holstein.«
»Herzlich gerne«, log dieser.
»Der Herr Geisterfotograf. Er hat schon wieder verlangt, mich zu sprechen?«, fragte der Polizeipräsident in Anspielung an ihr erstes Treffen und konnte sich dabei ein Schmunzeln nicht verkneifen.
»Hat er«, antwortete Hieronymus, der in einem dunkel getäfelten Raum stand, in dessen Mitte ein Schreibtisch thronte, und in dessen Schränken sich unzählige Akten stapelten. »Zumindest das Umfeld ist ein angenehmeres als bei unserem Kennenlernen.«
Wilhelm Marx überlegte kurz. »Ich gestehe, die Stube zur Befragung kann furchteinflößend sein. Soll sie ja auch. Setze er sich hin.«
Der Angesprochene tat, wie ihm geheißen.
»Erzähl er, wie ist es ihm nach unserem letzten Treffen ergangen?«
»Gut genug, dass ich darüber zu klagen weiß«, antwortete Hieronymus, der keine Lust auf ein Plauscherl22 hatte. »Der Grund meines Kommens ist –«
»Er will etwas von mir.« Marx schob die Brauen zusammen und strich sich über den Backenbart.
»Ganz recht. Ich bin auf der Suche nach jemandem, einem Mann, gebürtig aus Prag.«
»Wenn er einen Behm sucht, sollte er sein Glück am Wienerberg versuchen.«
Hieronymus wiegelte ab. »Einen Behm der feineren Gesellschaft werde ich dort wohl kaum antreffen. Sein Name ist František Skorkovský. Ich weiß zwar nicht, ob er in Wien gemeldet ist, aber einen Versuch ist es allemal wert.«
»Und was will er von ihm, wenn er ihn gefunden hat, diesen Behm?«
»Ich will ihm nur ein paar Fragen stellen.«
Marx’ Gesichtsausdruck verfinsterte sich.
»Ich schwör’s«, bekräftigte Hieronymus, ohne die Stimme zu erheben. »Was würde es auch für einen Sinn ergeben, mich beim Präsidenten der Wiener Polizei nach einem Mann zu erkundigen, wenn ich ihm Leid zufügen will?«
Der Präsident schien sich wieder ein wenig zu entspannen. »Da hat er zwar recht, aber die Leute heutzutage begehen Taten, da greift man sich nur noch aufs Hirn. Jedem Gefühl gleich nachgebend, nicht auch nur den Funken Verstand. Trotzdem muss ich ihn enttäuschen. Zivilpersonen können wir eine solche Auskunft nicht erteilen.«
»Sie meinen, nach allem, was geschehen ist, können Sie mir nicht helfen?«
»Vorschriften sind nun mal dafür da, um eingehalten zu werden.«
»Wo kämen wir auch hin, wenn wir uns gegenseitig helfen würden?«, knurrte Hieronymus verärgert ob des Bürokraten.
Die Tür zum Raum wurde aufgerissen, ein Mann der Sicherheitswache stürmte mit hochrotem Kopf herein. »Wir haben wieder einen gefunden!«, keuchte er. Als er den überraschten Blick des Präsidenten bemerkte, nahm er Haltung an. »Entschuldigen S’ bitte vielmals, aber –«
»Man hat wieder einen gefunden. Ich kann ihm folgen«, sprach Marx gefährlich ruhig.
»Nur diesmal ist es kein Arbeiter oder Tagelöhner. Diesmal –« Der Wachmann brach ab und hustete, als wollte sich seine Lunge nach außen stülpen.
Marx sprang auf und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Genug! Komm er zu Atem und erstatte er Meldung, wie es sich geziemt, oder er wird ab morgen Nachtwache bei den Latrinen schieben!«
Hieronymus empfand einen Hauch von Mitleid mit dem jungen Mann, ließ sich aber nichts anmerken.
Dieser nahm nun, so gut er konnte, Haltung an, atmete zweimal tief ein und aus und salutierte zackig.
»Herr Präsident. Wir haben erneut eine grausam zugerichtete Leiche gefunden. Den Merkmalen der Tat nach zu urteilen artverwandt mit den Untaten an dem Jaritz und dem Pacheleb. Der Verschiedene ist der honorige Dr. Eugen Bonifaz Gasser.«
Marx sah den Boten nun etwas milder an. »Warum sagt er das nicht gleich?« Der Präsident strich sich den Bart zurecht. »Lass er alles vorbereiten, ich bin in zehn Minuten vor dem Haupttor.«
Die Wache deutete eine Verbeugung an und eilte mit einem dünnen »Sehr wohl« aus dem Raum.
»Gasser … Gasser«, murmelte Marx zu sich selbst. »Mir deucht, ich bin dem Mann dereinst begegnet.« Er sah Hieronymus finster in die Augen. »Ein roher Geselle, vom Auftreten her mehr Fleischhacker denn Dokteur.«
»Zumindest klingt das nach jener Art von Fall, über die Sie sich gerade echauffiert haben. Ohne Hirn, nur einem Gefühl nachgehend.«
»Gut möglich«, murmelte Marx und maß sein Gegenüber vom Scheitel bis zur Sohle. »Verdingt er sich noch immer mit diesen zweifelhaften Fotografien?«
»Damit verdingt er sich.«
»Dann hole er die notwendigen Apparaturen und komme zur Adresse der Gräueltat. Womöglich kann er von Nutzen sein.«
Hieronymus überlegte, wenn auch nur für einen Atemzug.
»Er will doch noch Einblick ins melderechtliche Register, oder etwa nicht?«
»Will er.«
»Die Adresse soll ihm beim Hinausgehen mein Sekretär geben.«
Hieronymus stand auf. »Ich bin in einer Stunde dort.«
Die Wohnung im zweiten Stock in der Esslinggasse war großzügig angelegt, mit zwei Wohnsalons, einer Küchennische, einem kleineren Arbeitsraum und einem Schlafsalon. Die Luft in allen Räumen war stickig und trüb, als hätte man gerade einen Teppich ausgeklopft. Das Schwirren von Fliegen war allgegenwärtig, es roch nach Ausscheidung und Fäulnis. Es roch nach Tod.
Mit zwei schweren Koffern in den Händen betrat Hieronymus die Räumlichkeiten, die von vier Mann der Sicherheitswache gegen neugierige Nachbarn und noch neugierigere Schreiberlinge der Gazetten abgeschirmt war. Er brauchte einige Atemzüge, bis er sich an die strengen Gerüche gewöhnt hatte, setzte dann seinen Weg dorthin fort, wo Wilhelm Marx sowie zwei weitere Männer zusammenstanden und sich besprachen. Einer von ihnen trug die Uniform der Sicherheitswache, der andere einen eleganten Frack.
»Hieronymus Holstein zur Stelle«, meldete er lautstark und mit mehr Schwung in der Stimme, als er eigentlich wollte.
Marx schenkte ihm nur einen schnellen Blick. »Bau er seine Sachen dort auf, von wo er am besten das gesamte Geschehen überblicken und ablichten kann. Ich habe die spezielle Order herausgegeben, dass hier nichts verändert werden darf, bevor er nicht alles eingefangen hat. Verstanden?«
Hieronymus nickte und betrat den zweiten Raum. An den Wänden hingen die gebleichten Schädel geschossener Trophäen, von Hirschen und Bären, wie auch von großen Raubkatzen, die der offenbar passionierte Jäger in Afrika geschossen haben musste. Am Boden, mit dem Rücken zum Türstock, lehnte der leblose Körper einer älteren Frau. Sie saß inmitten ihres eigenen Blutes, das vom Halse abwärts geronnen war und unter ihr am Teppich einen großen dunklen Fleck bildete. Ihr Kopf wirkte zum Körper wie der Deckel einer Dose, den man geöffnet und zur Seite geklappt hatte. An der klaffenden Wunde und ihren leblosen Augen labte sich bereits das Ungeziefer.
Keine vier Fuß entfernt lag ein Stuhl am Boden, an den ein alter Mann gefesselt war. Jeden Einzelnen seiner Finger hatte der Mörder am Gelenk abgezwickt, die einzelnen Glieder wirkten willkürlich um ihn herum verstreut. Den Mund hatte der Tote weit aufgerissen, die Augen bildeten nur mehr dunkelrote Höhlen im blutbefleckten Schädel, gleich zweier Frühstückseier, die man mit einem Löffel sorgfältig ausgeschabt hatte. Die Dielen des Bretterbodens waren dunkelrot verfärbt.
Beim Anblick der beiden geschändeten Körper lief Hieronymus ein Schauer über den Rücken. Der Täter hatte hier ganz offensichtlich nicht wahllos gewütet, er hatte seine Tat zelebriert.
Hieronymus öffnete seine Koffer, baute ein schweres Dreibeinstativ auf und befestigte darauf die Plattenkamera. Zu guter Letzt setzte er eine Gelatine-Trockenplatte in den Apparat ein.
Dann öffnete er die beiden Flügelfenster, ließ das Tageslicht hereinströmen und den Dunst hinausziehen.
»Wenn die Herren so freundlich wären und einen Schritt zurückgingen!«
Marx und die anderen Männer taten, wie ihnen geheißen.
Hieronymus holte eine Messingschale aus dem Koffer, füllte eine Handvoll weißes Pulver hinein und entzündete ein Streichholz. Er nahm den Deckel vom Objektiv der Kamera, fuhr das Flämmchen des Streichholzes zu dem Pulver hin und schloss die Augen.
Ein greller Blitz durchzuckte den Raum, gefolgt von dichtem weißem Rauch.
»Sind Sie von Sinnen?«, echauffierte sich der Sicherheitsmann an Marx’ Seite. »Oder wollen S’, dass wir blind werden?«
»Na, na«, beruhigte ihn der andere Mann im Frack mit unüberhörbarem norddeutschem Akzent. »Unser eifriger Fotograf hier will nur den Moment einfangen. Und dafür braucht er eben viel Licht. Sie gehen ja auch nicht mit geschlossenen Augen durchs Leben.«
Hieronymus schob die Abdeckung auf das Objektiv und nickte dem Mann mit dem viel zu schmalen Oberlippenbart zu.
Der schritt zu ihm, schlug die Hacken zusammen. »Gestatten: Salomon Stricker mein Name.«
»Hieronymus Holstein. Und Sie sind als –«
»Er unterstützt uns durch pathologische Erkenntnisse«, unterbrach ihn Marx. »Aber das geht ihn nichts an. Wie viele Ablichtungen will er noch machen?«
»Zwei«, bestimmte Hieronymus klar.
»Dann gehen wir vor die Tür eine rauchen, meine Herren, bis sich der Pulverdampf verzogen hat.« Mit diesen Worten verließen Marx und seine beiden Gehilfen die Räumlichkeiten.
Nachdem Hieronymus seine Arbeit erledigt und alles wieder in den Koffern verstaut hatte, betraten die drei Männer der Polizei erneut den Tatort.
»Wie ich bereits sagte, meine Herren«, nahm Salomon das Gespräch wieder auf. »Eine solch ruchlose wie brutale Tat kann nur das Werk eines gänzlich ruchlosen Individuums sein. Ein Mann von grober Statur, der es gewohnt ist, sein Tagewerk mit Muskelkraft zu erledigen, dem jeglicher Sinn für das Schöne und Feine fehlt.«
»Oder es war ein kleiner schmächtiger Kerl, der nur den Anschein erwecken wollte, er sei all das eben nicht«, warf Hieronymus ein.
Salomon lachte hell auf, selbst Marx konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
»Was Sie nicht sagen.« Der Pathologe fuhr mit dem Zeigefinger über seinen Oberlippenbart. »Die meisten Mordbuben sind von einfachem Gemüt, doch verstehen sie sich bestens darauf, nur das zu tun, was ihnen Körper und Talent gestattet. Ein kleiner flinker Mensch wird eher als Taschenzieher erfolgreich sein als ein Grobschlächtiger.«
»Und eine Frau?«
»Allein durch ihre angeborene körperliche Schwäche sind die Weiber so gut wie nicht imstande, ein anderes Vergehen als das des Giftmordes zu verüben. Schon gar nicht –«, Salomon deutete auf die beiden Leichen, »so etwas Gräuliches. Anselm von Feuerbach vertrat die Ansicht, dass –«
»Das genügt, Herr Stricker! Mach er sich an die Arbeit, für die er hier ist.«
Der junge Mann gehorchte widerspruchslos.
»Und was ihn angeht«, wandte sich Marx an Hieronymus. »Wann kann er mir die Fotografien bringen?«
»Morgen Mittag.«
Der Präsident schien überrascht. »Das freut mich zu hören. Dann reden wir auch noch einmal über diesen Behm, wegen dem er mich heut aufgesucht hat.«
Hieronymus nickte wertschätzend und wollte gerade gehen, als ihm etwas auffiel. Ein kleines Stück Papier, zusammengeknüllt am Boden liegend, am gedrechselten Fuß einer Kommode. Er bückte sich, hob es auf und entfaltete es. Mit schwarzer Feder stand darauf beschwingt geschrieben: »19.Lb2–f6+«.
»Sagt Ihnen das etwas?« Er hielt Marx das Papierstück hin.
Der überlegte, zuckte schließlich mit den Schultern. »Eine Notiz von Dr. Gasser vielleicht? Könnte ein Rechenbeispiel oder eine Formel sein.« Er nahm es und steckte es ein. »Wohl kaum etwas, was der Mörder gesucht hat. Genau genommen scheint er sich gar nicht am Besitz des Doktors vergriffen zu haben. Alle Schränke sind geschlossen, ebenso die Kommoden. Leuchter und Tafelsilber, Geschmeide und Uhren, alles unangetastet.«
»Es war also etwas Persönliches?«
»Zumindest deutet alles darauf hin«, meinte Marx nachdenklich.
Hieronymus zwirbelte seinen Schnurrbart. »Mit ›persönlich‹ meine ich eine Angelegenheit mit dem seligen Herrn Doktor. Im Gegensatz zu ihm wurde seine Frau Gemahlin geradezu abgeschlachtet, als wäre sie im falschen Augenblick hinzugekommen. Sofern dies seine Gemahlin war.«
Marx warf einen schnellen Blick auf die Frau, die am Türstock lehnte, und nickte dann. »Wir sehen uns, Herr Holstein.«
Mit einem Mal mischte sich in die abgestandene Luft der Wohnung und dem Geruch nach Kanal und Pferdemist, der von der Straße hereinzog, noch ein anderer »Duft«, kaum wahrnehmbar und doch beherrschend – der von Erbrochenem. Hieronymus begann den Raum abzusuchen, bückte sich zur Verwunderung der anderen, kniete sich hin, dann legte er sich flach mit dem Bauch auf den Boden. In dieser Haltung robbte er bis zu einer Vitrine und holte unter ihr einen Fetzen Stoff hervor, der mit Blut ebenso vollgesogen war wie mit Erbrochenem.
»Ich vermute, ein Knebel?«
»Sie hätten wohl ein Spürhund werden sollen«, spottete die Sicherheitswache, gefolgt von einem hässlichen Lachen.
»Im Gegensatz zu ihm zeigt der Fotograf wenigstens ein wenig Eifer!«, konterte Marx scharf. »Und nun spute er sich, eine der Wachen vor der Haustür abzulösen. Hier drin atmet er uns nur die Luft weg.«
Die Sicherheitswache warf Hieronymus einen verachtenden Blick zu, der das mit einem überfreundlichen Grinsen goutierte, und stürmte aus der Wohnung.
»Unsere Leute werden auch immer deppata23«, rutschte dem Präsidenten im volksnahen Jargon heraus und er musste über sich selbst schmunzeln.
Salomon verzog scheinbar uninteressiert den Mund. »Scheint sich in der Tat um einen Knebel zu handeln. Bravo, Herr Holstein.«
Hieronymus spürte, dass ihn dieser Fall nicht kaltließ, mehr noch, er hatte das Gefühl, als könnte er gar zu seiner Lösung beitragen. Aber er wusste auch, dass er mit Bedacht vorzugehen hatte, wollte er bei Marx etwas erreichen.
In einem lapidaren Tonfall sagte er: »Wenn Sie mich nicht mehr benötigen, Herr Präsident, widme ich mich der Entwicklung der Fotografien. Wer weiß, welche Auffälligkeiten mir noch ins Auge stechen, wenn ich erst die Bilder entwickelt habe.«
»Ja«, meinte Marx nachdenklich und schien dann einen Entschluss zu fassen. »Was hält er davon, wenn er uns ein wenig von außen unterstützt? Gänzlich unbegabt scheint er ja nicht zu sein.«
Hieronymus gab den Überraschten.
»Er könnte sich ja dort umhören, wo unsereins nur schwerlich an Informationen herankommt. In den Bierhallen, den Raufnestern. Überall dort, wo man Dinge lieber unter sich regelt, als das Recht des Staates in Anspruch zu nehmen. Wenn er seine Sache gut macht, kann er sich ja vielleicht sogar selbst durch die Melderegister wühlen.«
Nun horchte Salomon auf, der über den Leichnam des Doktors gebeugt war und Beobachtungen in sein Notizbuch schrieb. »Ich darf doch sehr bitten, Herr Präsident!« Erhobenen Hauptes stellte er sich vor seinen Vorgesetzten. »Seit wann ist die Wiener Polizei auf irgendwelche dahergelaufenen Kiebitze angewiesen? Wir können –«
Marx legte dem sich ereifernden Mann die Hand auf die Schulter, weniger zur Beruhigung als mehr zur Ermahnung. »Jetzt sei er nicht so. Wir von der Wiener Polizei lassen uns ja auch von übereifrigen Herren aus dem Deutschen Reich unterstützen, oder sollten wir das auch nicht zulassen?«
Salomons Gesichtsfarbe hatte ein ungesundes Dunkelrot angenommen. »Ich lebe schon seit über fünfzehn Jahren hier!«
»Hört man so gar nicht, wenn Sie die Gosch’n24 aufmachen«, stichelte Hieronymus.
Salomon machte einen Schritt auf ihn zu, der Geisterfotograf ballte schon die Fäuste. Da hob Marx die Hände.
»Nun beruhigen sich alle wieder.« Er sah zu Salomon. »Hitzköpfe brauche ich genauso wenig wie Oberg’scheite25.« Dann zu Hieronymus: »Über den Stand der Ermittlung kann er sich bei meinem Sekretär erkundigen. Außerdem erstattet er mir unverzüglich und persönlich Meldung, sofern er etwas in Erfahrung bringt. Er kann jetzt gehen.«
Während Hieronymus die Wohnung verließ, wandte sich Marx noch einmal an Salomon.
»Und er lernt besser heute als morgen, mit Kollegen zusammenzuarbeiten. Zwei tote Hackler sind schon schlimm genug. Aber jetzt haben wir einen renommierten Arzt, der auf die gleiche Art und Weise zugerichtet wurde, wie die beiden davor. Wenn die Presse Wind davon bekommt, dann kann er sich die Schlagzeilen ja ausmalen. Mir reichen noch die Titelseiten mit dem ›Dirndlhacker‹ und Schmähungen des Polizeiapparats Seiner Majestät.«
Marx holte tief Luft.
»Ich hoffe, ich habe mich deutlich ausgedrückt. Oder die nächste Arbeit, die er zugewiesen bekommt und die mit Leichen zu tun hat, ist das Ausschaufeln von Gräbern am Zentralfriedhof. Verstanden?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ Marx Salomon Stricker stehen und verließ ebenfalls den Tatort.
22 Wienerisch: zwanglose Unterhaltung.
23 Wienerisch: dämlicher.
24 Wienerisch: Mund, Maul.
25 Klugscheißer.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.