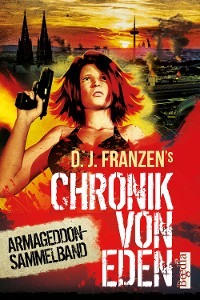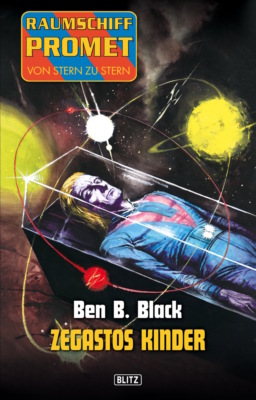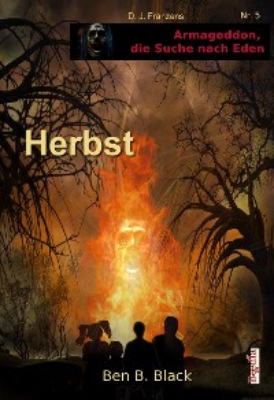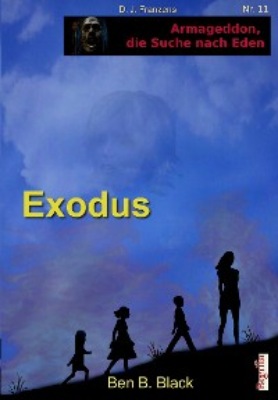Kitabı oku: «Chronik von Eden», sayfa 13
Kapitel VIII - Unbequeme Wahrheiten
Frank stand zwischen den Häusern, die die ersten Ausläufer der Ortschaft Königsdorf bildeten. Regungslos beobachtete er das Massaker, dass die paar Menschen unter den Zombies angerichtet hatten. Nicht dass ihm die wandelnden Leichen leid taten. Von Ihnen gab es mehr als genug, auch wenn es Zeit kosten würde, sie zu rufen.
Sie zu rufen. Ja, das war eines der Dinge, über die er nachdenken musste. Das andere waren die Kinder und der schlaksige Mann auf dem Acker, und das, was da mit den Zombies geschehen war. Leise zog Frank sich in eines der leer stehenden Häuser zurück. Zwei weibliche Zombies gingen mit ausgestreckten Armen und aufgerissenen Mündern auf ihn zu. Ein kurzer Blick auf die zwei, ein Gedanke ... und sie vergaßen umgehend ihre Feindseligkeit. Ihre Arme fielen kraftlos herunter, ihre Münder schlossen sich. Der typisch tumbe Ausdruck von Untoten machte sich auf ihren Gesichtern breit. Frank schauderte. Sie hatten auf ihn gehört, ohne dass er ein Wort gesagt hatte. Die anderen Zombies, da hinten auf dem Acker, waren seinen Gedanken ebenso gefolgt, wie die, die ihm aus dem zerstörten Köln hierher gefolgt waren. Sie waren wie ferngesteuerte Spielzeuge gewesen, während er sich einfach nur vorstellte, was sie als nächstes tun sollten. So hatten sie auch die Kinder attackiert, als er sie auf der Autobahn bemerkt hatte. Gefolgt waren sie ihnen freiwillig, gelenkt durch ihrem Instinkt. Aber die Art, wie sie ausgeschwärmt waren und die Flüchtlinge in die Zange genommen hatten ... das waren Franks Vorstellungen gewesen. Hatte der merkwürdige Fremde ihm etwas gegeben, das ihm Macht über die Untoten gab? Wenn ja, dann war es nur logisch, dass die Kinder oder der Schlaksige auch etwas erhalten hatten, das ihnen die Möglichkeit gab, die Zombies ohne Waffen zu bekämpfen. War das auch der Fremde gewesen?
»Nein, das war mein Freund gewesen.«
Die Stimme in Franks Rücken vibrierte vor schlecht unterdrückter Enttäuschung. Eisige Kälte strömte von dort aus, wo Frank den Fremden vermutete. Ohne sich umzudrehen stellte er seine Frage.
»Haben Sie mir die Kontrolle über die Zombies gegeben?«
Ein leises Lachen.
»Natürlich. Sonst wärst du trotz all deiner Vorzüge recht nutzlos für mich.«
»Warum?«
»Warum?« Genervtes Seufzen. »Warum, warum, warum ... ihr Menschen seid so besessen auf Antworten, dass ihr die Fragen gar nicht mehr seht oder euch an Geschenken erfreuen könnt, die man euch macht.«
»Hüte dich vor den Griechen, wenn sie Geschenke machen. Ich bin kein echter Mensch mehr. Schon vergessen?«
Wieder dieses leise Lachen.
»Touché. Selbst in deinem jetzigen Zustand scheinst du mir ein würdiger Gegner für ein verbales Gefecht unter Freunden zu sein.«
Eine Hand legte sich auf Franks Schulter. Sie war so kalt, dass er fröstelte.
»Und das ist der Grund, warum ich dich auserwählt habe.«
»Wer sind Sie? Was sind Sie?«
»Mann nennt mich Gabriel, mein Freund.«
»Gabriel, wie der Erzengel?«
Der Fremde schwieg, was Frank als Zusage deutete. Er wollte sich immer noch nicht umdrehen, dem merkwürdigen Fremden nicht ins Gesicht blicken. Sein Hass war auf dem Weg hierher verraucht. Zurückgeblieben war eine merkwürdige Leere in ihm, eine Gefühlskälte, welche die dunklen Flecken auf der Landkarte seiner Erinnerung nur noch schlimmer machte. Sandra. Wie hatte sie ausgesehen?
»Erinnerung und Gefühle werden allenthalben weit überschätzt. Sie hindern einen nur daran, das zu tun, was getan werden muss.«
»Lesen Sie meine Gedanken?«
Die Hand verschwand mit einem leisen Rascheln von feinstem Stoff. Zurück blieb nur eine Stelle an Franks Schulter, die sich wie gefroren anfühlte.
»Für mich eines der einfachsten Dinge des Universums, mein Freund.«
»Warum lassen Sie mich nicht einfach sterben.«
»Weil du eine Aufgabe hast. Erst wenn die erfüllt ist, kann ich dir diese Gnade gewähren.«
»Und bis dahin?«
Seufzen im Dunkeln.
»Schon wieder eine Frage.«
»Ich bin keine Schachfigur.«
»Ach, glaubst du?«
»Ich habe einen freien Willen.«
»Na gut. Wenn du das so siehst ...«
»Welche Aufgabe?«, fuhr Frank dem Fremden dazwischen.
»Du sollst mir Seelen bringen.«
»Und wenn ich mich weigere?«
Heißer Schmerz brandete unvermittelt in Frank auf. Stöhnend brach er in die Knie, als die verletzten Teile seines Körpers ihre Hilferufe durch seine Nervenbahnen an sein Gehirn sandten.
»Eine Ewigkeit, mein Freund, eine Ewigkeit. Das, was ihr Menschen als Fegefeuer bezeichnet, wird sich durch deinen Körper fressen, immer und immer wieder, auf alle Ewigkeit. Und du wirst nichts dagegen tun können.«
»Das ... hält kein ... Mensch aus!«
»Richtig. Ein Mensch wäre bei diesen Schmerzen schon ohnmächtig zusammengebrochen. Du bist aber kein Mensch mehr, wie du selber noch vor wenigen Augenblicken so eloquent dargelegt hast.«
»Hilfe«, röchelte Frank. »Helfen Sie mir ... bitte!«
Die Schmerzen verschwanden so abrupt, wie sie gekommen waren. Frank lag zitternd auf dem Boden.
»Nimmst du meine Geschenke an? Und somit auch deine Aufgabe?«
Frank konnte nur nicken.
»Dann gehe hin, und tue wie dir geheißen. Gehe hin, mein Sohn, und vollende ... Gottes Werk.«
Frank stellte sich auf unsicheren Beinen wieder auf. Täuschte er sich, oder hatte der Fremde für einen Moment gezögert, als er den Namen des Herrn in den Mund nahm? Unsicher sah Frank sich um. Der Fremde war weg.
»Und dennoch beobachte ich dich.«
»Das habe ich befürchtet.«
»Und? Wirst du folgen?«
Eine bittere Erkenntnis machte sich in Frank breit, ohne dass er sie richtig fühlen konnte. Sie war wieder da. Die große Leere in ihm. Aber hinter dieser Leere lauerte auch die Angst. Die Angst vor dem Schmerz.
»Ja. Ich werde folgen.«
*
Martin öffnete die Augen. Sein Kopf summte, ihm war schlecht.
»Langsam, mein Freund.«
Eine weibliche Stimme. Martin spürte, dass er nackt auf einem Bett lag. Verwirrt sah er sich um, ohne sich aufzusetzen. Das gelbe Licht einer Propangaslampe erhellte einen Raum, der wie ein altmodisches Schlafzimmer eingerichtet war. Vor den Fenstern waren alle Rollos heruntergelassen. Eine Rothaarige stand links neben ihm. Weit genug weg, dass er sie nicht greifen konnte. Aber nah genug, um ihm einen sicheren Fangschuss in den Schädel setzen zu können. Aus den Händen der Frau starrte ihn mit unheimlicher Ruhe das dunkle Auge einer Pistole an.
»Ich bin nackt«, stellte Martin mit einem fragenden Unterton fest.
»Und ich bin Sandra.«
Martin versuchte ein Lächeln.
»Normalerweise bevorzuge ich, beim ersten Date besser gekleidet zu erscheinen.«
»Wir wollten nur auf Nummer Sicher gehen.«
Martin nickte. Ja, das konnte er nachvollziehen, wenn da draußen wirklich Zombies rumliefen. Mit diesem Gedanken fuhr ihm eisiger Schrecken durch die Glieder.
»Die Kinder?«
»Sind in Sicherheit.«
»Gut.«
»Nichts ist gut, du Junkie.«
»Bitte?«
»Ich habe die Einstiche gesehen.«
Unbewusst griff Martin sich an die Hoden. Die Rothaarige grinste.
»Keine Angst. Ich habe deine Kronjuwelen nur beiseite gelegt, aber nicht geklaut.« Sie entspannte sich sichtlich, und auch Martin wurde ruhiger.
»Machst du uns Ärger?«
»Inwiefern?«
Sandra griff auf den Schminktisch neben sich und warf Martin das Fläschchen mit Heroin zu.
»Hier. Wie lange kommst du damit hin?«
Martin griff vorsichtig nach dem Fläschchen auf seiner Brust.
»Keine Frage nach einer Spritze?«
»Du spritzt selten. Die Einstiche sind zu gut verheilt, als dass du dir regelmäßig eine Nadel neben die Eier setzt. Du sniffst mehr. Ich habe auch deine Nasenschleimhäute gesehen. Also, wie lange und wie sieht es mit Ärger aus?«
»Lange genug, und keinen Ärger.«
Das Auge der Pistolenmündung sank nach unten. Sandra ging zur Tür.
»Zieh dich an. Wir warten unten in der Küche auf dich.«
*
Eine Stunde später saß Martin in der Küche des Bauernhofs. Eine Propangaslampe spendete gelbliches Licht und bei allen Fenstern waren die Fensterläden geschlossen, damit kein Licht nach draußen dringen konnte. Die Kinder waren versorgt und lagen nebenan im Wohnzimmer. Sandra und Pfarrer Stark hatten Martin schon berichtet, wie sie hierher gelangt waren. Jetzt war es an ihm, ihnen seine Geschichte zu erzählen. Er begann mit Karins Tod. Als er über seine schwammigen Erinnerungen nach seiner Festsetzung berichtete, schüttelten Sandra und der Pfarrer ungläubig die Köpfe. Sie schwiegen aber und stellten keine Fragen. Martin erzählten den beiden über sein Treffen mit den Kindern und ihrer Flucht. Als Martin Ritchies Namen und seinen Tod erwähnte, wurde der Pfarrer blass. Sandra zuckte sichtlich zusammen.
»Und jetzt sind wir hier«, beendete er seinen Bericht. Sandra sah ihn misstrauisch an.
»Und was ist mit deinem speziellen Problem?«
Martin schluckte. Sollte er den beiden die Wahrheit sagen? Würde sie ihm glauben? Er atmete tief durch und fasste einen Entschluss.
»Es fing sehr früh an bei mir. Ich war vierzehn. Erst war es nur dieses ständige Rauschen in meinem Kopf. Dagegen halfen ab und zu ein paar Aspirin. Dann kam ich in die Pubertät, und es wurde immer schlimmer.«
Seine Finger wanden sich unruhig umeinander, als wären sie selbstständige Lebewesen.
»Erst waren es nur nichtopioide Schmerzmittel. Dann halfen sie nicht mehr, ich nahm das starke Zeug. Tetrazepham, Novalgin ... aber das half irgendwann auch nicht mehr. Jedenfalls nicht langfristig. Ich bin dann durch Zufall auf einen Kommilitonen gestoßen, der Connections hatte. Ich wollte Gras, doch der Typ meinte, ich solle direkt was Ordentliches nehmen.«
Martin sah auf. Weder in Sandras Gesicht, noch in dem des Pfarrers sah er einen Vorwurf. Ein gutes Gefühl, trotz der Scham über seine Schwäche.
»Tja, und jetzt schnupfe ich an guten Tagen nur ein oder zweimal eine kleine Prise. An schlechten, oder wenn ich unter viele Menschen muss, setze ich mir eine Nadel.«
»Wie lange?«, fragte Sandra.
»Beides inzwischen etwa ein halbes Jahr. Ich habe immer neue Nadeln genommen.«
»Du wirst runterkommen müssen. Die Columbia-Connection dürfte zusammengebrochen sein.«
Eine Feststellung, keine Frage. Martin nickte Sandra zu.
»Ja.«
»Das wird hart.«
Stark stand auf und holte eine Notration.
»Wir werden hier nicht lange bleiben können«, sagte er. »Du wirst das Meiste unterwegs durchzustehen haben.«
»Ich dachte, ihr wolltet euch hier verschanzen und bleiben?«
Sandra schüttelte den Kopf.
»Mit unseren begrenzten Vorräten? Das wird nicht funktionieren. Außerdem erscheint mir dieser Hof als sehr ungünstig zu verteidigen. Sicher, wir haben rundum freie Sicht. Aber was uns nutzt, hilft auch dem Feind.« Sie stand auf und ging an das Fenster. »Aber es gibt da noch eine Sache, die mich stutzig macht.«
Sie holte tief Luft, sammelte sich und wandte sich dann Martin.
»Was ist da draußen genau passiert? Hast du irgendetwas sonderbares bemerkt, als die Zombies euch angegriffen haben?«
Martin ahnte, worauf sie hinauswollte.
»Ich weiß nicht was du meinst?«
»Ich weiß genau, wohin ich geschossen habe, und wohin nicht. Außerdem lässt die Munition, die ich in meiner Waffe habe, keine Schädel platzen, als seien es Melonen in einer Mikrowelle.«
Martin rutschte unruhig auf seinem Stuhl herum.
»Das ist nicht so leicht zu erklären.«
Sandra zuckte mit den Schultern.
»Dann versuche es einfach. Das war nämlich nicht das erste Mal, dass ich den Kopf eines dieser Dinger habe platzen sehen. Wenn du etwas weißt, das uns in dieser Scheiße helfen kann, dann heraus damit.«
Martin holte tief Luft.
»Das Rauschen, von dem ich euch erzählt habe und wegen dem ich ... äh ... abhängig geworden bin ...«
Martin stockte. Wie sollte er das in Worte fassen, was er selber noch nicht so richtig glauben konnte, obwohl er es bewusst ausprobiert und wahrgenommen hatte?
»Die Kinder können es viel besser. Glaube ich jedenfalls.«
»Was?«, fragte Sandra. Martin schluckte trocken.
»Ich kann Gedanken lesen.«
Sandra lachte spöttisch auf. Sie schüttelte den Kopf.
»Schwachsinn. Bist du schon so auf Droge, dass du nicht mehr zwischen Realität und stoned Dreams unterscheiden kannst?«
Bevor Martin etwas sagen konnte, wurde ein warnendes Gefühl in ihm breit. Es war, als würde ihm Karins Stimme warnen und ihn dazu drängen, jetzt auf keinen Fall auf seiner Aussage zu beharren. Sandra wandte sich ab. Sie seufzte tief.
»Ich glaube eher, dass es etwas mit der Seuche zu tun hat. Wenn sie dafür sorgt, dass Tote wieder aufstehen und Menschen fressen, warum soll sie dann nicht auch dafür sorgen, dass den Dingern irgendwann die Schädel platzen? Vielleicht müssen wir nur lange genug überleben und diese Dinger da draußen sterben von alleine aus?«
Stark sah Martin die ganze Zeit tief in die Augen. Er nickte langsam.
»Ich stimme Sandra zu«, sagte er langsam. »Alles andere wäre wider Gottes Natur. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, die Gedanken eines anderen Menschen zu lesen ... oder sogar schlimmeres.«
Martin stemmte sich gegen die Stimme in seinem Kopf.
»Und das Rauschen, dass ich höre? Das Knirschen, wenn die Zombies in der Nähe sind?«
Sandra schüttelte den Kopf. Ihr Blick war hart.
»Ich hatte mal einen Freund, der war HNO-Arzt. Er hatte eine kleine Patientin, die genau das gleiche behauptet hat, wie du. Und weißt du, was sich nach etlichen Untersuchungen herausgestellt hat? Sie hatte einen Geburtsfehler. Irgendetwas in ihrem Innenohr war nicht in Ordnung. Sie hörte ihren eigenen Puls hämmern, das Rauschen ihres Blutes, und sie ist beinahe verrückt geworden. Ihre Eltern waren kurz davor, sie wegen Schizophrenie einweisen zu lassen. Waren deine Eltern nie mit dir bei Spezialisten?«
Martin schluckte. Bilder kamen in ihm hoch, die er gerne dort gelassen hätte, wo sie bis zu diesem Augenblick gewesen waren. In einem dunklen und verlassenen Winkel seiner Erinnerungen.
»Ich bin eine Vollwaise«, sagte er leise. »Meine Eltern starben, als ich Vier war. Ich bin in Pflegefamilien groß geworden.«
»Pflegefamilien?«, fragte Stark nach. »Plural?«
Martin atmete tief durch.
»Ja. Insgesamt bei vieren.«
Sandra kam auf ihn zu. In ihrem Blick vermischten sich Mitleid und Härte, als sie ihm eine Hand auf die Schulter legte.
»Martin, es könnte eine Erklärung für all deine Probleme sein, dass du einfach einen körperlichen Defekt hast. Nichts Schlimmes, aber niemand hat es offenbar je für notwendig erachtet, dich mal ordentlich auf den Kopf stellen zu lassen oder dir diese Möglichkeit als Grund zu nennen. Und wenn du in derartigen Verhältnissen aufgewachsen bist ...«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Ich will deine Sucht ja nicht rechtfertigen, aber verstehen kann ich sie. Zumindest ansatzweise. Aber ich halte sie auch für eine ziemlich feige Reaktion. Du hattest als erwachsener Mensch lange genug die Chance, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Jetzt ist es zu spät, und wir alle hier sind in einer Situation, die keinerlei Fehler oder Schwächen verzeiht. Also reiß dich zusammen.«
»Und wenn ich es nicht schaffe?«
»Dann wirst du zu einem Klotz an unserem Bein.«
Kapitel IX - Der Mann ihrer dunklen Träume
Gabi träumte.
Sie träumte eigentlich immer sehr intensiv, und konnte sich auch immer an ihre Träume erinnern. Aber so intensiv wie dieser, war schon lange keiner mehr gewesen. Gabi wusste, dass sie träumte. Aber sie wusste auch, dass dieser Traum nur die Realität erneut abspielte. Eine vergangene Realität, die sie nicht würde ändern können. Sie konnte ihren Träumen ebensowenig davonlaufen, wie sie in der Lage war die Vergangenheit zu ändern. Und mit dieser Erkenntnis ergab sie sich schließlich ihrem Traum.
*
Gabi lief.
Sie lief um ihr Leben, ihr Atem brannte ihr in der Lunge, und nicht zum ersten Mal wurde sie sich bewusst, dass sie anders war als andere Kinder. Nicht so anders wie Tom, der nur einen gesunden Arm hatte, oder wie Kurt und Karl, wo der Eine nicht sprechen und der andere nicht hören konnte. Und nein, es war auch nicht ihre Fähigkeit die Kraft der anderen bündeln zu können. Eine Kraft die sie, gleich ob behindert oder nicht, sowieso von allen anderen Kindern und Erwachsenen unterschied. Nein, Gabi wusste dass sie vollkommen anders war, als die Anderen, und dieses Anderssein bezog sich nur auf ihren Körper, den sie manchmal regelrecht hasste. Diesen unbeholfenen und plumpen Fleischsack.
Und dazu kam, dass in ihrem Traum der Asphalt unter ihren Füßen zu einem gierigen Monster wurde, das sie festhielt, jeden kraftvollen Schritt in ihrem Traum zu einem hilflosen Tippeln werden ließ, sie scheinbar auf der Stelle festhielt, während SIE hinter ihr her waren.
Gabi lief im Traum vor den Wesen weg, die sie Knirscher getauft hatten, verfluchte schluchzend ihren tumben Körper, der so ungraziös war und ihr jetzt ein Hindernis statt einer Hilfe war.
Eigentlich hatte sie sich nicht so weit von den anderen entfernen wollen, als sie in den Autos nach lebenswichtigen Dingen gesucht hatten. Aber irgendwie hatte sie die anderen verloren. Es war, als wäre eine Stimme in ihr gewesen, die sie leise rief und von den Anderen weggelockt hatte. Vielleicht war es der leise Ruf einer bösen Hexe, wie der aus dem Märchen?
Nein, entschied Gabi, während sie im Traum immer noch versuchte, wegzulaufen und ihre Füße im zähen Schlamm flüssigen Asphalts stecken blieben. Es war keine böse Hexe gewesen, die sie gerufen hatte.
Es war viel schlimmer.
Es war der dunkle Mann gewesen.
Und sie hatte ihn gesehen!
Ihn, seinen Schergen und die Knirscher, die den Befehlen seines Schergen folgten.
Und wer dem dunklen Mann ins Antlitz sah, für den war der Weg ins Verderben festgeschrieben und unabwendbar.
»Aber aber, meine Kleine ...«
Da war sie! Die Stimme des dunklen Mannes, ganz nah an ihrem Ohr. Mit einem kalten Hauch, der nach Tod und Verwesung und noch viel Schlimmerem roch!
»Findest du wirklich, ich sollte ein Pfefferminz zu mir nehmen?«
Mit einem entsetzten Wimmern drehte Gabi den Kopf, wollte nicht sehen, musste aber sehen, wusste, dass ER es sein würde, der neben ihr schwebte und sie spöttisch mit seinem metallischen Haifischgrinsen ansah, wusste, dass sie aus dem Tritt kommen würde, sollte sie sich wirklich umdrehen und konnte dennoch die Realität nicht ändern.
Was geschehen musste, würde geschehen.
Sie versuchte weiter zu fliehen, schlängelte sich unbeholfen durch die verlassenen Autos, wandte dabei ihren Blick der Stimme neben ihrem Ohr zu ... und fiel hin!
Etwas riss an ihrem Bein. Es brannte höllisch an ihrer Wade. Die Stimme war weg, der dunkle Mann nicht zu sehen. Aber die Knirscher ... die konnte sie ganz deutlich hören.
Weinend setzte sie sich auf. Ihre Hose war ein Stück über ihrem Knöchel leicht eingerissen. Ein kleiner Blutfaden lief in ihre Socke. Gabi zitterte am ganzen Körper. Wo waren die Anderen?
Sie stand auf.
Da!
Sie sah Martin, der sich durch die Autos auf sie zuschlängelte. Mit einem erleichterten Laut auf den Lippen wollte sie ihm entgegenstürmen ... und stolperte erneut.
Eine Hand war unter dem Auto hervorgekommen! Und mit der Hand eine Schulter, ein Kopf ... das Ding zog sich an ihrem Bein unter dem Auto hervor. Gabi sah vor Schreck erstarrt auf das Schauspiel. Der Knirscher zog sich vollends unter dem Auto hervor. Sein Mund war gierig geöffnet, in seinen toten Augen brannten heißer Hass und dunkler Hunger. Gabi wollte gerade ihr Bein aus der Umklammerung des Toten ziehen, als sie etwas sah, dass sie vollends lähmte.
Der Knirscher hatte keine Beine mehr! Unterhalb seiner Taille hing ein Fetzen seines Rückgrats auf dem Boden, zerfetzte Darmschlingen folgten dem zerstörten Körper wie grausige Festtagsgirlanden.
Instinktiv riss sie ihr verletztes Bein zurück.
»Zier dich nicht so, meine Kleine.«
Da war er wieder! Der dunkle Mann! Aber wo?
»Ich bin überall, meine Kleine, und du kannst nicht entkommen. Denn weißt du, du bist mongoloid und deshalb plump. Das schreibt man M-O-N-«
Ein heißer Schmerz schoss durch Gabis Bein! Sie sah wie der Knirscher versuchte den Stoff ihrer Jeans zu durchbeißen. Erneut sammelte sie alle Kraft, riss ihr Bein zurück und dem Knirscher die Zähne aus dem Mund. Mit einem Blick, der in seiner Verblüffung in einem Film komisch gewesen wäre, sah der Untote auf seine Dritten Zähne, die an der Naht von Gabis Jeans hängen geblieben waren. Sie schrie vor Entsetzen auf, versuchte aufzustehen und ...
*
... erwachte mit tränennassen Augen.
Der gleichmäßige Atem der Anderen war ein Metronom der Ruhe, das sie allmählich beruhigte.
Keiner hatte etwas bemerkt. Das war gut, aber auch nicht verwunderlich. Gabi konnte, wenn sie es wollte, ihre Gedanken vor den Anderen abschirmen, ihre Geheimnisse für sich behalten.
Und es war ja auch nichts passiert. Der Knirscher hatte sie nicht gebissen. Sie waren in Sicherheit. Aber warum brannte dann ihr Bein so schlimm?
Gabi versuchte sich zu beruhigen, den Schmerz in ihrem Bein zu ignorieren. Um sich abzulenken, und um sofort zu spüren, sollte der dunkle Mann doch hierher kommen, lies sie ihre geistigen Fühler in den Äther greifen.
Sie erspürte Martins Geist.
Martin, der sie von dem Knirscher ohne Beine weggezogen hatte. Martin, der ihr Retter war, ihr Prinz und Ritter ohne Rüstung.
Mit einem Lächeln fiel sie schließlich in einen traumlosen Schlaf.
Und in ihrem Bein breitete sich etwas aus, das mit dem Speichel des Knirschers in ihren Blutkreislauf geraten war.
Sie sah nicht den dunklen Schatten, der sich in dem Zimmer ausbreitete, spürte nicht die Kälte, die sich plötzlich breit machte, hörte nicht das leise Lachen, das durch den Äther der Gedanken wehte, wie ein eisiger Nordwind.
»Meine Kleine. Ich sagte dir doch, dass ich dich kriegen würde. Du wärst eine gute Sergeantin für meinen vermummten General.«
Die Kälte wich aus dem Zimmer, der Schatten verschwand allmählich.
»Noch nicht sofort, meine Kleine. Aber bald. Sehr bald.«