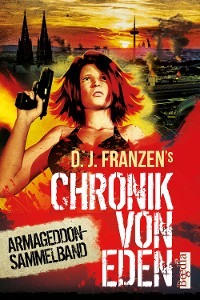Kitabı oku: «Chronik von Eden», sayfa 18
Kapitel V - Unerwartete Bekanntschaften
»Der schwarze Mann!« Zitternd zeigte Rosi in die Richtung, in der sie das dunkle Schemen erblickt hatte.
Doch die anderen hörten nicht auf sie. Sie saßen im Kreis und sangen fröhlich ein Lied.
»Schnell!« In Rosis Stimme schwang Panik mit. »Wir müssen hier weg, solange es noch geht!«
Immer noch keine Reaktion.
Rosi packte Peter an der Schulter und rüttelte daran.
»Hörst du denn nicht? Der schwarze Mann ist da, um uns zu holen!«
Peter drehte den Kopf und grinste sie an. »Ach, hör doch mit dem Unfug auf, Rosi. Damit macht man höchstens kleinen Kindern Angst. Den schwarzen Mann gibt es doch gar nicht.«
»Aber ich habe ihn gesehen. Er stand gleich dort drüben!«
»Und wohin ist er dann so schnell verschwunden?«
»Spürst du denn gar nicht, wie kalt es hier auf einmal ist?«
»Es ist nicht kalt, was redest du da? Setz dich lieber zu uns und sing mit!«
Rosi wollte jedoch nicht. Der schwarze Mann machte ihr zu viel Angst. Und warum konnte Peter die Kälte nicht spüren? Sie zitterte schon am ganzen Leib. Aber auch die anderen schenkten ihr keine Beachtung, sangen einfach weiter, so als wäre nichts.
Übergangslos begann Rosi zu laufen. Nur weg von hier! Weg vom schwarzen Mann!
Ohne sich umzusehen, hastete sie die verlassene Straße entlang. Die Häuser schienen sie aus leeren Fensteröffnungen regelrecht anzustarren. War denn niemand hier, der ihr helfen konnte?
Rosis Beine brannten, ihr Atem ging rasselnd. Lange würde sie ihre Flucht nicht mehr durchhalten können.
Da! Mit einem Mal war der schwarze Mann über ihr, hielt sie fest. Rosi konnte sich nicht mehr bewegen, war ihm hilflos ausgeliefert. Leise begann sie zu weinen.
»Pssssst, nicht weinen.« Die Stimme des schwarzen Mannes klang merkwürdig sanft. »Es wird alles wieder gut. Psssst, alles wird gut.«
Rosi spürte sanfte Berührungen, die so gar nicht zu der herrschenden Kälte passen wollten. Zuerst an den Schultern, dann an Bauch und Beinen. Irgendetwas glitt langsam die Innenseite ihres Schenkels nach oben.
Dann wachte sie auf.
*
»Was tust du da?« Martin sah Stephan fragend an. Dieser hatte sich über Rosi gebeugt und sprach leise zu ihr.
Stephans Kopf ruckte herum. »Mann, hast du mich vielleicht erschreckt! Was machst du hier? Deine Wache ist doch erst in einer Viertelstunde, ich hätte dich schon rechtzeitig geweckt.«
»Du hast meine Frage nicht beantwortet.« Martins Stimme bekam eine gewisse Schärfe. »Ich will wissen, was du da machst.«
»Die Kleine hat offenbar schlecht geträumt.« Stephan zuckte mit den Schultern. »Da habe ich versucht, sie ein wenig zu trösten.«
»Zwischen ihren Beinen?!?«
»Wie? Ach das! Nein, es ist nicht so, wie es aussieht.«
»Aha? Wie ist es dann?«
»Ich … ich bin abgerutscht. So war das.«
»Am besten wecken wir Sandra und fragen sie, was sie von der Sache hält.«
»Das halte ich für keine gute Idee.« In Stephans Augen flackerte es kurz. »Sie braucht ihren Schlaf, denn schließlich hat sie die Verantwortung für die ganze Gruppe. Der Alptraum ist ja jetzt vorbei, nicht war?«
Der letzte Satz war an Rosi gerichtet gewesen. Diese hatte sich ein wenig aufgerichtet und schaute die beiden Männer aus schläfrigen Augen an.
»Ja, danke, es ist alles ok«, versicherte sie schließlich.
»Dann ist es ja gut.« Martins misstrauische Blicke straften seine Worte Lügen. An Stephan gewandt sagte er: »Du kannst dich hinlegen, ich übernehme jetzt.«
Als Stephan an ihm vorbeiging, zischte er ihm zu: »Ich behalte dich im Auge.«
»Mach das, Junkie, mach das …«, kam es ebenso leise zurück, dann war Martin mit den Kindern alleine.
*
Zufrieden rieb sich der Dunkle Mann die Hände. Besser hätte es gar nicht laufen können!
Eigentlich hatte er nur vorgehabt, sich in die Träume eines der Kinder zu schleichen, um sie ein wenig zu bespitzeln. Diese Rosi – was für ein dämlicher Name! - hatte seine Anwesenheit gespürt und mit einem Alptraum darauf reagiert.
Er musste vorsichtig sein. Die Kinder konnten mehr als ihm lieb war. Aber das machte das Spiel auch spannend. Ohne Spannung war es langweilig, und all die Vorbereitungen mussten sich doch schließlich am Ende auch auszahlen, oder etwa nicht?
Das Mädchen hatte also schlecht geträumt. Dann war dieser Neue in der Gruppe darauf aufmerksam geworden und hatte sich um sie gekümmert, wenn auch auf eine eigentümliche Weise. Irgendetwas stimmte nicht mit diesem Kerl, aber das konnte Gabriel nur recht sein.
Der Langhaarige musste etwas bemerkt haben. Auf jeden Fall war es zwischen ihm und dem anderen zu Spannungen gekommen, das hatte Gabriel deutlich spüren können. Unfrieden konnte die Gruppe spalten, das spielte ihm in die Hände.
Aber da war noch Luzifer, sein Gegenspieler. Deutlich spürte er dessen Präsenz, auch wenn er im Moment nicht ausmachen konnte, wo genau sich dieser herumtrieb. Es war jedoch auch nicht wirklich wichtig, denn Luzifer war ein Korinthenkacker, was die Regeln des Spiels anging. Das war er schon immer gewesen, und das würde er immer bleiben. Er stellte keine wirklich Bedrohung dar, eher eine Art Gewürz in der Suppe des Spiels.
Er, Gabriel, würde gewinnen. Wieder einmal. Und das bewies, dass er im Recht war.
Es war an der Zeit, nach seinem General zu sehen. Nicht mehr lange, und der Dunkle Mann würde am Ziel sein.
*
Der Rest der Nacht verlief ohne weitere Zwischenfälle. Sandra hatte Martin aufgetragen, die Gruppe im Morgengrauen zu wecken. Hastig schlangen sie nun ein karges Frühstück hinunter.
»Warum isst du nichts?«, wollte Sandra von Martin wissen, der wieder am Fensterrahmen stand und hinaus starrte.
»Ich habe keinen Hunger.« Der Affe streckte seine Hand nach ihm aus.
»Wenn du mir unterwegs zusammenklappst, lass ich dich einfach liegen. Klar? Wir können keinen Bremsklotz brauchen, wir sind auch so schon langsam genug.«
Martin zog es vor, nicht darauf zu antworten. Stattdessen schaute er weiter aus dem Fenster und versuchte einzuschätzen, wie das Wetter heute werden würde.
Sein Affe packte ihn im Genick und rüttelte ihn ganz sanft durch. Martin fragte sich, ob er ihn vermissen würde, wenn er den Entzug überstanden hatte. Aber er glaubte nicht wirklich daran.
Ein merkwürdiges Geräusch hinter ihm zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Ein Keuchen und Japsen, immer wieder unterbrochen von einer kläglichen Parodie dessen, was ein Husten hätte sein können.
»Hey, Gabi, was ist los?« Toms Stimme klang besorgt.
Melanie hielt den Kopf ihrer Schwester und versuchte, sie in eine Lage zu bringen, in der sie besser Luft bekam.
»Was hat sie?«, fragten Patrick und Sandra unisono, die nun ebenfalls darauf aufmerksam geworden waren. Stephan hielt sich im Hintergrund.
»Asthma«, erklärte Tom. »Gabi hat Asthma.« Und an Melanie gewandt: »Was ist mit dem Spray?«
Melanie schüttelte den Kopf.
»Was will sie uns sagen?« Patricks Miene zeigte deutliche Sorge um das Kind.
»Das Spray ist alle.« Auf Toms Stirn bildeten sich Sorgenfalten, was bei einem dreizehnjährigen Jungen, den man gut und gerne auch für zehn halten konnte, irgendwie unpassend wirkte. »Sie hat gestern Abend die letzte Dosis verbraucht.«
»Woher weißt du das?«, platzte es Stephan heraus. »Die Kleine hat doch gar nichts gesagt. Kannst du etwa ihre Gedanken lesen?«
»Blödsinn!« Martin sah Stephan herausfordernd in die Augen. »Niemand kann die Gedanken eines anderen lesen.«
»Das ist mir auch klar, J… , äh, Martin. Es ist doch nur ein Spruch. Kein Grund, gleich ungeschmeidig zu werden.«
»Sind die Gockel dann mit dem Revierabstecken fertig?« Sandra sah die beiden vorwurfsvoll an.
»Wir brauchen Medizin«, stellte Martin überflüssigerweise fest.
»Hältst du es noch so lange aus?«, wollte Sandra von Gabi wissen.
Diese hatte sich inzwischen wieder ein wenig beruhigt und nickte schwach.
»Dann werden wir mal schauen, was Kerpen in dieser Richtung zu bieten hat. Wir brechen auf.«
*
Normalerweise brauchte man zu Fuß vom südlichen Ende Götzenkirchens bis zur Ortsmitte Kerpen nicht einmal eine Stunde. Durch das Gepäck sowie den angeschlagenen Gesundheitszustand von Gabi benötigte die Gruppe jedoch fast drei, um nur den Ortsrand zu erreichen.
Immer wieder mussten sie anhalten, damit sich das Mädchen ein bisschen erholen konnte. Patrick bot mehr als einmal an, sie zu tragen, aber sie weigerte sich standhaft. Tragen lassen würde sie sich nur von Martin, aber der war dazu im Moment nicht in der Verfassung, denn der kalte Entzug nahm seinen Körper mehr und mehr in Besitz.
»Was denkst du?«, wollte Patrick von Sandra wissen. »Wie viele der bedauernswerten Seelen haben sich hier versammelt?« Dann setzte er leise hinzu: »Möge der Herr ihnen gnädig sein.«
»Egal, wie viele es sind«, knurrte Sandra. »Im Zweifelsfall genügt einer, um uns Ärger zu machen.«
»Vielleicht sollten wir uns aufteilen«, schlug Stephan vor. »Ich bleibe mit den Kindern hier, und ihr seht nach, ob ihr ein paar Medikamente finden könnt.«
Martin wollte schon aufbrausen, als ihm Sandra zuvorkam: »Nichts da, wir bleiben zusammen! Was mich überhaupt darauf bringt: Wie geht es dir denn heute, Stephan? Irgendwelche Merkwürdigkeiten im Befinden?«
»Häh? Was meinst du?«
»Sie will sehen, ob du schon ein Stück weit zu einem der Freaks – wie du sie nennst – geworden bist.« Martin grinste. »Wundert dich das?«
»Bei euch wundert mich so langsam gar nichts mehr«, brummte Stephan, dann ergab er sich in sein Schicksal und ließ sich von Sandra ausgiebig mustern.
»Die Wunden heilen erstaunlich schnell bei dir«, stellte sie schließlich fest. »Aber es scheint alles okay zu ein.«
»Das waren ja auch nur ein paar oberflächliche Kratzer. Außerdem bin ich hart im Nehmen.«
»Gooock-gogooock-gogoooock!«, machte Martin das Gackern eines Huhns nach, was ihm von Stephan einen giftigen und Sandra einen vorwurfsvollen Blick einbrachte.
»Gibt es etwas zwischen euch beiden, von dem ich wissen sollte?«, fragte sie die beiden Männer. »Ich meine, bevor mir einer von euch in falsch verstandenem Geschlechterkampf ein Messer in den Rücken rammt oder so …«
»Nein, es ist alles bestens«, beeilte sich Stephan zu versichern. »Das ist so ein Männerding zwischen uns. Du weißt schon, die Rangordnung ermitteln, wenn ein Neuer ins Rudel kommt und all sowas. Nichts worüber man sich Sorgen machen müsste.«
»Siehst du das genauso?« Die Frage war an Martin gerichtet gewesen.
Einen kurzen Moment überlegte er, ob er Sandra davon erzählen sollte, was heute Nacht beim Wachwechsel vorgefallen war, ließ es dann aber lieber. Sie schien im Moment eh nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen zu sein, und wie es aussah, hielt sie Stephan für eine Bereicherung der Gruppe. Solange er nichts handfestes gegen diesen komischen Typen in der Hand hatte, war es wohl besser, den Ball erst einmal flach zu halten.
»Ja«, sagte er deshalb. »Stephan hat recht. Das ist so ein Männerding. Sobald wir ein paar Flöhe ausgetauscht haben, werden wir uns schon vertragen.«
»Genau das wollte ich hören.« Sandra nickte. »Aber reißt euch bei eurem ›Männerding‹ am Riemen, sonst mache ich euch nachhaltig klar, wer das Alphatier in diesem Rudel ist. Und dem ersten, der meint, sein Revier durch das Anpinkeln von Bäumen abstecken zu müssen, schieße ich die Eier weg.«
Ja, das bringst du fertig, ging es Martin durch den Kopf, dabei rieselte ihm ein wohliger Schauer den Rücken herunter, den er schnell seinen immer stärker werdenden Entzugserscheinungen zuschrieb.
*
»Wenn du den Karabiner fallen lässt, ist er hinterher vermutlich zu nichts mehr zu gebrauchen.« Sandra sah Martin skeptisch an.
Der war stehengeblieben, und sein Körper wurde von Krämpfen geschüttelt.
»Es geht gleich wieder«, presste er hervor. »Nur einen Moment noch. Und auf das Gewehr passe ich auf.«
So vorsichtig, wie es ging, lehnte er die Waffe gegen eine Hauswand, dann stütze er sich mit beiden Händen gegen die Mauer und wartete, bis sein Körper sich wieder einigermaßen beruhigt hatte.
»Bist du dann soweit?«
Martin hätte sich nicht gewundert, wenn Sandra jeden Augenblick damit begonnen hätte, ungeduldig mit dem Fuß zu tappen. Er holte noch einmal tief Luft, dann drückte er sich von der Wand ab, nahm den Karabiner wieder auf und nickte. »Fertig, wir können.«
Sandra hatte recht, sie mussten weiter. Bislang hatte sich zwar kein Zombie blicken lassen, aber das konnte sich jederzeit ändern. Wenn es soweit war, waren die Pilger besser bereits wieder auf dem Weg aus der Ortschaft hinaus.
»Dort vorne!« Jonas zeigte auf eine Stelle, an der eine Seitenstraße einmündete. »Der weiße Hund ist wieder da!«
»Du musst dich irren«, meinte Patrick. »Das ist sicher ein anderes Tier. Ich denke nicht, dass uns der Hund aus Königsdorf hierher gefolgt ist, andernfalls hätte wir das sicherlich bemerkt.«
Martin war sich da nicht so sicher, konnte im Moment aber sowieso kaum einen klaren Gedanken fassen. Diese kreisten nämlich zunehmend nur noch um ein Thema: Stoff!
Der Hund stand ruhig da und schien die Gruppe zu beobachten. Plötzlich versteifte sich seine Haltung. Er knurrte, dann stieß er ein kurzes Bellen aus.
Sandra hob ihre Pistole und legte auf das Tier an. Die entsetzt aufgerissenen Augen der Kinder ignorierte sie dabei geflissentlich.
Doch bevor sie zum Schuss kam, zog sich der Hund zurück. Stattdessen tauchte im Eingang des Hauses, neben dem er eben noch gestanden hatte, ein Zombie auf. Fast im selben Moment krachte ein Schuss.
Da Sandra die Waffe sowieso schon grob in diese Richtung gehalten hatte, hatte es nur einer kleine Bewegung ihres Arms bedurft, um dem Untoten eine Kugel in den Kopf zu jagen.
»Er hat uns gewarnt.« Das war Tom. »Der weiße Hund hat uns wieder gewarnt. Jetzt bin ich mir sicher, dass es derselbe wie in Königsdorf ist.«
»Quatsch!« Sandra wischte mit der freien Hand durch die Luft, so als wolle sie Toms Schlussfolgerung verscheuchen wie ein lästiges Insekt. »Das ist nur Zufall. Hunde bellen eben von Zeit zu Zeit, daran ist nichts besonderes.«
Bevor der Junge widersprechen konnte, tauchten drei weitere Zombies auf.
Stephan fackelte nicht lange. Mit einem »Wir müssen Munition sparen!« rannte er auf die Neuankömmlinge zu und schwang dabei seinen Baseballschläger.
»Was macht der Idiot?«, zischte Sandra. »Er läuft mir genau in die Schusslinie!«
Martin wollte etwas sagen, wurde aber in diesem Moment wieder von einem Krampfanfall durchgeschüttelt.
»Wir müssen ihm helfen, alleine schafft er das nicht.« Patrick hatte den Satz noch nicht richtig zu Ende gesprochen, da setzte er sich ebenfalls in Richtung der Zombies in Bewegung. Dabei entwickelte er ein Tempo, dass man ihm gar nicht zugetraut hätte.
Diesmal war es also an Sandra, den anderen einfach nachzulaufen, wollte sie ihre »strahlenden Recken« nicht einfach hängen lassen.
Mit einem eklig feuchten »Kaflatsch!« landete Stephans Baseballer mitten im Gesicht des vordersten Zombies. Wie bereits im Hinterhof des Restaurants wurde auch dieser von der Wucht des Treffers ein paar Schritte zurückgetrieben.
»Du den linken, ich den rechten!«
Patrick hatte die Untoten ebenfalls erreicht und rammte seiner »Zielperson« den Plastikschild mit voller Wucht gegen die Brust. Der Zombie ließ sich davon aber nur marginal beeindrucken und versuchte sogleich, seinen Angreifer am Schild vorbei zu fassen zu bekommen. Ein wuchtiger Hieb mit dem Streitkolben riss ihm fast den Kopf von den Schultern und beendete sein untotes Dasein.
In diesem Moment war auch Sandra heran. Durch einen gezielten Schuss gab sie dem Zombie, den Stephan zuerst getroffen hatte, den Rest. Dann war auch schon alles vorbei.
Vor ihnen lagen vier Untote, die nun endgültig tot waren. Zwei davon hatten ein Loch zwischen den Augen, und es fehlte ihnen die hintere Hälfte des Kopfes. Einem war der Schädel halb von den Schultern gerissen und hing merkwürdig zur Seite, der andere hatte dort, wo sein Kopf hätte sein sollen, nur noch einen schleimigen Klumpen.
»Ich sag doch: Munition sparen.« Stephan grinste zufrieden. »Hat doch prima geklappt. Und ich habe dabei nicht mal einen Kratzer abbekommen.«
In Sandras Gesicht arbeitet es. Sie reckte ihr Kinn nach vorne, sog hörbar die Luft ein. Dann atmete sie ebenso geräuschvoll wieder aus und steckte ihre Pistole weg.
»Okay, weiter. Diese Penner haben uns schon genug Zeit gekostet.«
*
Kurze Zeit später fanden sie tatsächlich eine Apotheke, deren Eingangstür einen unversehrten Eindruck machte. Dieser Zustand hielt jedoch nicht lange an, als Stephans Baseballschläger dagegen krachte. Er benötigte nur drei Hiebe, dann war eine ausreichend große Öffnung entstanden um hindurchzuschlüpfen.
Stephan betrat als erster den kleinen Verkaufsraum. Aufmerksam sah er sich nach allen Seiten um, dann winkte er den anderen, dass sie ihm folgen konnten.
Zielstrebig ging Sandra auf die Ziehschränke hinter dem Tresen zu. »Die sind alphabetisch sortiert«, erklärte sie. »Gabi, wie heißt das Mittel, das du brauchst?«
Das Kind nannte einen unaussprechlichen Namen, wie ihn sich nur die Marketing-Abteilung eines großen Pharmakonzerns ausdenken konnte. Glücklicherweise waren die ersten beiden Buchstaben klar zu erkennen, so dass Sandra nicht lange suchen musste.
»Ist nur eine Packungen, und die ist schon ein paar Tage über dem Verfallsdatum, aber das ist erst einmal besser als nichts.« Sie drückte Gabi die Schachtel in die Hand.
»Lass uns nachsehen, ob sie auch Antibiotika dahaben«, schlug Patrick vor. »Verbandszeug und ein paar Schmerztabletten wären vermutlich auch nicht schlecht.«
Sandra nickte und begann, die Schränke zu durchforsten. »Los, helft mit! Ihr wisst doch auch, wie das Zeugs aus der Werbung ausschaut.«
Ein paar Minuten später betrachteten sie ihre Ausbeute. Viel war es nicht, die Apotheke schien die benötigten Präparate wohl überwiegend erst bei Bedarf bestellt zu haben.
Früher war das kein Problem gewesen, denn der gut funktionierende Pharmaapparat hatte sichergestellt, dass jede Apotheke mindestens zweimal am Tag beliefert worden war, manche sogar drei- oder viermal. »Just in time« hatte man das genannt, und es hatte geholfen, die Kosten zu drücken und somit den Gewinn zu maximieren.
Nun stellten die wenigen Überlebenden, die noch normal waren, schmerzlich fest, dass man Geld tatsächlich nicht essen konnte.
Immerhin verfügten die Pilger jetzt über mehrere Schachteln Schmerztabletten, einen Verbandskasten und zwei Packungen mit einem Breitbandantibiotikum. Bislang hatten sie nichts in dieser Art benötigt, aber das war wohl mehr Glück als alles andere.
Patrick wurde kurzerhand zum Apotheker der Gruppe erklärt, da er sich mit diesen Dingen offenbar am besten auskannte.
»Wohin jetzt?« fragte er, nachdem er die Sachen in seinem Rucksack verstaut hatte. »Wollen wir noch nach etwas Essbarem schauen?«
Sandra schüttelte den Kopf. »Im Augenblick sind wir notdürftig damit versorgt, viel mehr können wir sowieso nicht ohne weiteres tragen. Daher sollten wir lieber nach einer Unterkunft für die Nacht schauen.«
»Jetzt schon?« Stephan sah sie überrascht an. »Es ist doch noch helllichter Tag!«
»Das mag schon sein, aber schau dir doch mal unsere beiden ›Problemfälle‹ an. Die brauchen jetzt Ruhe. Alleine die Suche nach einer Unterkunft wird sie vollends an den Rand dessen führen, was sie heute noch zu leisten vermögen.«
Stephan nickte mit undurchdringlicher Miene.
»Suchen wir uns wieder etwas am Ortsrand?« Martins Stimme klang brüchig.
»Das wird das beste sein. Vielleicht finden wir ja einen Bauernhof, der ein wenig abseits der anderen Häuser steht, und sich im Zweifelsfall gut verteidigen lässt.«
Nachdem keiner mehr Fragen hatte, machten sich die Pilger wieder auf den Weg.
*
Das Rauschen und Wispern in Martins Kopf nahm zu, er konnte sich nicht dagegen wehren. Seine Gedanken wirbelten wild durcheinander. Mühsam hielt er mit den anderen Schritt und versuchte dabei weiterhin krampfhaft sich zu konzentrieren.
Immer wieder vermeinte er, kleine spitze Laute durch das Rauschen zu vernehmen. Sie erinnerten ihn an die Angstschreie von kleinen Säugetieren. Das war natürlich Blödsinn, denn wenn hier irgendwo Tiere schrien, würden die anderen es auch hören und in irgendeiner Weise darauf reagieren.
Das Rauschen schwoll an, schien sich dabei regelrecht zu fokussieren. Diese Empfindung war neu. Martin versuchte, sie zu verdrängen, doch es war zwecklos. Das Geräusch klang mit einem Mal so, als würde man ein »Pfff!« rückwärts abspielen, dann hörte er eine Stimme in seinem Kopf: Martin, ich bin es, Tom!
Verwirrt hob Martin den Kopf. Der Junge ging ein paar Schritte vor ihm. Dabei machte er nicht den Anschein, mit ihm zu kommunizieren, aber das konnte täuschen.
Martin! Sag, hörst du mich? Komm schon, antworte bitte!
Es kostet ihn einige Mühe, aber schließlich schaffte er es, eine Antwort zu senden: Was ist denn? Ich bin so schwach, so schwach …
Hörst du die anderen?
Martin wurde hellhörig. Welche anderen? Plötzlich war ein Teil seiner Müdigkeit wie weggewischt, und er konnte sich wieder besser konzentrieren.
Die anderen Kinder. Du musst ihre gedanklichen Hilferufe doch ebenfalls empfangen haben!
Diese … diese Geräusche, das Fiepen, das sind andere Kinder? Bist du sicher?
Klar bin ich sicher. Wir müssen ihnen helfen! Melanie sagt, sie müssen irgendwo gleich dort vorne in der Seitenstraße sein!
»Sandra?«
Die junge Frau drehte den Kopf und sah Martin unwillig an. »Was gibt es denn? Müssen wir schon wieder eine Pause machen?«
»Nein, keine Pause. Aber wir sollten dort vorne rechts abbiegen.«
»Warum? Kennst du dich auf einmal hier aus?«
»Nenn es meinetwegen ein Gefühl, aber lass uns dort vorne in die Seitenstraße gehen. Bitte.«
Sandra blieb abrupt stehen. »Kannst oder willst du mir nicht sagen, was dort vorne ist?«
»Ich kann es nicht.«
»Und warum sollte ich deinem Wunsch dann nachkommen, hm?«
»Weil …, weil …, weil es richtig ist. Vertrau mir bitte einfach.«
In Stephans Blick war zu sehen, dass er seine Chance witterte, den »Junkie« endlich loszuwerden: »Wenn er meint, dann lass ihn doch. Vielleicht hat er ja gerade wirklich einen lichten Moment.«
Sandra schien hin- und hergerissen zu sein. Schließlich gab sie sich einen Ruck. »Also gut, wir schauen nach. Aber wenn uns das nur Zeit kostet, trete ich dir in den Arsch, mein Lieber.«
*
Die Seitenstraße lag verlassen da, so wie die anderen Straßen auch, durch die sie gekommen waren. Nicht ein Untoter ließ sich blicken, und auch sonst bewegte sich rein gar nichts.
»Und?« Sandra schaute Martin herausfordernd an. »War’s das? Können wir weiter?«
»Einen Moment noch bitte.«
Tom, wo müssen wir suchen?
Melanie sagt,sie müssen in dem kleinen Haus dort vorne sein. Das mit den hellblauen Wänden.
»Das Haus mit den hellblauen Wänden. Dort müssen wir hin.«
»Willst du mich verarschen?« Sandras Augen schienen förmlich Blitze zu versprühen. »Hier ist nichts, das siehst du doch selbst. Oder vernebelt dir der Turkey schon so die Birne, dass du rosa Elefanten tanzen siehst?«
»Lass uns bitte in dieses Haus gehen. Wenn dort nichts ist, darfst du mit mir alles machen, was du möchtest.«
»Vielleicht will ich ja gar nichts mit dir machen, sondern einfach nur zusehen, dass wir endlich weiterkommen?«
»Diese Diskussion kostet auch nur Zeit«, mischte sich nun Patrick ein. »Wir sind seinem Wunsch schon gefolgt und in diese Seitenstraße eingebogen, also können wir auch noch kurz nachsehen, was es mit diesem Haus auf sich hat. Auf die paar Minuten kommt es nun wirklich nicht mehr an.«
»Also gut«, stimmte Sandra mit säuerlicher Miene zu. »Dieses Haus noch, aber dann gehen wir weiter Richtung Ortsrand.«
Kurz darauf drückte Sandra gegen die Tür des Gebäudes, diese ließ sich aber nicht öffnen.
»Du bist dran«, sagte sie an Stephan gewandt. »Aufmachen!«
Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und trat mit Wucht gegen die Seite der Tür, an der die Angeln waren. Weitere zwei Tritte später rissen diese aus dem Holz, und das Türblatt ließ sich mit ein wenig Mühe vollends zur Seite drücken.
»Bitteschön!« Stephan verbeugte sich galant und wirbelte dabei mit der Hand in der Luft herum.
Sandra schien die Geste jedoch kein bisschen zu beeindrucken. Wortlos ging sie an ihm vorbei und betrat den kleinen Windfang. Dann erstarrte sie plötzlich und hatte im gleichen Moment ihre Pistole in der Hand.
»Ist da jemand?« Ein zaghaftes Stimmchen klang durch die Glastür, die den Windfang nach innen abschloss.
In Sandras Gesicht spiegelte sich Überraschung. Sie überwand diese jedoch schnell und drückte beherzt die Türklinke nach unten.
Vor ihr stand ein Mädchen von vielleicht acht oder neun Jahren. Sie hatte ein zart geschnittenes Gesicht, und ihre langen blonden Haare waren zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst.
Jetzt drehte sie den Kopf zu Seite und rief: »Alles klar, ihr könnt kommen. Es sind keine Knirscher.«