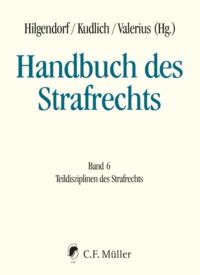Kitabı oku: «Handbuch des Strafrechts», sayfa 31
d) Kritik und Alternativen
65
Die dargestellten Unwägbarkeiten müssten bereits ihrer selbst willen aufgelöst werden – und zwar möglichst legislativ; denn die Rechtsprechung weigert sich bis heute, dies zu tun und beruft sich dabei auf den Willen des Gesetzgebers. Zwar bestimmt die „Dogmatik“ (insbesondere die Anwendung des Allgemeinen Teils wie auch die allgemeine Verbrechenslehre) nicht den Inhalt der Verhaltensnormen, sondern führt diese zunächst nur einer Systematisierung zu. Umgekehrt gewährt sie jedoch auch Garantien (etwa fakultative sowie obligatorische Strafmilderungen), welche in die Sanktionsnorm implementiert werden müssen, wenn der Gesetzgeber davon abgesehen hat, Modifikationen des Allgemeinen Teils als lex specialis innerhalb der dogmatisch unzulänglichen Vorschriften zu konzipieren (wie er dies bei zahlreichen anderen Vorfelddelikten im Besonderen Teil für angemessen erachtete). Ist nämlich eine Anwendung des Allgemeinen Teils, insbesondere eine Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme oder von Vorbereitung, Versuch und Vollendung gänzlich unvorhersehbar, fehlt es letztlich an einer verfassungsmäßigen Sanktionsnorm. Dies gilt zumindest dann, wenn trotz einer faktischen Unanwendbarkeit derjenigen Vorschriften, welche eine angemessene Berücksichtigung unrechtsmindernder Faktoren gewähren, die Sanktionsnorm mit Mindeststrafen von nicht unter zwei oder fünf Jahren aufwartet.
66
Der Verfasser hat sich an anderer Stelle für eine Konkretisierung des Begriffs des Handeltreibens als „Notlösung“ dergestalt ausgesprochen, dass an eine konkrete Tätigkeit – nämlich an die Erklärung, Betäubungsmittel umsetzen zu wollen – geknüpft wird.[156] Dies gilt, soweit man bereits den bloßen Ankauf bzw. Verkauf ohne Verfügungsmacht über Drogen weiterhin kriminalisiert wissen möchte und das kennzeichnende Unrecht der Tatmodalität nicht lediglich in der umsatzbezogenen „Abwicklung“, sondern bereits in der eindeutigen Manifestation des Umsatzwillens sieht. Gesetzgebungstechnisch einfacher umsetzbar und auch das rechtspolitisch bessere Signal vermittelte jedoch die Tathandlung des „Umsetzens“: Wie Roxin bereits anregte,[157] könnte so deutlich an einen Außenwelterfolg des Umsatzes geknüpft und ein Fixpunkt für die Verhaltensnorm geschaffen werden, welcher diese konkretisiert (zugleich selbstverständlich auch einschränkt). In beiden Fällen wären die Probleme der Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme beseitigt und durch die Anknüpfung an ein singuläres Ereignis die Bestimmung des Versuchsbereichs (zumindest unter Rückgriff auf die Teilaktstheorie) wieder möglich.
e) Konkurrenzen
67
Die extensive Auslegung des Handeltreibens wirkt sich auch auf die Konkurrenzlehre aus. Wie bereits angedeutet, gehen einzelne Teilakte wie die Einfuhr, der Erwerb, der Ankauf wie auch Verkauf im weiten Begriff des Handeltreibens auf. Sind mehrere Teilakte festgestellt, müssen diese zu einer Handlung verklammert werden, wenn sie sich auf denselben Güterumsatz beziehen.[158] Insofern können die Grundsätze zur Bewertungseinheit auch auf andere Absatzdelikte Anwendung finden. In der Rechtsprechung hat sich auch diesbezüglich eine kaum überschaubare Einzelfallkasuistik entwickelt, welche die Voraussetzungen der Bildung von Bewertungseinheiten und die Anforderungen an die Urteilsfeststellungen gleichermaßen betrifft.
68
Exemplarisch, keinesfalls abschließend, seien die Grundsätze zur Verklammerung von Taten im Kontext des Depots unterschiedlicher Betäubungsmittel zum Verkauf dargestellt: So können Absprachen über die sukzessive Lieferung deponierter Teilmengen an Betäubungsmitteln die aufeinander folgenden Teilakte zu einer Tat zusammenfassen, wenn die Absprache auf die Lieferung einer bestimmten Gesamtmenge gerichtet war.[159] In diesem Falle stellen sich die einzelnen Lieferakte nämlich nur als Umsetzung der einheitlich vorgenommenen Abmachung dar. Dagegen kann das Anlegen eines Vorrats aus selbstständigen Einkäufen zum Absatz in verschiedenen Verkaufshandlungen nicht die Einzeltaten zu einer Bewertungseinheit verklammern; ebenso wenig genügt das sukzessive Auffüllen eines Betäubungsmittel-Vorrats allein („Silotheorie“) für die Annahme einer Bewertungseinheit.[160] Umgekehrt ist von einer Bewertungseinheit auszugehen, wenn die aus unterschiedlichen Einkäufen stammenden Betäubungsmittel im Rahmen eines Handelsgeschäfts weiterverkauft werden[161] bzw. werden sollen.[162] Vermischt der Täter zwei sukzessive erworbene Rauschgiftmengen zur gemeinsamen Abgabe des Rauschmittels, liegt ungeachtet der verschiedenen Erwerbsakte nur eine einheitliche Tat des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor.[163]
69
Scheidet die Bildung von Bewertungseinheiten aus, betrifft also das prozessuale Tatgeschehen mehrere Rauschgiftgeschäfte und somit auch unterschiedliche Güterumsätze, muss dies nicht zwingend zur Annahme von Tatmehrheit führen. Überschneiden sich schließlich unterschiedliche „Deals“, kann es – gerade wegen der extensiven Auslegung des Handeltreibens – oftmals zu einer Teilidentität der Ausführungshandlungen kommen (etwa in Form der Anfahrt oder des Zahlungsvorgangs), die unter Zugrundelegung der bisherigen Rechtsprechung zu einer Tateinheit gemäß § 52 Abs. 1 StGB führt. In einer neueren Entscheidung hat der Große Senat – wiederum auf eine Anfrage des Dritten Senats hin[164] – auch im Rahmen der konkurrenzrechtlichen Betrachtung an der extensiven Auslegung und damit auch an einer denkbar häufigen Überschneidung der Ausführungsakte festgehalten: Das sowohl dem Transport des Kaufgeldes für den Erwerb einer früheren als auch der Übernahme einer weiteren Betäubungsmittelmenge dienende Aufsuchen des Lieferanten verbindet somit als natürliche Handlung die beiden Umsatzgeschäfte zu einer einheitlichen Tat im materiell-rechtlichen Sinne.[165] Darüber hinaus kommt im Rahmen einer bestehenden Lieferbeziehung eine natürliche Handlungseinheit zwischen zwei Umsatzgeschäften in Betracht, wenn die Bezahlung einer zuvor „auf Kommission“ erhaltenen Betäubungsmittelmenge aus Anlass der Übernahme einer weiteren Betäubungsmittelmenge erfolgt.[166] Die konkurrenzrechtliche Einordnung durch den Großen Senat wurde im Anschluss sowohl im Hinblick auf ihre dogmatische Stringenz[167] als auch wegen ihrer praktischen Konsequenzen kritisiert,[168] insbesondere wurde eine Rückkehr zur fortgesetzten Handlung ins Spiel gebracht.[169] Ohne Zweifel ist – was sich auch in der hohen Entscheidungsdichte im Anschluss an den Großen Senatsbeschluss zeigt – noch Einiges im Fluss, was aber in Anbetracht des Konkretisierungsbedarfs auch nicht erstaunen darf.[170]
2. Transitdelikte (Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr)
70
Eine praktisch bedeutsame Rolle nehmen auch die Transitdelikte der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr ein. Die umfangreiche Rechtsprechung, insbesondere zum Tatbestand der Einfuhr dürfte zunächst erstaunen, da dieser im Regelfall umsatzbezogen erfolgt und damit im weiten Begriff des Handeltreibens aufgehen müsste. Doch hat der Gesetzgeber den Teilakt der Einfuhr in § 30 Abs. 1 Nr. 4 BtMG „herausgestanzt“, indem er die Einfuhr nicht geringer Mengen mit einem besonderen Strafrahmen versah. Dies hat zu einer verhältnismäßig häufigen, „isolierten“ Befassung des BGH mit der Modalität der Einfuhr geführt.
a) Definition und Erscheinungsformen
71
Einführen bedeutet das Verbringen (§ 2 Abs. 2 BtMG) eines Betäubungsmittels aus dem Ausland über die Grenze in das Hoheitsgebiet (§ 3 StGB) der Bundesrepublik Deutschland.[171] Es handelt sich nach ganz h.M. um ein Erfolgsdelikt, sodass die formelle Tatbestandsvollendung eintritt, wenn das Betäubungsmittel die Grenze passiert. Es handelt sich nicht um ein eigenhändiges Delikt; soweit dem Täter der Grenzübertritt nach tatherrschaftlichen Gesichtspunkten zugerechnet werden kann, kommt eine Verwirklichung in Form eines Verbringenlassens (also einer Einfuhr in mittelbarer Täterschaft gemäß § 25 Abs. 1 2. Alt. StGB) in Betracht. Spiegelbildlich hierzu wird unter Ausfuhr das Verbringen eines Betäubungsmittels aus dem Geltungsbereich des BtMG über die Grenze ins Ausland verstanden (ihre Bedeutung ist nicht nur phänomenologisch ungleich geringer: Die Ausfuhr ist in § 30 Abs. 1 Nr. 4 BtMG nicht genannt, und taucht isoliert nur im § 30a Abs. 1 BtMG auf, der freilich an weitere Voraussetzungen knüpft).
b) Deliktsverwirklichungsstufen und Abgrenzung der Beteiligungsformen
72
Da die Einfuhr im Gegensatz zum Handeltreiben als Erfolgsdelikt verstanden wird, hat man auch in der Rechtsprechung weniger Schwierigkeiten, die Abgrenzung der Deliktsverwirklichungsstufen nach vertrauten Kriterien der Tatherrschaft, Zwischenakts- und Sphärentheorie zu bestimmen. Tatsächlich greift der BGH bei allen Formen des Transports auf die Grundformel des unmittelbaren Ansetzens (§ 22 StGB) zurück, um den Bereich strafloser Vorbereitung, strafbaren Versuchs und formeller Tatbestandsvollendung zu bestimmen. Entsprechend hat sich die „Grenze“ bei der Einfuhr auf dem Landweg als Abgrenzungskriterium herausgebildet: ein unmittelbares Ansetzen kann damit noch nicht angenommen werden, wenn die Täter noch mehrere Kilometer fahren müssen, um sich der Grenze anzunähern[172] oder wenn das Fahrzeug wenige Kilometer vor der Grenze noch präpariert werden muss.[173] Umgekehrt lässt sich der Eintritt in das Versuchsstadium bejahen, wenn die letzte Ausfahrt passiert worden ist, so dass man unter normalen Umständen die Grenze überschreiten muss.[174]
73
Bei Transportmitteln, die von anderen gesteuert werden, verschiebt sich der Zeitpunkt des unmittelbaren Ansetzens regelmäßig nach vorne, da der Täter das Geschehen viel früher aus der Hand geben muss (Schiffsfracht, Flug, Versendung per Post). Unter Zugrundelegung der allgemeinen Lehren zum unmittelbaren Ansetzen bei mittelbarer Täterschaft (dies ist möglich, wenn die Transportierenden vorsatzlos agieren[175]) ist der Versuchsbereich dann schon im Regelfall mit der Platzierung der Drogenfracht im entsprechenden Vehikel, spätestens mit dem Besteigen des Gefährts anzunehmen; ggf. kann ein Zwischenstopp im Ausland einem unmittelbaren Ansetzen entgegenstehen. Stark vereinfacht lässt sich die transportart-akzessorische Kasuistik[176] folgendermaßen skizzieren:
| Transportart Stadium | Fußgänger, PKW | Bahn, Flugzeug, Schiff | Post, Frachtgepäck |
|---|---|---|---|
| straflose Vorbereitung | Übernachtung vor der Grenze; Verpacken/Verladen der Drogen; Beantragen von Transitvisum; Ausspähen der Grenze; Montieren der Betäubungsmittel im Wagen | Kauf der Tickets, Aufenthalt am Bahnhof, Flughafen | Verpacken, Verstecken der Betäubungsmittel im Karton, Paket, Gepäck |
| Versuch | erst „kurz“ vor der maßgeblichen Grenze; kein unmittelbares Ansetzen, wenn längere Wegstrecke/mehrere Kilometer zu fahren/zu laufen[177]; dagegen (+), wenn letzte Ausfahrt passiert[178] | Besteigen des abfahrtbereiten Zuges,[179] Passieren der Kontrollen und Einsteigen in das Flugzeug (soweit Inland direkt angesteuert wird[180]) | Einlieferung bzw. Abgabe bei der Post[181] oder DB[182]; bei Fluggepäck mit Check-In (es sei denn Abfahrt/Abflug erst in ein paar Tagen); da Geschehen aus der Hand gegeben |
| Vollendung | mit Überschreiten der maßgeblichen Grenze | mit Überschreiten der maßgeblichen Grenze, auch bei Transitfällen, wenn Handgepäck; bei Reisegepäck maßgeblich, ob Verfügungsgewalt gegeben | mit Überschreiten der maßgeblichen Grenze; bei Transitfällen maßgeblich, ob zwischenzeitlich Täter Verfügungsmacht hatte (in Versendungsfällen wohl nie) |
| Beendigung | wenn das Rauschgift im deutschen Hoheitsgebiet in Sicherheit gebracht ist und damit zur Ruhe kommt;[183] allerdings auch dann, wenn Betäubungsmittel nach Vollendung sichergestellt werden[184] | ||
74
Entsprechend eingängig (weil am Kriterium der Tatherrschaft orientiert) gestaltet sich die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme: Anders als beim Handeltreiben kann die klassische „Eigenhändigkeitsformel“ zur Anwendung gelangen, sodass sich die Abgrenzung – jedenfalls was die Klassifizierung als „Täter“ anbelangt – auf Anhieb einfacher gestaltet. Eine eigenhändige Verwirklichung als Fahrer, Körperschmuggler, Passagier oder Passant führt zur Täterschaft.[185] Fehlt es an einer eigenhändigen Verwirklichung, ist zu überprüfen, ob der Grenzübertritt nach anderen Mechanismen (Mittäterschaft, mittelbare Täterschaft) zurechenbar ist. Maßgeblich ist hierbei ein irgendwie gearteter Einfluss auf den Einfuhrvorgang selbst, mithin muss die Tatherrschaft aus transportbezogenen Kriterien hergeleitet werden. Denkbar ist (siehe oben) die Begehung durch Einsatz eines unvorsätzlich agierenden Dritten (etwa eines Fahrers, der nicht um die Betäubungsmittel im „Gepäck“ weiß).[186]
75
Auf diesen Fokus auf den Einfuhrvorgang selbst, weg von einer allgemein organisationsbezogenen Betrachtungsweise, musste der BGH nach und nach hinwirken. Sie hat auch Auswirkungen auf den Besteller von Drogen, der die Einfuhr nur „kausal bewirkt“, aber im Übrigen meist keinen Einfluss auf die Drogeneinfuhr hat. Vielmehr liegt in diesen Fällen eher eine Anstiftung zur unerlaubten Einfuhr[187] nahe, eine Erscheinungsform, die im Zeitalter des Internets als digitaler Drogenumschlagplatz keine Seltenheit mehr darstellt.[188] Freilich ist in jedem Einzelfall aufs Neue zu überprüfen, ob der Besteller tatsächlich den Tatentschluss des Einführenden hervorgerufen hat oder dieser nicht bereits fest dazu entschlossen war, die Betäubungsmittel in das Hoheitsgebiet einzuführen (omnimodo facturus).[189] Der BGH hat sich wegen der geschilderten Entwicklung inzwischen häufiger mit den Voraussetzungen des § 26 StGB im Kontext der Einfuhr auseinanderzusetzen. So hat er unter Rückgriff auf die allgemeine Dogmatik zum Bestimmen als Anstiftungshandlung festgestellt, dass eine bloße Tatgeneigtheit des Lieferanten (die sich bspw. in einem allgemeinen Angebot manifestiert, Betäubungsmittel ins Ausland zu liefern) noch nicht genügt, um von einem omnimodo facturus auszugehen.[190] Anders verhält es sich wohl dann, wenn eine bestimmte Charge an Betäubungsmitteln ohnehin in ein bestimmtes Land verbracht werden soll, die Art des Rauschgifts und dessen Menge (Marihuana im Kilobereich) bereits festgelegt sind und für jede Einzellieferung nur noch ein konkreter „Abruf“ erforderlich ist.[191]
3. Produktionsdelikte (Anbau und Herstellung)
76
Chronologisch sind dem Handeltreiben und der Einfuhr die Tathandlungen des Anbaus und der Herstellung als „Drogenursprungshandlungen“ vorgelagert. Phänomenologisch betrifft der Anbau nur biogene bzw. natürliche Drogen, während die Herstellung gerade auch die Produktion synthetischer/halbsynthetischer Drogen erfasst. Doch muss auch die Umwandlung einer natürlichen Droge gewisse Herstellungsprozesse durchlaufen, um in den konsumfähigen Zustand gebracht zu werden. Beide Tatmodalitäten gehen im Handeltreiben auf, wenn die Produktion umsatzbezogen erfolgt; bei frühem Zugriff durch die Ermittlungsbehörden stellt sich dann die Frage, ob dem Täter ein Umsatzwille nachgewiesen werden kann. Ist dies zu verneinen, kommt neben dem Grundtatbestand die Verwirklichung von Qualifikationstatbeständen wie § 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG (der jedoch nur die Herstellung in nicht geringen Mengen erfasst[192]) sowie §§ 30 Abs. 1 Nr. 1, 30a Abs. 1 BtMG in Betracht. Nur in diesen Fällen entfalten die Produktionstatbestände des BtMG eine eigenständige Bedeutung.
77
Der Anbau wird als vom menschlichen Willen getragenes Aussäen und Samen und die Aufzucht der Pflanze verstanden, wobei die Reife noch nicht eingetreten sein muss (beachte aber Ausnahmen in Anlage I bzgl. Cannabissamen).[193] Für den Begriff der Herstellung findet sich in § 2 Abs. 1 Nr. 4 BtMG eine Legaldefinition, der wiederum neue Tatmodalitäten – Gewinnen, Anfertigen, Zubereiten, Be- oder Verarbeiten, Reinigen und Umwandeln[194] – aufzählt (aber abschließend ist), die in der Praxis meist keiner genauen Abgrenzung bedürfen, da für die Feststellung eines Herstellungsteilakts bereits eine Tatbestandsverwirklichung genügt. Sowohl für den Anbau als auch für die Herstellung gilt: Ein vom Produzenten verfolgter anderer Zweck (Aufzucht zur Zier/als Zimmerpflanze[195]; Herstellung als chemisches Experiment) ist ebenso unbeachtlich wie die Nichtentstehung eines potenten Wirkstoffs. Auch bei diesen Modalitäten handelt es sich somit um (multiple) Tätigkeitsdelikte, weil sie ganz unterschiedliche Formen der Aufzucht bzw. Produktion in einer Tathandlung zusammenfassen, ohne von einem Außenwelterfolg begrenzt zu werden.[196] Ein Versuchsbereich ist damit kaum konstruierbar, der Bereich strafloser Vorbereitung (in Form der Beschaffung des Anbaumaterials, Laborgeräte, Grundstoffe, Samen/Dünger[197]) klar abgesteckt. Bereits das einmalige Begießen der Pflanze kann als eigenhändige Verwirklichung des Tatbestands zur Täterschaft führen; entsprechend gelten die bei Rn. 64 gemachten Erwägungen zur Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme bei untergeordneten Tätigkeiten.[198] Der Gesetzgeber hat auch die Herstellung von Zubereitungen, die nicht dem Betäubungsmittelgesetz unterfallen (und damit auch nicht unter den Erlaubnisvorbehalt des § 3 BtMG), aber Wirkstoffe enthalten, die grundsätzlich dem Betäubungsmittelgesetz unterfallen würden, eigenständig unter Strafe gestellt, § 29 Abs. 1 Nr. 2 BtMG.
4. Konsumnahe Delikte (Erwerb, Besitz, Abgabe, Verbrauchsüberlassung)
78
Handelt der Täter nicht umsatzbezogen, treten in der Praxis vornehmlich die „konsumnahen“ Delikte in den Vordergrund, bei denen durchweg die Verfügungsmacht über Betäubungsmittel das entscheidende Merkmal im Rahmen der Tatbestandsverwirklichung darstellt. Verboten ist das Innehaben der Verfügungsgewalt (Besitz) ebenso wie deren Übertragung (Erwerb, Abgabe). Da sich das in § 3 BtMG statuierte Verbot insofern an alle Beteiligten an einem potentiellen Verfügungswechsel richtet, handelt es sich um Begegnungsdelikte; das Verbot des Verfügungswechsels ist darauf ausgerichtet, unverantwortlichen bzw. missbräuchlichen Konsum zu unterbinden, der Konsum selbst ist allerdings – anders als in anderen Rechtsordnungen – straflos. Freilich existieren neben den Verfügungswechseldelikten weitere „konsumnahe“ Delikte, etwa in Form der Ermöglichung des Konsums durch Verbrauchsüberlassung bzw. des Verabreichens als Konsum in fremder Tatherrschaft oder des Gewährens einer Konsumgelegenheit. Diese Ausgestaltung führt zur Vorstellung, dass von der Legalität des Konsums nicht viel übrigbleibt. Die Abgrenzung ist jedoch – dies machen zahlreiche Aufhebungsentscheidungen zu Konstellationen, in denen (lediglich) der Konsum von Betäubungsmitteln nachgewiesen ist, deutlich – weniger trivial und von praktisch nicht zu unterschätzender Relevanz (insbesondere genügt der Nachweis dafür, dass jemand Betäubungsmittel konsumiert hat, gerade nicht für den Nachweis eine nach § 3 BtMG erlaubnispflichtige Handlung vorgenommen zu haben).
79
Wie bereits erläutert, ist gemeinsamer Anknüpfungspunkt aller Tatbestände in diesem Zusammenhang der Begriff der Verfügungsgewalt; gemeint ist ein tatsächliches Herrschaftsverhältnis, mithin die tatsächliche Möglichkeit, auf das Betäubungsmittel nach Belieben und ohne entscheidende Einflussnahme anderer Personen einzuwirken.[199] Ausgehend von diesem gemeinsamen Anknüpfungspunkt lassen sich die Verfügungswechseldelikte systematisieren: Derjenige, der diese Verfügungsgewalt innehat, besitzt (a) auch regelmäßig die Drogen. Wird die Verfügungsmacht an einen Dritten (freiwillig und unentgeltlich) übertragen, liegt eine Abgabe vor, im Falle der entgeltlichen (aber nicht eigennützigen) Weitergabe ist eine Veräußerung anzunehmen (b).[200] Kommen die Drogen dem Verfügungsinhaber abhanden oder geraten sie anderweitig unfreiwillig abhanden, kommt ein sonstiges Inverkehrbringen in Betracht (c). Ermöglicht der Täter einem Dritten den Konsum von Betäubungsmitteln, ohne die Verfügungsmacht aufzugeben, kommt eine Überlassung zum unmittelbaren Verbrauch bzw. ein Verabreichen entgegen § 13 Abs. 1 BtMG in Betracht (d); beim Erwerber ist dagegen lediglich zwischen dem einverständlichen Erwerb und dem Sich-Verschaffen in sonstiger Weise zu differenzieren (e). Fehlt es an der Erlangung der Verfügungsmacht, kommt lediglich ein (strafloser) Konsum in Betracht (f). Bei allen Tatmodalitäten, die einen Verfügungswechsel voraussetzen, stellt dieser zugleich den tatbestandlichen Außenwelterfolg dar, der den Fixpunkt für die Abgrenzung der unterschiedlichen Deliktsverwirklichungsstufen bildet.