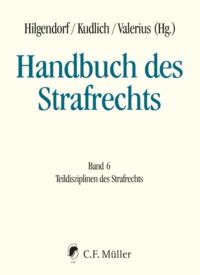Kitabı oku: «Handbuch des Strafrechts», sayfa 8
a) Rationierung und Priorisierung
42
Das Nachfolgende beschränkt sich auf die etwaigen strafrechtlichen Auswirkungen einer Rationierung bei der Gesundheitsversorgung,[260] also auf das bewusste, knappheitsbedingte Vorenthalten einer aus medizinischer Sicht notwendigen Gesundheitsleistung. Somit bleiben – für die strafrechtliche Haftung ohnehin nicht relevante – Fragen der Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven (Rationalisierung[261]) ebenso ausgeklammert wie der in letzter Zeit zunehmend in den Mittelpunkt gesundheitspolitischer Rationierungsdiskussionen gerückte Begriff der Priorisierung, also der ausdrücklichen Feststellung einer Vorrangigkeit bestimmter medizinischer Indikationen, Patientengruppen oder medizinischer Verfahren.[262] Würde allerdings nicht nur eine Rangstufe der Dringlichkeit abzuarbeitender „Fälle“ aufgestellt,[263] so läge bei einem Leistungsausschluss im Ergebnis dann doch Rationierung unter einem „gefälligeren“ Titel vor.[264]
43
Eine Rationierung in der Gesundheitsversorgung erfolgt an verschiedenen, voneinander abhängigen Stellen des Gesundheitssystems, so dass verschiedene Stufen der Makro-, Mezzo[265]– und Mikro-Allokation unterschieden werden.[266] Vorliegend sollen die Eckpunkte beleuchtet werden: Auf der obersten Stufe der Makro-Allokation werden die öffentlichen Ausgaben auf die einzelnen Haushaltsgebiete verteilt; es kommt – vereinfacht betrachtet[267] – somit zur Festlegung des Anteils der Gesundheitsausgaben am Bruttosozialprodukt.[268] Auf der untersten Stufe der Mikro-Allokation werden schließlich die zur Verfügung gestellten Ressourcen auf konkrete Einzelpatienten verteilt (Allokation am Krankenbett): Die konkrete Last der Verteilung nicht ausreichend vorhandener Güter, bedingt durch Vorentscheidungen auf einer höheren Allokationsebene, hat der einzelne Arzt am Krankenbett zu bewältigen.[269]
b) Vorgegebene Knappheit
44
Rationierung bei der Gesundheitsversorgung ist zum einen durch natürliche Knappheit bedingt. Als Beispiel sei die unlösbare Zwangslage infolge der nur begrenzten Anzahl der für Organtransplantationen zur Verfügung stehenden Organe angeführt, die eine Auswahl zwischen mehreren denkbaren Organempfängern erforderlich macht. Die strafrechtliche Lösung derartiger Konstellationen bereitet keine Schwierigkeiten: Ist dem Arzt mangels Spenderorgans eine lebensrettende Operation nicht möglich, entfällt seine Bestrafung aus einem Unterlassungsdelikt in Folge Unmöglichkeit der Erfolgsabwendung. Stehen nun einem Arzt infolge begrenzter Ressourcenzuteilung nur eingeschränkte, den jeweils zu fordernden Standard unterschreitende, Mittel zur Heilbehandlung zur Verfügung (z.B. nur wenige Betten auf der Intensivstation oder eine nicht auf dem neuesten Stand befindliche Diagnosekapazität), so gilt Folgendes: Ist ihm eine (rechtzeitige) Heilbehandlung aus diesem Grunde nicht möglich, so entfällt wegen – infolge von Allokationsentscheidungen auf höherer Ebene – fehlender Behandlungsmöglichkeit seine Strafbarkeit als Unterlassungstäter. Hiervon unberührt bleibt aber im Falle anderweitiger Behandlungsmöglichkeiten eine mögliche Fahrlässigkeitsstrafbarkeit,[270] die an die Behandlungsübernahme unter Außerachtlassung der beschränkten Behandlungskapazitäten anknüpft.
c) Kausalität und Zurechnung
45
Ein Behandlungsfehler durch Vorenthalten medizinisch gebotener Leistungen kann – je nach Erfolgs- und Handlungsunwert – als vorsätzliche oder fahrlässige Tötung bzw. Körperverletzung,[271] verübt jeweils durch Unterlassen, in den Blick des Strafrechts geraten. Allerdings wird eine strafrechtliche Erfolgshaftung in Bezug auf eine nicht verhinderte Krankheitsverschlechterung bzw. eine nicht herbeigeführte Verbesserung des Gesundheitszustandes zumeist daran scheitern, dass ein hinreichender Zurechnungszusammenhang zwischen einer etwaigen ärztlichen Pflichtverletzung durch Nichtgewährung des medizinisch Möglichen und dem hierdurch herbeigeführten Erfolg im Sinne der Tötungs- bzw. Körperverletzungstatbestände jedenfalls dann nicht wird festgestellt werden können, wenn man mit Rechtsprechung und herrschender Lehre einen Kausalitäts- bzw. Zurechnungszusammenhang in der Form verlangt, dass ein pflichtgemäßes Verhalten des Arztes den Verletzungserfolg mit Sicherheit[272] verhindert hätte.[273] Hierzu dann noch unter Rn. 151 ff.
46
Anders stellt sich für den nicht gemäß ärztlichem Standard behandelnden Arzt allerdings seine zivilrechtliche Verantwortlichkeit dar, sofern diese (Nicht-)Behandlung als sog. grober Behandlungsfehler[274] einzustufen ist: Dann trifft – so der Bundesgerichtshof in Zivilsachen in Fortsetzung der Rechtsprechung des Reichsgerichtes – den Arzt die Beweislast für die Nichtursächlichkeit eines von ihm schuldhaft begangenen Fehlers, sofern dieser grobe Behandlungsfehler geeignet ist, einen Schaden der eingetretenen Art herbeizuführen.[275] Derartige – auch in der zivilrechtlichen Literatur nicht unumstrittene[276] – Beweislast-Sonderregelungen verbieten sich für den Bereich des Strafrechts von Vornherein.
47
Ergänzend sei angemerkt, dass der Arzt – sollte der Kausal- und Zurechnungszusammenhang mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden können – sich nicht darauf berufen kann, dass ein infolge seiner Pflichtwidrigkeit nicht eingeschalteter Dritter (also etwa ein medizinischer Spezialist) sich ebenfalls und gleichermaßen pflichtwidrig aus Kostengründen nicht an der gebotenen Behandlung beteiligt hätte. Selbst wenn hierin ein zutreffender Hinweis auf eine entsprechende ärztliche Praxis läge, so kann sich der Arzt, um dessen strafrechtlich relevantes Unterlassen es geht, nicht dadurch entlasten, dass er sich auf eine mögliche zusätzliche Pflichtwidrigkeit eines Dritten beruft: Auch sonst wird bei Feststellung der Kausalität des Unterlassens davon ausgegangen, dass der pflichtwidrig nicht eingeschaltete Dritte seine Pflicht – so er denn eingeschaltet worden wäre – erfüllt hätte.[277] Der Unterlassungstäter hat aber durch seine eigene Pflichtwidrigkeit dem Dritten gerade keine Gelegenheit zur Pflichterfüllung gegeben. Insoweit ist mit Puppe[278] auch auf die Lederspray-Entscheidung des Bundesgerichtshofs hinzuweisen, in der der Senat im Ergebnis zutreffend auf Grund normativer Wertung zu dem Ergebnis gelangte, dass im Falle der Mehrfachkausalität die Täter sich nicht gegenseitig dadurch entlasten konnten, dass sie sich jeweils auf die Pflichtwidrigkeit des anderen Gremienmitgliedes beriefen.[279]
d) Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung
48
Eine Strafbarkeit wegen Verstoßes gegen § 323c StGB soll hier nicht weiter behandelt werden, wird es doch insoweit häufig – jedenfalls auf Basis der Rechtsprechung[280] – selbst bei einer schweren Erkrankung an einem „Unglücksfall“ fehlen, sofern es sich nicht um eine plötzliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Patienten, sondern „nur“ um dessen vom – wie auch immer zu bestimmenden – gesundheitlichen Normalzustand abweichenden, konstanten Krankheitsstatus handelt.[281] Anders wäre hingegen dann zu entscheiden, wenn es sich um eine Krisensituation handelt, bei der infolge eines sich plötzlich verschlimmernden Krankheitsverlaufs oder bei unerträglich werdenden Schmerzen ein sofortiges Eingreifen erforderlich ist.[282] Im Übrigen bleibt zu beachten, dass in diesen Fällen (ärztliche) Hilfe[283] auch dann geleistet werden muss (Schmerzbekämpfung),[284] wenn sie letztlich vergeblich bleibt und sich die zu befürchtende Verschlechterung des Gesundheitszustands des Patienten aus der Rückschau als von Anfang an unabwendbar erweist;[285] der Umstand, dass der Tod des Patienten von vornherein nicht abgewendet werden kann, schließt die Erforderlichkeit ärztlicher Hilfeleistung (Maßnahmen zur Schmerzlinderung) nicht aus.[286] Die Hilfspflicht entfällt allerdings, sobald der Tod des Verunglückten eingetreten ist.[287] Die „bei“ einem Unglücksfall erforderliche Hilfeleistungspflicht kann auch für einen ortsabwesenden,[288] um telemedizinische Hilfe gebetenen Arzt bestehen.[289]
e) Behandlungsschranken und Relativität des Standards
49
Der vom (Straf-)Recht rezipierte medizinische Standard[290] verschließt sich vom Ansatz her keineswegs differenzierenden Überlegungen, bestimmt er sich doch unterschiedlich je danach, welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Ressourcen (personeller wie auch apparativer Art) im jeweiligen Verkehrskreis des Arztes vorauszusetzen sind (siehe Rn. 38).[291] So ist an die apparative Ausstattung eines Universitätskrankenhauses ein höherer Maßstab anzulegen als an diejenige eines Kreiskrankenhauses, ein Allgemeinmediziner muss auch von Rechts wegen nicht über die Fachkenntnisse verfügen, die an einen Spezialisten, etwa in einer Universitätsklinik, zu stellen sind.[292] Die Anforderungen an sorgfaltsgemäßes ärztliches Verhalten unterscheiden sich mithin je nach Fachausbildung des Arztes sowie den dem Arzt zur Verfügung stehenden persönlichen und sachlichen Mitteln.[293] Der haftungsrechtlich zu fordernde Standard ignoriert ökonomische Zwänge nicht.[294] Generelle, d.h. durch Entscheidungen auf der Ebene der Makro-Allokation bewirkte, Defizite im Gesundheitssystem dürfen nicht auf den behandelnden Arzt abgewälzt werden:[295] So kann keineswegs überall und zu jeder Zeit eine optimale Versorgung, die modernste Technik oder die beste Ausstattung verlangt werden;[296] für eine Übergangszeit kann aus Kostengründen auf die Anschaffung technischer Neuerungen verzichtet und nach der altbewährten, noch nicht verbesserten Methode vorgegangen werden.[297] Entsprechende Qualitätsunterschiede sind unschädlich, solange ein zwar nicht optimaler, aber noch ausreichender medizinischer Standard erreicht wird:[298] Eine medizinisch mögliche, aber unbezahlbare Maximaldiagnostik und -therapie bestimmt nicht den an ärztliches Verhalten anzulegenden Sorgfaltsmaßstab. Bereits das zivilrechtliche Haftungsrecht hat sich bei der Bestimmung des ärztlichen Sorgfaltsmaßstabes wirtschaftlichen Gesichtspunkten keineswegs verschlossen. Dies sei durch einen Blick auf einige wenige Beispiele belegt: Die personelle Ausstattung eines Entbindungsteams in einem Kreiskrankenhaus muss nicht die Qualität aufweisen, die für schwere Fälle bei einem Perinatalzentrum erwartet werden darf.[299] Das Fehlen neuester apparativer Ausstattung in einem Krankenhaus für Allgemeinversorgung begründet – ebenfalls nach Auffassung des Bundesgerichtshofs – keine Haftung, da eine dem jeweiligen Stand der Medizin entsprechende Therapie nicht zur Voraussetzung habe, dass jeweils das neueste Therapiekonzept verfolgt werden und eine auf den neuesten Stand gebrachte apparative Ausstattung eingesetzt werden müsste; schon aus Kostengründen könne nicht jede technische Neuerung, die den Behandlungsstandard verbessern könne, sofort von allen Kliniken angeschafft werden, so dass es für eine gewisse Übergangszeit gestattet sein müsse, nach älteren, bis dahin bewährten Methoden zu behandeln.[300] Ein letztes Beispiel: Im Hinblick auf die Bevorratung von Medikamenten hat der Bundesgerichtshof[301] durchaus Aspekte der Unwirtschaftlichkeit einer Vorratshaltung vom Ansatz her akzeptiert. Das auf Schadensersatz wegen der Herbeiführung einer Hepatitis-Infektion in Anspruch genommene Krankenhaus konnte sich hinsichtlich der Nichtanwendung eines nicht bevorrateten teureren Medikamentes aber hierauf nicht berufen, da das Medikament noch rechtzeitig hätte beschafft werden können. Somit kann mit Wagner festgehalten werden, dass wirtschaftliche Erwägungen in den (zivil-)rechtlichen Sorgfaltsstandard von vornherein eingebaut sind und nicht erst von außen an ihn herangetragen werden müssen.[302]
50
Es sind demnach gewisse Behandlungsunterschiede auch vom (Straf-)Recht zu tolerieren, solange ein zwar nicht optimaler, aber eben noch ausreichender[303] medizinischer Standard erreicht wird. Bei der Feststellung sorgfaltsgemäßen Verhaltens besteht auch insoweit ein „Behandlungskorridor“, innerhalb dessen der Arzt sich straffrei bewegen kann. Die Frage nach diesem noch ausreichenden medizinischen Standard im ökonomisch-juristischen Spannungsfeld dürfte die Rechtsprechung zukünftig verstärkt beschäftigen. Die gegenwärtige Rechtslage bietet dem Arzt jedenfalls relativ wenig Handlungssicherheit.
51
Auch bei einer durch Allokationsentscheidungen auf höherer Ebene bewirkten Herabsetzung des ärztlichen Standards sind zum Schutze des Patienten unverzichtbare Standarduntergrenzen einzuhalten, deren Bestimmung allerdings schwierig genug sein dürfte.[304] Auch im Bereich der zivilrechtlichen Produkthaftung – um diese Konstellation als Vergleich heranzuziehen – wird ja i.Ü. zurecht eine gewisse Basissicherheit eingefordert.[305] Da im Bereich der Heilbehandlung Standardunterschreitungen für den Patienten regelmäßig weder erkennbar noch kompensierbar sind, kann man hierauf auch im Bereich der strafrechtlichen Arzthaftung nicht verzichten.
52
Anders sollte hingegen die Frage beurteilt werden, welche entfernten Restrisiken ein Arzt bei seiner Behandlung zulässiger Weise in Kauf nehmen darf: Bei einer Entscheidung bspw. über die Durchführung weiterer diagnostischer Maßnahmen zur Abklärung eines entfernten Risikos kann der wirtschaftliche Aufwand, z.B. für Anomaliefeststellungen, mitberücksichtigt werden.[306] Dass die Zuschreibung einer Sorgfaltspflichtverletzung auch die Kosten gefahrabwendender Sorgfaltsmaßnahmen gegengewichtend einbezieht, ist jedenfalls dem zivilrechtlichen Deliktsrecht bei seiner Bestimmung des Umfangs der Verkehrspflichten nicht fremd.[307] Dies sollte auch für die zukünftige arztstrafrechtliche Betrachtung maßgebend sein.
53
Insoweit sei abschließend bemerkt, dass eine Begrenzung finanzieller Ressourcen auf Dauer auch den sog. Facharztstandard (Rn. 12 ff.) beeinflussen dürfte, da für seine Herausbildung ja nicht nur der medizinischen Wissenschaft, sondern auch der Anerkennung einer bestimmten Verfahrensweise in der Praxis maßstabsbildende Kraft zukommt.[308]
f) Gleichklang von Sozialversicherungsrecht und Strafrecht
54
Als Ausgangspunkt ist festzuhalten, dass jedenfalls gegenwärtig kein Spannungsverhältnis zwischen den gesetzlichen Vorgaben des Sozialrechts (SGB V), dem medizinischen (Mindest-)Standard sowie dem an diesen Mindeststandard anknüpfenden (strafrechtlichen) Haftungsrecht besteht, da sich der Versorgungsauftrag der gesetzlichen Krankenversicherung ungeachtet der erforderlichen Kostendämpfungsmaßnahmen dem medizinisch Notwendigen und Ausreichenden nach wie vor verpflichtet sieht,[309] vgl. § 12 SGB V: Nach dem dort statuierten Wirtschaftlichkeitsgebot müssen ärztliche Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Für die Krankenbehandlung bestimmt § 27 SGB V, dass Versicherte einen Anspruch auf Krankenbehandlung haben, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern.
55
Durch die sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben für eine wirtschaftliche Krankenbehandlung werden strafrechtsrelevante ärztliche Sorgfaltspflichten nicht verschoben.[310] Da der Kassenarzt gemäß § 76 Abs. 4 SGB V bei seiner Krankenbehandlung zur Einhaltung der Sorgfalt nach den Vorschriften des bürgerlichen Vertragsrechts verpflichtet ist, zusätzlich auch gemäß § 2 Abs. 1 S. 3 SGB V die Qualität kassenärztlicher Leistungen dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Kenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen hat, und nicht zuletzt gemäß § 70 Abs. 1 S. 1 SGB V die Leistungserbringer (Ärzte) eine dem allgemeinen Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten haben, besteht gar kein – ggf. zu Lasten des Arztes zu lösendes – Spannungsverhältnis zwischen dem Sozial- und dem Haftungsrecht:[311] Der aus dem medizinischen Standard abgeleitete Sorgfaltsmaßstab der Fahrlässigkeit bildet die Grenze des Wirtschaftlichkeitsgebotes, nicht umgekehrt.[312] Da der an die medizinische Wissenschaft und Praxis anknüpfende, aber eben juristisch zu fixierende Sorgfaltsmaßstab dem Rechtsgüterschutz des Patienten verpflichtet ist, verbietet sich ein Unterschreiten des jeweils anzuwendenden („Behandlungskorridor“) medizinischen Behandlungsstandards aus Kostengründen.[313] Ob der Rechtsanwender zukünftig dem ärztlichen Standard die Gefolgschaft zu versagen hätte, sofern Behandlungseinschränkungen aus Kostengründen in die ärztliche Selbstdefinition dieses Standards Eingang fänden (etwa in Form sog. kostensensibler Leitlinien[314]), erscheint nur für den Fall vorgezeichnet,[315] dass bestimmte Behandlungen ausschließlich aus wirtschaftlichen Gründen – ggf. noch unter Heranziehung verfassungsrechtlich höchst zweifelhafter Kriterien wie etwa dem des Lebensalters[316] – abgelehnt werden sollten. Da aber die Ärzte „der Gesundheit des einzelnen Menschen und der Bevölkerung (dienen)“ – so der in die, die Ausübung des Arztberufs regelnden, Berufsordnungen der Länder übernommene § 1 Abs. 1 der ärztlichen Muster-Berufsordnung 2006[317] – wird weiter zu ergründen sein, ob – ähnlich der nur eingeschränkt überprüfbaren ärztlichen Indikation – entsprechende, von der medizinischen Profession entwickelte Vorgaben einer Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange jedenfalls dann vom Recht zu akzeptieren sind, wenn sie die Behandlungsentscheidung letztlich einer primär am Wohle des Patienten ausgerichteten ärztlichen Gesamtabwägung überlassen.[318]
g) Fehlende Finanzierung bei SGB-Ausschluss einer Maßnahme
56
Werden hingegen bestimmte Behandlungsformen von der sozialversicherungsrechtlichen Erstattung ausgenommen, so wird dies für den Haftungsmaßstab bedeutsam. Da nämlich gemäß § 92 Abs. 1 SGB V entsprechende Richtlinien[319] bzw. ein fehlendes Positiv-Attest gemäß § 135 Abs. 1 S. 1 SGB V[320] des Gemeinsamen Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen den sozialgesetzlichen Leistungskatalog verbindlich konkretisieren und damit das der Behandlung zugrunde liegende vertragliche[321] Arzt-Patienten-Verhältnis gestalten,[322] besteht keine entsprechende Behandlungspflicht des Arztes.[323] Zwar werden weder der zivil- noch der strafrechtliche Haftungsstandard durch den sozialversicherungsrechtlichen Leistungskatalog abgesenkt.[324] Dies verbietet der hohe Rang der beim Patienten auf dem Spiel stehenden Rechtsgüter (Leben, Körper und Gesundheit).[325] Da es nicht Aufgabe des Arztes sein kann, die finanziellen Ungleichheiten einer (insoweit!) Zwei-Klassen-Medizin auszugleichen, kann vom behandelnden Arzt eine unentgeltliche Durchführung von Behandlungsmaßnahmen, die rechtswirksam aus dem sozialgesetzlichen Leistungskatalog ausgegrenzt worden sind, nicht verlangt werden kann.[326] Die Fahrlässigkeitsverantwortung des Strafrechts kann schwerlich eine Privatperson zur kostenfreien Vornahme einer „Sozialleistung“ verpflichten, welche die Gesellschaft als solche sich nicht (mehr) leisten will.[327] Dies gilt wohl auch für Behandlungsmaßnahmen außerhalb des medizinischen Standards bei austherapierten Schwer-Erkrankten, da § 2 Abs. 1a SGB V[328] für derartige Fälle lediglich einen gegen die GKV gerichteten Anspruch des Patienten auf Kostenübernahme, aber keine kassenärztliche Verpflichtung zur Anwendung einer (jedenfalls noch[329]) nicht dem medizinischen Standard entsprechenden Behandlung statuiert.[330] Somit verbleibt nur[331] der nachfolgend skizzierte Ausweg, der im Anschluss an Dannecker/Streng[332] sowie Bohmeier/Schmitz-Luhn/Streng[333] zwischen einer Behandlungsverweigerung und einer standardunterschreitenden Behandlung differenziert.[334]