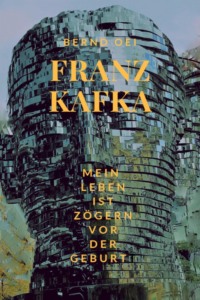Kitabı oku: «Franz Kafka», sayfa 5
Max liest in Franz das Begehren, aufzustehen und mit der Frau am Nachbartisch ein Gespräch zu beginnen. Aber er sieht es ihm auch an, er wird wieder alleine Spazieren gehen, bevorzugt im Regen, aus Angst, jemanden zu begegnen. „Ich werde mich an mein fortwährendes Versagen gewöhnen müssen.“
Ein Mann ohne Weib ist ja gar kein Mensch, so steht es im Talmud. Wie soll er die Zukunft mit seinen viel zu ungelenken Armen empfangen? Vergangenheit heißt, es in der seelischen Rumpelkammer zu ertragen. Er muss einen Grund finden, weshalb er überleben darf, fern der Gräber Verduns.
1 II. 5. Träume
Sprache kleidet Gedanken, die Träume für uns denken. Kafka träumt viel und präziser als man es gewöhnlich niederzuschreiben vermag, so dass er selbst geneigt ist, sie für halbe Fiktionen zu halten, wenn er von Trancebewusstsein nach dem Erwachen spricht. Seine Aufzeichnungen bestehen aus stetem Wechsel nacherzählter Träume und Prosa an, so dass Ebenen ineinanderfließen. Wenn er einen Theaterbesuch wie „Auf der Galerie“ beschreibt, liest er sich dies wie eine Fortsetzung seines Traums von einer Reiterin. Bühne, Dekoration, Gesten und Kleidung der Schauspieler werden mit solcher Präzision geschildert, wie sie kaum einem erinnerten Traum entsprechen. Andererseits bleibt die Handlung seiner Erzählungen oft vage, schemenhaft, diese Transparenz akzentuiert dunklen Reichtum seiner Fantasie. „Es hatte dies keinen Zweck, als womöglich die ganze Dekoration zu zeigen, da sie nun schon einmal in solcher Vollkommenheit da war ...“60
In seinem Traum, der so typischer für ihn ist, da er die Bühne und bekannte Gestalten aus dem Alltag mit aufnimmt, kommt es zu gleichfalls charakteristischen Verfolgungs- und Gewaltszenen, wie sie in Kafkas Träumen als auch Prosa üblich sind. Interessant sind Bemerkungen wie „Unter ihnen war ein bekanntes Mädchen, ich weiß aber nicht welches“, weil sie ihre eigene Logik entfalten. Theater-Träume sind häufig, wiederholen sich. Im Zirkustraum vermengen sich Publikum und Schau-spieler, während Kafka diese Existenzen ausdrücklich für unvereinbar erklärt. Auffallend ist auch die Integration von Pferden, Nacktheit und Jagdelementen in beiden Träumen. Obligatorisch sind die exakten Beschreibungen von Objekten und die Adynata – der gewollten Unmöglichkeit einer Aussage: „ein Herr … geht ruhig wieder zu seinem Platz, in dem er versinkt. Ich verwechsle mich mit ihm und neige das Gesicht ins Schwarze.“
Kafka träumt nicht nur, er deutet seine Träume auch und führt sie auf etwas Reales zurück, wie im Fall der Verwechslung mit seiner Opernbesuch „Sulamith“ von Goldfaden, in der eine Stelle lautet: „Awigail versinkt dort unten im Weingarten Jerusalems“. In seinen Selbstanalysen, die Träumen stets folgen, spricht Kafka davon, dass sein Nachahmungstrieb nichts Schauspielerisches habe und an anderer Stelle, dass er doch gerne Schauspieler wäre, damit er nicht schreiben müsste. In diese scheinbare Anatomie passt seine Behauptung, einen Widerwillen gegen Antithesen zu haben; gleichzeitig räumt er aber auch ein, nur so zu Entschlüssen kommen zu können. „Ich und Max müssen doch grundverschieden sein.“
Da er als Haupthindernis seines Fortschreitens den körperlichen Zustand betrachtet, integriert Kafka auch viele Krankheiten in seine Träume, u.a. abgestorbene Glieder oder die exakte Beobachtung einer Exekution. Als Vegetarier gesteht er Heiß-hunger auf Fleisch ein und träumt bisweilen Berge von Fleisch zu vertilgen, auch kannibalische Träume sind darunter. Im Kannibalismus wirkt die Angst vor der Kastration und dem Verschlingen werden von dem anderen Geschlecht nach. Es ist zugleich eine Abwehrreaktion vor zu viel Nähe und Angst vom anderen kolonialisiert zu werden. Vor allem aber ist es eine Grenzüberschreitung, der einen Strafkodex nach sich zieht.
Zwischen 1912 und 1913, als er seinem Vater in der Fabrik assistieren muss, hat Kafka auffällig viele Träume von maschinellen Anlagen. Die getaktete Zeit wird zur Manie, „Der Heizer“ entsteht. Kafkas Faszination an determinierten Abläufen und Apparatur fließen „In der Strafkolonie“ ein. Erotische Träume verraten seine Bindungsangst, dass die Frau als „Überfall“ empfindet. Beispiel dafür liefert eine dem Traum nachempfundene Erzählung des Herrn Liman Februar 1913.
Ein Geschäftsreisender findet sein angestammtes Hotel ausgebrannt vor und will mit der Kutsche weiterfahren. Dies weiß der Hotelier zu verhindern, indem er unter anderem nach Fini ruft und Liman so lange mit absurden Vor-schlägen festzuhalten versteht, bis das Mädchen heraus-kommt. Felice und Fini mit beginnen mit dem gleichen Buchstaben. Fini erobert sich den Platz an der Seite Herrn Limans in der Kutsche trotz dessen Protestes. Die typisch erotische Anspielung lautet: „und ordnete zuerst flüchtig ihre Bluse und dann gründliche ihre Frisur. “61
Direkt vor der dem Traum folgenden Erzählung trägt Kafka eine Begegnung mit Felice Bauer ein und hält darin Kleidung und Frisur akribisch fest. Nicht unwesentlich ist sein Kommentar, Verlobungen und Heirat kämen Geschäftsabmachungen gleich, die seiner Lebensweise zuwiderlaufen. „Ich bin an F. verloren“. Kafka kehrt von ihr aus Berlin nach Prag zurück.
Während seiner Arbeit am „Prozeß“ träumt Kafka wieder-holt von seiner eigenen Beerdigung. 1920 erscheint das im Roman unberücksichtigt gebliebene Kapitel „Der Traum“ in „Ein Landarzt“ (Prager Tagblatt). Josef K. trifft auf seinen unvollendeten Grabstein und stört den Künstler bei der Ausführung der Namensgravur. Kurz zuvor hat er Kleists Anekdote „Der Griffel Gottes“ gelesen, in der ein Blitz die Grabinschrift verstümmelt. Auch dieser Traum endet mit einer Selbstauslöschung, dem Fall ins Grab und der Vollendung der Gravur endet, mit den Worten: „Entzückt von diesem Anblick erwachte er.“
1 II. 6. Verwandlung in Zeit-und Raum
Metabole bezeichnet den in der äußeren Gestalt sichtbar gemachten inneren Wandel. Für kaum einen Schriftsteller hat das Wort der Metapher Verwandlung so eine tragende Bedeutung wie für Kafka. Zunächst die charakterliche Ebene: obschon er voller Zwänge und Gewohnheiten steckt, behauptet ironisierend: „Ich besitze eine starke Verwandlungsfähigkeit, die niemand bemerkt hat.“62 Kafka glaubt, sich beim Schlafen verstellen zu können, so dass für einen Beobachter ein falscher Eindruck von Seelenruhe entstehen könnte. Er spricht von einem fischartigen Gefühl und dass er sich vom echten Schlaf zurückgewiesen fühle. Seine Insomnie führt er auf nächtliches Schreiben zurück. Schlaf und Traum werden dadurch verändert. Umgekehrt gilt auch: ohne seine Träume schriebe er anders.
Einzig Dichten verändert die Welt. Das Gewöhnliche, dem er sich zugleich verpflichtet fühlt, ekelt ihn, ebenso wie alle äußeren Pflichten, die er mit Widerwillen erfüllt. Doch er braucht diesen Zwang als Widerstand, um sich durch das Schreiben in einen anderen verwandeln zu können: „Nachwehen von Bewegung, Traurigkeit, die grundlos aufsteigt und den Körper schwer macht, seines Lichtes beraubt. Wut, von der nur ein scharfer Dampf im Kopf zurückbleibt.“
Schreiben und Träumen interagieren; es besteht eine Verbindung zwischen seiner verhassten Alltagswelt, den psychosomatischen Leiden, dem Zwang zur Selbstanalyse und Beobachtung seiner Umgebung. Eigen- und Fremdbild wandeln sich permanent. Metaphern bilden sein Unbewusstes ab. An- und Entspannung vermag bereits ein Geräusch auszulösen. Er weiß früh um seine Krankheit und den physischen Verfallsprozess, den er akribisch notiert, etwa, wenn er über seine Migräne herausfindet, wie sie von der einen Schädelhälfte in die andere wandert gleiche einem Mantel, der abwechselnd die Schläfe wärmt.
Besuche im Café Savoy oder im Theater beeinflussen Kafkas Träume und diese seine Metaphern. „Auf der Galerie“ ist ein dokumentiertes Beispiel für die Selbstreflexion der Künstlerexistenz in Abhängigkeit eines Traumes. Im ersten Bild ist die Kunstreiterin kränklich, im zweiten vital gezeichnet. Die Transformation einer Person in verschiedene Persönlichkeiten bildet ein Muster Kafkas, u. a. auch in „Die Verwandlung“.
Prag ist bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges ein besonderer Schmelztiegel einzigartiger künstlerischer Experimente und Illusionismus. Wie blühend die künstlerische und märchenreiche Vielfalt war, bekunden Kafkas Reisetagebücher. Er findet Paris fade, langweilig und einfallslos deklarieren. Die Stadt inspiriert ihn nicht, sie wird eine Enttäuschung der „Bilderlosigkeit“. Er verbringt die Nächte lieber im Hotel mit Träumen.
Die Bilder wandeln sich permanent: so wandert Kafka in „Beschreibung eines Kampfes“ topografisch durch das nächtliche Prag und beobachtet die Schlafenden, fürchtet, ihren Schlaf zu stören und wendet sich wie ein Einbrecher auf Fußspitzen gehend, dem Ausgang zu. Er trifft auf ein Bett, in dem das Laken (er beschreibt es exakt) nicht richtig zugeschlagen ist. Er will es ordnen, da wendet sich die Schlafende ihm zu. Es ist eine Prostituierte, aber der Träumende will nur ihr Knie streicheln und wundert sich, dass man für das Schönste nicht bezahlen muss. Unmittelbar vorher hat er Flauberts Bordellszene aus „Die Erziehung des Herzens“ gelesen – sie handelt von einem nicht vollzogenen Bordellbesuch eines Sechzehnjährigen.
Die Formulierung „daß mein Durchgehen förmlich gar nichts gelte“63, mit dem der Träumende von dem physischen Durchschreiten des Schlafsaales das Bild in die Seelenlandschaft, die Begegnung mit der Prostituierten beschreibt, verdeutlicht den szenischen Aufbau seiner Ebenen, die den Wandel schichten.
Kafkas Meinung nach sollte eine gute Erzählung den Leser in eine Geschichte hinein,- aber nicht aus ihr herausführen. „Von jeder Geschichte ergeben sich Zusammenhänge … er überblickt sie alle… muß aber aus Rücksicht… verschweigen. Alles Erklären tötet die Neugier.“ Eine gelungene Erzählung gleicht einem Labyrinth. Kafka hat ein Synonym für sich gefunden.
Manche seiner Beobachtungen wandeln sich in der Syntax und stehlen sich so in die Romane ein. Der Notiz eines Gesprächs mit einem geschwätzigen Anwalt aus der Versicherung: „Ich wundere mich über die Schlechtigkeit des Gerichts“ folgt die Explikation, warum das so sein muss: „das Gericht ist über-lastet“. Logik und Irrationalität erfahren eine Engführung, eine Überschneidung von Stimmen und Parallelwelten, der äußeren und der inneren.
Die Schlussfolgerung jedoch ist absurd: Akten verschwinden, Zeugen werden nicht gehört, mitunter werden Anklage-punkte erfunden. „Der Prozess“ ist keinesfalls ein Gerichtsroman, sondern er wandelt reale Bilder in surreale Traumlandschaften und damit metaphysische Botschaften über die Beschaffenheit von Zeit und Raum. Die Transformation verzichtet auf Erklärung, Szenen und Bilder werden wie im Theater von Akt zu Akt gestaltet. Das hinterlässt Ratlosigkeit. Kafka will die Erwartung des Lesers brechen und ihn zum Zeugen an Unerklärlichem zu machen. Der Wandel betrifft auch das Recht selbst, einschließlich das Recht auf es Wandel. Gesetze werden zum Inbegriff prozessualer Veränderungen. Die Zuordnung Zuschauer- Akteur ist im Fluss wie die zwischen Richter und Täter, Anwalt und Verteidiger.
Es existieren zwei Formen von Unruhe; die eine beflügelt (Angst), die andere lähmt (Furcht). Kafkas Lähmung besteht in der Furcht vor äußerem Wandel wie Umzug oder wechselnde Geschäftsaufgaben oder Schmutz. Er nimmt Zuflucht zu Ritualen, deren Sinn in der Wiederholung besteht wie Händewaschen. Die ihn motivierende Angst betrifft den inneren Wandel: „Ich bin verdeckt von meinem Beruf, meinem eingebildeten oder wirklichen Leiden … wie Kinder, die sich in den Schnee hinlegen, um zu erfrieren. Nur im Weglaufen konnte ich mich erhalten, aber nur im Wandel bleiben.“64
Eine signifikante Form des Wandels betrifft Kafkas Umgang mit der Zeit. Sie spielt in fast allen Geschichten zweifach eine Rolle: erstens durch direkte oder indirekte Nennung, wie in „Der Prozess“ die Turmuhr und K. Zeitirrtum in der Kirche oder die lebenslange Wartezeit des Besuchers vor dem Türwächter. Zweitens durch Bruch mit der Erzählebene, das Ineinandergreifen von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. „Was die Zukunft an Umfang voraus hat, ersetzt die Vergangenheit an Gewicht und an ihrem Ende sind beide nicht mehr zu unterscheiden.“ Die innere Zeiterfahrung koppelt er an Räume, so werden Stunden zu Zimmern oder der Keller zur Mitternacht.
Es fällt auf, dass die Zukunft räumlich, die Vergangenheit mit Schwere beschrieben wird, die Bilder folglich zwei Ebenen enthalten. Weiter in der Notiz: „So schließt sich fast dieser Kreis, an deren Rand wir entlang gehen. Nur dieser Kreis gehört uns ja, gehört uns aber nur so lange wir ihn halten. Rückten wir nur einmal zur Seite in irgend einer Selbstvergessenheit, in einer Zerstreuung, einen Schrecken, ein Erstaunen, eine Ermüdung, schon haben wir ihn in den Raum verloren.“
Der Kosmos als auch die Zeit in Expansion und Kontraktion wird durch die neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse (die Kafka immer verfolgte) neu ausgelegt. Kafka interagiert mit verschiedenen Ebenen und wandelt das Bild innerhalb eines größeren Gebildes (Idee), das er entwickelt.
Wandel besteht auch innerhalb der Sprache wenn sie Ich, Zeit- und Raumerfahrung verknüpft: „Ich bin ja wie aus Stein, wie mein eigenes Grabdenkmal bin ich, da ist keine Lücke für Zweifel oder für Glauben, für Liebe, Widerwillen … nur eine vage Hoffnung lebt, aber nicht besser, als die Inschriften auf den Grabdenkmälern.“65 Die Metapher Lücke verbindet örtliche und temporale Funktionen: ohne Materie (Inschrift) und ohne Schwerlast (Stein) zu sein, Denkmal ist Grabmal und zugleich Metapher für Zweifel. Unmittelbar auf den Traumeintrag folgt die Bemerkung: „Meine Zweifel stehen um jedes Wort im Kreis herum.“ Und: „Meinem Schreiben haftet Leichengeruch an.“
Kafka fasst sein Innenleben in ein Kaleidoskop von Metaphern, die sich wechselseitig erhellen und nicht als Absolutes stehen. Einzelne Erzählungen stehen zumeist im Zusammenhang mit dem Gesamtwerk, zu dem auch die Tagebücher als literarisches Experiment zählen. Für Kafka existieren weder Anfangs- noch Endpunkt, sondern Durchgang, Störung, Neuanordnung. Daher setzen seine Geschichten unmittelbar ein und enden abrupt. Kafka erzeugt im Denken „Selbst-Kannibalismus“ (Sontag). In diesen Verwandlungen regiert der Sinn für das Vergebliche wie die Lösung eines Problems, das gar nicht existiert. „Für solche Störungen müssen eigentlich gar keine Gründe vorhanden sein in den heutigen Verhältnissen entscheidet hier oft ein Nichts.“66
1 III. Komparatistik mit Zeitgenossen
1 III. 1. Robert Walser, „Jakob von Gunten“
Die Jahrhundertwende bringt durch Frank Wedekinds „Mina Haha“ (1903) das Genre des Institutsromans in Verbindung mit Sexualität auf. Robert Musil geht in „Die Verwirrung des Zöglings Törleß“ (1906) über den klassischen Bildungs- oder Erziehungsroman hinaus, thematisiert Sadismus, Autoritätshörigkeit, Zwangshandlung und Homosexualität an einer k. u. k. Knaben-schule. Heinrich Manns „Professor Unrat“ (1905) spielt im vergleichbar wilhelminischen Kaiserreich mit nahezu identischem Sujet. Franz Werfel verlegt „Die Abiturientenprüfung“ (1928) in eine Kleinstadt zur Zeit der Donaumonarchie vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Robert Walsers Roman „Jakob von Gunten“ (1909), den Rüdiger Campe dem Genre des Institutionsromans zurechnet, beschreibt das Berliner Internat Benjamenta für angehende Hausdiener, das der Autor 27-jährig besucht hat.
Kafka ist einer der wenigen begeisterten Leser, der den modernen Aspekt darin erkennt67 und in seinen Tagebuchnotizen bejaht. Der Stil ist sachlich prägnant, zugleich dunkel und geheimnisvoll, entfremdend und bisweilen bedrohlich, Walser verlässt trotz seiner exakten Beschreibung die reale Ebene; der Text in Tagebuchform wirkt als Parabel. Es ist einer der wenigen Werke, die einen Kafkas Stil vorwegnehmen.
Im Fokus steht die verhinderte oder verweigerte Entwicklung des Weltverneiners Jakob; er stammt aus gutem Haus, will aber „eine Null sein“. Er entsagt den Privilegien, indem er sich freiwillig einer offensichtlich schlechten Schule mit autoritärem Führungsstil unterwirft. Seine „Entsagung“ vollzieht sich keineswegs heroisch, sondern trotzig-ernüchternd konträr zu Goethes „Wilhelm Meister“, den auch Kafka aufmerksam studiert. „Ich entwickle mich nicht“ oder „klein sein und bleiben“ lauten Jakobs Devisen. Er ist „gern unterdrückt“ und „kann nur in den unteren Regionen atmen.“ Einzig zum Mitschüler Kraus knüpft Jakob intimeren Kontakt, hinzu tritt sein erotisches Verhältnis zur Schwester des Direktors der Benjamenta.
Kafka vergleichbar ist Walsers juristisch-kühler Ton, die sachlich -detaillierten Beobachtungen, die mit Traum oder mystischen Visionen alternieren, Selbstanalysen durch rigide Introspektion des Erzählers, der sich dem Versuch einer Objektivierung entzieht. Jakob verdinglicht sich zu einer Sache. Die labyrinthische Schreibweise, Desorientierung, Bewusstsein für das Defizit und Verbarrikadieren als Vergleichsmomente an. 68
Schon der Beginn macht auf die absurde Situation aufmerk-sam: „Man lernt hier sehr wenig.“ Die Lehrer schlafen oder schweigen, der Unterricht besteht nur aus Gehorsam, Wiederholung und Geduld. Man spricht vom inneren Erfolg der Selbstunterdrückung bei der Dienerschaft, die nicht mehr begehrt, als unauffällig die Geschäfte ihrer Herren auszuführen. Geschäftigkeit und Bürokratisierung des Knabeninstituts entsprechen den mysteriösen Abläufen in Kafkas „Schloß“ und im „Prozess“.
Vier Punkte erscheinen dabei markant hinsichtlich des Zeit-geistes, die sich in den Institutionen, beschrieben durch Musil, Mann, Werfel und Kafka wiederfinden. Zum ersten die Lust, in der Masse zu verschwinden, die Anonymität der Großstadt, die mit Vereinsamung und bewusster (gesuchter) Bindungslosigkeit einhergeht. Jakob bereitet es Freude zu lügen, dementsprechend schwer fällt ihm der Lebensbericht, den er formal bemeistert. Damit verbunden ist die Suche nach Unterwerfung - man ahnt, dass dem Zerfall der Monarchie nur ein weiteres despotisches System folgen kann und wird - gesucht wird nicht die eigene Meinung, Verantwortung oder wenigstens Befreiung von der Bevormundung, sondern ganz im Gegenteil, Abhängigkeit und strenge Regulierung durch das Gesetz. Die Freiheit, so Jakobs seelische Führerin Benjamina, „ist etwas Winterliches, Nicht - lange - zu Ertragendes ... Man muß tapfer ins Unvermeidliche hineingehen.“69
Nur die Beschreibungen der realen Welt erscheinen grotesk absurd, die psychologischen Zwänge sind durchaus realistisches Portrait der Jahrhundertwende. Die Mischung von Theater, Rollenverhalten und Berufserziehung einerseits sowie Pflichten und Träumen Jakobs andererseits verbinden die bei-den Sphären Kants, das Reich der Zwecke und der Freiheit, das zwecklos oder reiner Selbstzweck ist.
Die zweite Gemeinsamkeit besteht die freiwillige Entfremdung aus dem natürlichen Leben. Walser stellt die Ordnung in Frage, etwa Religion oder der Metaphysik, sowohl hinsichtlich der Glaubwürdigkeit als auch des Nutzens. Er unterwirft sich aus Gewohnheit ohne Hoffnung auf Gnade: „Die Natur ist mir schon als ganz klein als etwas Himmlisch- Entferntes vorgekommen. So kann ich die Natur entbehren. Muß man denn nicht auch Gott entbehren? Das Gute, Reine und Hohe irgend, irgendwo versteckt in Nebeln zu wissen und es ganz leise, ganz still zu verehren und anzubeten … daran bin ich gewohnt.“
Im Institut Benjamina entfällt für längere Zeit der Religionsunterricht, und angesichts eines schlafenden Pfarrers er-kennt Jakob die schwindende Die Bedeutung der Religion: „Religion, sehen Sie, taugt heute nichts mehr. Der Schlaf ist religiöser als all Ihre Religion. Der Schlaf ist religiöser als all Ihre Religion. Wenn man schläft ist man Gott vielleicht noch am nächsten.“
Diese visionäre Stelle ist, da sie mit Durchschreiten von Räumen und Wartesälen verknüpft wird und Jakob zuletzt auf das Anklopfen vor den Türen verzichtet, vergleichbar mit Kafkas Parabel vom Türsteher. Der neue autoritäre Gott erscheint als die profane Inkarnation des Dieners: „Kraus ist ein echtes Gottes-Werk, ein Nichts, ein Diener.“
Auch Kafka betont in „Das Schloß“ die Suche nach den Herren, die Lust des Sich-Anbiederns, Kriechens und Gehorchen-Wollens. Ein Aufbegehren findet nicht statt, das Sich - Fügen, Geschehen - Lassen und Bewundern der Gesetze triumphieren. So verkörpert der autoritäre und gewaltbereite Direktor Gottes omnipräsente Verbote: „Gott ist auch hier. Er ist überall.“
Das dritte Vergleichsmerkmal besteht in dem erotischen Verhältnis zu unerreichbaren Frauen. Jakob träumt nach seiner Begegnung mit Fräulein Benjamina von einem unerreichbaren Glück. „Glück, sieh, es schwindet. Das Licht zerfällt, so Jakob, du sollst kein lang anhaltendes Glück haben.“
Abgesehen von Jakobs Lust an der Unterwerfung und Demütigung, besonders gegenüber dem Direktor, die derjenigen von K. und Josef K. ähnelt, genießt es der Zögling auch, seiner Lehrerin niemals auf Augenhöhe begegnen zu dürfen. Stattdessen entwickelt er erotische Fantasien, zumal sie ihn in verbotene Kammern führen. Wie im „Schloß“ der Landvermesser die Frauen nur benutzt, um Zugang zu einer ihm verschlossenen Welt der „inneren Gemächer“ zu erhalten, ist Jakob auch nur an ihrem Status interessiert, nie an der Person selbst
Das unberührte Fräulein wird umso menschlicher, je stärker sich ihr der bevorzugte Schüler Jakob ihrer zu entziehen versucht: „Ich weiß gar nicht, wie es hat kommen können, daß ich mich dir gegenüber so aller Vorgesetztengewalt entkleidet habe. Du lachst mich wohl heimlich aus. Leise gesagt: Hüte dich da. Du mußt wissen, mich packen Wildheiten an … Sage, du fürchtest dich wohl gar nicht ein bißchen?“
Mittels der Furcht regieren die Mächtigen über die Ohnmächtigen. Das gesamte Verhältnis zwischen Herr und Dienerschaft wird damit zementiert und die Geschwister konkurrieren nicht nur um Jakob, sondern eigentlich um Macht durch Furcht. Auch der Direktor gewinnt Jakob lieb und schärft ihm nach gewährten Zärtlichkeiten immer wieder ein, ihn doch fürchten zu müssen.
Vordergründig handelt es sich um Zuckerbrot und Peitsche, doch tiefgründig um die Unsicherheit, welche dem Glauben bzw. der Macht überirdische Kraft verleiht. „Das Glück dient, das ist die Moral“ formuliert Fräulein Benjamina und lebt es vor, indem sie, um Jakob zu dienen für ihn stirbt.
Das vierte vergleichbare Motiv bietet die Ambivalenz des Themas Wille zum Gehorsam. Jakob sagt, er könne alles verehren und jedem gehorchen, wenn er es nur wolle. Sein Wille ist insofern autonom, indem er sich anheftet und laut Nietzsche sich selbst zu befehlen und zu gehorchen lernt. Zwei Welten kollidieren im pädagogischen Konzept des Instituts: die Fähigkeit der Selbstverleugnung durch rigorose Anpassung und die Kraft des Urteilens über andere durch Selbstvergottung.
Der Nihilist Jakob erzeugt keine Werte, er missachtet jegliche gesellschaftlich überlieferte Tradition. Er will mit aller Macht seinen Stolz und das Herrenmensch-Rollendenken überwinden. Gewalt, Zwang und masochistische Lust an der Erniedrigung führen bei ihm zu der „freiwilligen Knechtschaft“ (Rousseau) Die Schüler des Internats unterwerfen sich den Freuden der Pflicht; Sklaven genannt als solche behandelt und dressiert. Für sie gibt es nichts Höheres als die Achtung der Gesetze: „Das Leben mit seinen wilden Gesetzen ist überhaupt für gewisse Personen nur eine Kette von Entmutigungen und schreckenerregenden bösen Eindrücken.“
Kafkas Geschichten stellen zwei Formen des Gesetzes gegenüber: den inneren und den äußeren Raum analog der inneren und der äußeren Zeit. Die beiden Sphären berühren sich nur in Gestalt des Zwangs, der in Walsers Roman entweder patriarchalisch-autoritär (Direktor) oder geheimnisvoll-erotisch (Fräulein Benjamina) konnotiert ist, zudem Bewunderung für maßlose Selbstaufgabe (Krause) beinhaltet. Eine Kommunikation auf Augenhöhe besteht in keiner der drei Konstellationen. Fräulein Benjamina stirbt laut Selbstaussage, weil sie keine Liebe gefunden hat und auch Jakob sich als unwürdig erwiesen hat. Die Motive der Selbstauslöschung und des Vorwurfs eines unausgesprochenen Mangels oder Schuld sind identisch.
Als letzter Schüler wird Jakob wird dazu gezwungen, das Internat nun zu verlassen. Jakob erklärt, nie Kind gewesen und der Direktor nie Vater gewesen zu sein. Das lässt eine wörtliche, eine figürliche oder eine Gleichnis förmige Deutung zu. Ver-Standings, Mitgefühl oder Solidarität bleiben in dieser, von Gesetzen geprägten Welt, fremd; sie werden ausdrücklich bestraft. Die Entmenschlichung führt zu Heimlichkeiten wie einem verstohlenen Lächeln und libidinösen Begehren nur in Träumen. Gefühle und Dialoge finden kaum statt.
Der Direktor ist mehr ein Vorsteher, Wächter und Gralshüter, denn eine fass- oder charakterisierbare Person. Über seinen Charakter erfährt der Leser nur, dass er gerne straft. Er ist Jakobs Gott, mit dem er das Institut verlässt: „Jetzt will ich an gar nichts mehr denken. Auch an Gott nicht? Nein! Gott wird bei mir sein ... Gott geht mit den Gedankenlosen.“
Neben der drückenden Atmosphäre und des befremdeten, weil gleichzeitig logisch und alogischen Stils überrascht auch die Vergleichbarkeit einzelner seltener Motive wie „Die Gehilfen“ oder das Sich Verirren auf Gängen oder seltsam anmuten-de „Verhöre“. Auffallend ist das Neben- statt Nacheinander der Gründe und Folgen, also das Durchbrechen von Kausalketten. Dies führt zu einem Abbau der Hierarchie zwischen Apodiktischem und Fatalismus. „Das Gewebe dieser Welt ist aus Notwendigkeit und Zufall gebildet; die Vernunft des Menschen stellt sich zwischen beide, und weiß sie zu beherrschen; sie behandelt das Notwendige als den Grund ihres Da-seins; das Zufällige weiß sie zu lenken, zu leiten und zu nutzen, und nur, indem sie fest und unerschütterlich steht, verdient der Mensch ein Gott der Erde genannt zu werden.“
Kryptische, weil zweideutige und sich wechselseitig in ihren Aussagen aufhebende Sätze Walsers sind nahezu identisch mit dem Stil Kafkas. Die gebrochene Teleologie nimmt das Subjekt aus einem vertrauensvollen Kontext heraus, es entwurzelt jede Form von Sicherheit, wofür paradigmatische Zeit und Raum stehen. Zum Ausdruck kommt das durch Bergson innerlich und Einstein äußerlich veränderte Zeitbewusstsein durch die Dynamisierung des Zweikoordinatensystems in eine Dreidimensionalität. Traum und Erlebnis werden nicht mehr getrennt oder er-scheinen als Spiegelbilder. Michel Foucault spricht von der „Epoche des Raumes“ als eine „Topografie des Begehrens“ und bezieht sich dabei auf Kafka. Utopie und Untergang bilden Parallelwelten. Der Traum verweist bei beiden Autoren auf ein irdisches Paradies oder verdrängte Sexualität bzw. Todestrieb.
1 III. 2. Ernst Weiß, „Die Galeere“
Als praktizierender Arzt infiziert er sich mit TBC, genest und wird für kriegstauglich befunden In seinen Tagbuchnotizen notiert Kafka, dem Debütroman (1913) fehle es an Form, er sei zu sehr konstruiert: „Man muß durch das Konstruktive, welches den Roman wie ein Gitter umgibt, den Kopf einmal durchgesteckt haben, dann aber sieht man das Lebendige wirklich bis zum geblendet werden." 70
Kafka, den Naturwissenschaften gegenüber aufgeschlossen, interessiert sich für „Die Galeere“ aus drei Gründen. Zum einen werden das Leben des Erfinders und die Auswirkung der Röntgenstrahlen thematisiert, zum anderen erweist sich der Forscher Erik als unfähig, mit Frauen und seinen erotischen Bedürfnissen umzugehen, zum dritten zentriert Weiß die Selbstbeobachtung körperlicher Vorgänge auf nahezu mechanische Art.
Der Roman handelt von lange unterdrückter Sexualität des jungen Arztes Erik, der sein Verlangen vornehmlich über Gewalt kompensiert; Eros bedeutet für ihn „Bestie des Geschlechts“. Erik weist eine „ideeliche Verbundenheit“71 mit Kafka auf. Analog führt Weiß die Entscheidungshemmung und die sexuelle Orientierungslosigkeit hauptsächlich auf den Vater-Sohn-Konflikt zurück. Daraus erfolgen die mangelnde soziale Integrationsfähigkeit und das Fremdsein in der Welt. Weiß schreibt über die Grundidee seines Romans: „Es sind Menschen aneinander gebunden ... Der Held ... ist der brutalste Egoist. Daraus folgt seine Vereinsamung ... Aus dieser flieht Erik in den Tod".72
Die Vereinsamung wird mit der Thematik des Opfers verknüpft. Erik opfert sein bürgerliches Glück und die eigene Gesundheit gegenüber der Forschung. Er sieht sich einer Idee verpflichtet, die er für bedeutsamer hält als das eigene Leben. Die Radikalität seiner Hingabe an die Strahlenforschung wirkt gewiss faszinierend auf Menschen, die sich um die Ablösung von der Familie und dem Beruf mühen.
Geschildert wird das Schicksal eines aus dem bürgerlichen Leben ausbrechenden Protagonisten mit autobiografischen Zügen. Möglicherweise hat Kafka dem damaligen Freund in der Person des Advokaten und Sophisten Huld in seinem Roman „Der Prozeß“ ein Denkmal gesetzt.
Erik ist wie Gottfried Benns Figur Rönne in „Gehirne“ (1915) ein Anti-Held der Moderne: sachlich, kühl, distanziert, unnahbar sogar, unmoralisch bisweilen - ein Vivisekteur, der die Seele mit einem Skalpell aufschneidet und den Leib mit „körperlichem Widerwillen“ begegnet. Weiß widmet der ausführlichen Beschreibung von Körperhaltung und Kleidung große Aufmerksamkeit.
„Die Galeere“ setzt mit exaktem Zeit- und Ortsangaben ein; es folgen Vorlieben Eriks, die sich auf das Beobachten und Sezieren beschränken. Auch. Diese Momente, vom Äußeren ins Innere zu gehen wie ein Chirurg, ist formal auffällig und mit dem Begriff Expressionismus nur undeutlich umrissen; viele Motive, wie das Schweigen, das Tragen einer Maske, die Verstellung und das Auflauern machen Kafkas und Weiß Stil vergleichbar. Die stilistische Gemeinsamkeit beruht vielleicht auch auf die Epoche des Untergangs (Motiv des Prager Kreises). Reden und Glauben begegnet man mit zunehmender Skepsis. Beide Autoren betonen das Siechtum und das Krankmachende als Symptom der Zeit. Die Haltung des Protagonisten verrät Todeswunsch; der Thanatostrieb ist auch Kafkas Antihelden zu Eigen. Unerbittlichkeit, die metallene Härte, mit der Erik dem Leben und den Frauen begegnet, erinnert an Isolation.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.