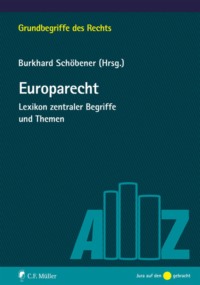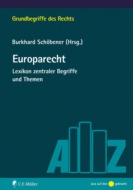Kitabı oku: «Europarecht», sayfa 12
2. Verfahren
269
Der AdR kommt zu mindestens vier Plenartagungen pro Jahr zusammen, gem. Art. 12 Abs. 1 GO AdR einmal pro Quartal. Die Einberufung erfolgt gem. Art. 307 UAbs. 1 AEUV durch den Präsidenten. Der AdR kann auf Antrag des Parlaments, des Rates oder der Kommission zusammentreten, er kann aber auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder auch von sich aus zusammenkommen. Die Sitzungen werden durch die vorgenannten Fachkommissionen vorbereitet.
270
Entschieden wird über Vorlagen regelmäßig mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, also insbesondere ohne gewichtete Stimmen je nach Größe desjenigen Mitgliedstaates, der durch das jeweilige Mitglied vertreten wird. Stimmberechtigt sind nur anwesende Mitglieder oder deren Stellvertreter. Die Mitglieder haben bei den Abstimmungen gem. Art. 300 Abs. 4 AEUV grundsätzlich ein freies Mandat, sie vertreten allerdings als Repräsentanten der nationalen Regionalinteressen regelmäßig abgestimmte Positionen.
A › Ausschuss der Regionen (Heinz-Joachim Pabst) › VI. Prozessuale Fragen
VI. Prozessuale Fragen
271
Wenn Rechte des AdR verletzt werden, also vornehmlich im Bereich der obligatorischen Stellungnahmen, kann dieser diese Rechtsverletzung aufgrund ausdrücklicher Nennung als Kläger in Art. 263 UAbs. 3 AEUV seit dem Vertrag von Lissabon selbst im Wege der → Nichtigkeitsklage geltend machen. Insoweit unterscheidet sich die Rechtsposition des AdR von der des WSA, der ein solches Klagerecht nicht besitzt. Der AdR zählt zu den teilprivilegierten Klägern, deren Klageberechtigung sich auf die Geltendmachung von institutionellen Handlungskompetenzen und Mitwirkungsrechten stützt.
A › Austritt (aus der EU) (Matthias Knauff)
Austritt (aus der EU) (Matthias Knauff)
I.Allgemeines272, 273
II.Austrittsvoraussetzungen274, 275
III.Austrittsverfahren276 – 281
IV.Konsequenzen282 – 284
Lit.:
T. Bruha/C. Nowak, Recht auf Austritt aus der Europäischen Union? – Anmerkungen zu Artikel I-59 des Entwurfs eines Vertrages über eine Verfassung für Europa, AVR 42 (2004), 1; K. Doehring, Einseitiger Austritt aus der Europäischen Gemeinschaft, FS für H. Schiedermair, 2001, 695; M.-T. Gold, Voraussetzungen des freiwilligen Austritts aus der Union nach Art. I-60 Verfassungsvertrag, in: M. Niedobitek/S. Ruth (Hrsg.), Die neue Union – Beiträge zum Verfassungsvertrag, 2007, 55; F. Götting, Die Beendigung der Mitgliedschaft in der Europäischen Union, 2000; C. Heber, Die Kompetenzverteilung im Rahmen der Austrittsverhandlungen nach Art. 50 EUV unter besonderer Berücksichtigung bestehenden Sekundärrechts, EuR 52 (2017), 581; N. A. Jaekel, Das Recht des Austritts aus der Europäischen Union – zugleich zur Neuregelung des Austrittsrechts gem. Art. 50 EUV in der Fassung des Vertrages von Lissabon, JURA 32 (2010), 87; M. Kotzur/M. Waßmuth, Do you „regrexit“? – Die grundsätzliche Möglichkeit des (unilateralen) Widerrufs einer Austrittserklärung nach Art. 50 EUV, JZ 72 (2017), 489; A. J. Kumin, Vertragsänderungsverfahren und Austrittsklausel, in: W. Hummer/W. Obwexer (Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon, 2009, 301; M. Ludewig, Beendigungstatbestände als notwendige und dynamische Elemente der Mitgliedschaft in internationalen Organisationen unter besonderer Berücksichtigung von Art. 50 EUV, 2015; B. Mayer/G. Manz, Der Brexit und seine Folgen auf den Rechtsverkehr zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, BB 2016, 1731; W. Michl, Die formellen Voraussetzungen für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, NVwZ 35 (2016), 1365; F. Peykan/M. Hanten/D. Gegusch, Scheiden tut weh: Brexit – die steuerlichen und rechtlichen Folgen, DB 2016, 1526; J. Rinze, Brexit: Austritt, Rücktritt vom Austritt und Verlust von Sonderrechten?, ZIP 2016, 2152; S. Simon, Rechtliche Vorgaben für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, JZ 72 (2017), 481; V. Skouris, Brexit: Rechtliche Vorgaben für den Austritt aus der EU, EuZW 27 (2016), 806; A. Thiele, Der Austritt aus der EU – Hintergründe und rechtliche Rahmenbedingungen eines „Brexit“, EuR 51 (2016), 281; A. Waltemathe, Austritt aus der EU – Sind die Mitgliedstaaten noch souverän?, 2000; S. Wieduwilt, Article 50 TEU – The Legal Framework of a Withdrawal from the European Union, ZEuS 18 (2015), 169; J. Zeh, Recht auf Austritt, ZEuS 7 (2004), 173.
A › Austritt (aus der EU) (Matthias Knauff) › I. Allgemeines
I. Allgemeines
272
Ausweislich der Präambel des EU-Vertrages ist die (heutige) EU seit den auf unbestimmte Zeit geschlossenen Gründungsverträgen (vgl. Art. 53 EUV, Art. 356 AEUV) dem Ziel einer Integration der Mitgliedstaaten und der „Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas“ verpflichtet. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der fehlenden Normierung eines Austrittsrechts im → Primärrecht war bis über die Jahrtausendwende umstritten, ob der Austritt eines Mitgliedstaates aus der EU überhaupt möglich sei. Während einerseits die Befürworter auf die Qualität der EU als Internationale Organisation sowie auf die Souveränität der Mitgliedstaaten verwiesen, führte andererseits die Gegenauffassung die Eigenart der europäischen Integrationsgemeinschaft i.S.e. föderalen Verfasstheit an. Mit dem Entwurf des Vertrages für eine Verfassung für Europa (→ Europäische Union: Geschichte) wurde der Streit zugunsten der Befürworter entschieden, indem erstmals eine Bestimmung über das Austrittsrecht formuliert wurde. Diese wurde schließlich mit dem Vertrag von Lissabon in Art. 50 EUV übernommen. Die Vorschrift regelt abschließend und vorrangig gegenüber dem allgemeinen Völkerrecht die Möglichkeit von Mitgliedstaaten der EU, diese zu verlassen.
273
Allerdings wurde der Frage nach dem Austrittsrecht allgemein nur eine theoretische Bedeutung zugemessen. Während ihrer jahrzehntelangen Entwicklung hatte sich die Frage nach dem möglichen Austritt eines Mitgliedstaates nur ein einziges Mal im Zusammenhang mit einem 1975 in Großbritannien durchgeführten Referendum gestellt, bei dem allerdings eine deutliche Mehrheit zugunsten eines Verbleibs in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) stimmte. Im Übrigen konnten in einigen Mitgliedstaaten (Dänemark, Vereinigtes Königreich, Irland) bestehende Bedenken gegen eine bereichsspezifische Vertiefung der Integration durch primärrechtliche Ausnahmeregeln überwunden werden, so dass diese nicht die Frage nach der Möglichkeit eines Austritts aufwarfen. Gleiches gilt schließlich für eine Anzahl abgebrochener Beitrittsprozesse (Schweiz, Norwegen, Island), bei denen die Entscheidung gegen eine Teilnahme an der EU bereits vor Erlangung der Mitgliedschaft getroffen wurde. Erstmals praktische Bedeutung hat die Frage des EU-Austritts infolge des (rechtlich nicht bindenden und überdies knappen) Brexit-Referendums in Großbritannien im Juni 2016 erlangt, das im März 2017 einen diesbezüglichen Antrag der britischen Regierung zur Folge hatte.
A › Austritt (aus der EU) (Matthias Knauff) › II. Austrittsvoraussetzungen
II. Austrittsvoraussetzungen
274
Gem. Art. 50 Abs. 1 EUV kann jeder Mitgliedstaat im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließen, aus der Union auszutreten. Die Norm fordert somit keine spezifischen Gründe und auch nicht die Benennung der Motive, sondern verweist primär auf den politischen Willen des betreffenden Mitgliedstaates. Dies entspricht den allgemeinen Regeln über die ordentliche Kündigung völkerrechtlicher Verträge, vgl. Art. 54 Buchst. a), 56 WVRK. Allenfalls dem Gebot der loyalen Zusammenarbeit, Art. 4 Abs. 3 EUV (→ Unionstreue), kann nach teilweise vertretener Auffassung entnommen werden, dass die EU sowie die übrigen Mitgliedstaaten vorab unter Berücksichtigung der Gründe zu informieren sind und die Angelegenheit mit ihnen zu diskutieren ist. Um eine durchsetzbare oder gar sanktionierte Rechtspflicht handelt es sich dabei jedoch nicht. Insbesondere wird die Wirksamkeit der Austrittserklärung durch ein anderweitiges Verhalten nicht beeinträchtigt.
275
Undeutlich ist, welche Bedeutung dem Verweis auf die Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorschriften zukommt. Hierdurch könnte die Einhaltung des nationalen Verfassungsrechts in verfahrens- wie materiellrechtlicher Hinsicht zu einem europarechtlichen Erfordernis werden, dessen Beachtung letztlich der Kontrolle durch den → Europäischen Gerichtshof (EuGH) unterliegt. Dies ist jedoch abzulehnen. Eine „Hochzonung“ von Verfassungsfragen des mitgliedstaatlichen Rechts auf die europäische Ebene widerspricht der Ableitung der EU von ihren Mitgliedstaaten als den „Herren der Verträge“ (BVerfGE 123, 267 [349 f., 368, 381, 398] – Lissabon) und stellt deren (europa- wie auch verfassungsrechtlich zumindest vorausgesetzte) Souveränität in Frage (→ Europäische Union: Strukturprinzipien). Ob ein Staat Mitglied einer Internationalen Organisation, mag sie auch in höchstem Maße entwickelt sein wie die EU, werden, sein und bleiben will, ist nicht von dieser und ihren Organen, sondern allein von dem betreffenden Staat abhängig. Daher muss auch die Entscheidung darüber, ob das nationale Verfassungsrecht beim Beschluss des Austritts beachtet wurde, allein auf nationaler Ebene getroffen werden. Insoweit kommt dem Verweis auf die Vorschriften des nationalen Verfassungsrechts in Art. 50 Abs. 1 EUV allein deklaratorische Bedeutung zu. Ob diese, wie dies in Bezug auf Art. 23 GG diskutiert wird, materiell einem EU-Austritt entgegenstehen oder spezifische parlamentarische Beteiligungsrechte vorsehen (vgl. in Bezug auf den Brexit Supreme Court, Urt. v. 24.1.2017 – [2017] UKSC 5), ist aus europarechtlicher Sicht unerheblich.
A › Austritt (aus der EU) (Matthias Knauff) › III. Austrittsverfahren
III. Austrittsverfahren
276
Das Verfahren, welches in den Austritt eines Mitgliedstaates aus der EU mündet, wird in Art. 50 Abs. 2–4 EUV (nur) in seinen wesentlichen Grundzügen ausgestaltet. Die formellen Verfahrensschritte sind daher (gleichsam spiegelbildlich zum Verfahren des → Beitritts [zur EU]) notwendig durch informelle Elemente zu ergänzen.
277
Das Austrittsverfahren wird durch eine Mitteilung des betreffenden Mitgliedstaates an den → Europäischen Rat (Art. 15 EUV) eingeleitet, in der die Austrittsabsicht bekundet wird. Es handelt sich dabei um eine einseitige, empfangsbedürftige Erklärung, welche den Beginn des formalen Austrittsverfahrens bildet und für den Fall, dass keine Verlängerung bezüglich der Verhandlungsfrist erfolgt ist, nach zwei Jahren unmittelbar den Austritt herbeiführt. Eine spezifische Form ist hierfür nicht vorgeschrieben und auch nach allgemeinem Völkerrecht nicht erforderlich. Eine schriftliche Erklärung empfiehlt sich jedoch schon aus Gründen der Klarheit und Praktikabilität. Sie ist an den Präsidenten des Europäischen Rates oder dessen Generalsekretariat zu richten und erfolgt gemäß den allgemeinen völkerrechtlichen Regeln durch eine Person, die zur Abgabe von Erklärungen mit Wirkung für den von ihr vertretenen Staat befugt ist; vgl. Art. 7 WVRK (analog), etwa den Staats- oder Regierungschef oder den Außenminister.
278
Infolge der Austrittserklärung durch den Mitgliedstaat verabschiedet der Europäische Rat Leitlinien in Bezug auf die nunmehr zwischen der EU und dem austretenden Mitgliedstaat durchzuführenden Verhandlungen. Dabei kann er Verhandlungsgegenstände und -reihenfolge festlegen. Ziel und Gegenstand der Verhandlungen sind ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts, die im Falle des Brexit insbesondere die Rechtsstellung der EU-Ausländer im Vereinigten Königreich und der britischen Staatsbürger in der EU sowie die finanziellen Folgen betreffen, und der Rahmen für die künftigen Beziehungen zwischen der EU und diesem Staat. Das Abkommen wird (wie auch sonstige völkerrechtliche Verträge der EU) nach Art. 218 Abs. 3 AEUV ausgehandelt. Dies hat grundsätzlich innerhalb von zwei Jahren zu geschehen. Eine Verlängerung dieser Frist um eine normativ nicht näher determinierte Zeit kann der Europäische Rat im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat beschließen. Dies setzt allerdings eine politisch schwer zu erlangende Einstimmigkeit voraus. Der austretende Staat nimmt während dieser Phase weder an den Beratungen im → Rat (Ministerrat) oder Europäischen Rat, welche seinen Austritt betreffen, noch an den Beschlussfassungen teil. Im Übrigen bleiben seine aus der EU-Mitgliedschaft folgenden Rechte während der Verhandlungsphase unberührt.
279
Bei dem zu schließenden Abkommen handelt es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag, dessen Parteien ausschließlich die EU und der austretende Staat sind. Es wird seitens der EU nach Zustimmung des → Europäischen Parlaments vom Rat in deren Namen geschlossen. Der Rat entscheidet dabei mit (erhöhter) qualifizierter Mehrheit i.S.v. Art. 238 Abs. 3 Buchst. b) AEUV. Die verbleibenden Mitgliedstaaten sind hieran nicht beteiligt. Die mit dem Austritt einhergehende → Vertragsänderung im Hinblick auf die Verringerung der Zahl der Mitgliedstaaten erfolgt automatisch, da nicht dieser, sondern seine Folgen Gegenstand des Abkommens sind und der Austritt als solcher einseitig durch die diesbezügliche Erklärung herbeigeführt wird. Es erfolgt jedoch eine zeitliche Verknüpfung des Wirksamwerdens des Austritts und des Inkrafttretens des Abkommens, sofern nicht die (ggf. verlängerte) Zweijahresfrist zuvor abläuft.
280
Da der EU-Austritt als langwieriger Prozess ausgestaltet ist und auch die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen dem austrittswilligen Staat und der EU nicht vorhersehbar sind, kann sich der politische Wille in dem betreffenden Staat während dieser Zeit ändern. Solange der Austritt noch nicht gegenüber dem Europäischen Rat erklärt wurde, wirft dies juristisch keine Schwierigkeiten auf, da das Austrittsverfahren in diesem Fall noch nicht begonnen hat. Umstritten ist dagegen die Frage, ob ein Mitgliedstaat von einem formell erklärten Austritt einseitig wieder Abstand nehmen kann. Hierfür spricht v.a. das Integrationsziel der EU. Dagegen spricht allerdings, dass Art. 50 Abs. 3 EUV die Geltung der Gründungsverträge für den betreffenden Staat bei Fehlen eines Abkommens und unterbliebener Verlängerung der Verhandlungsfrist nach Ablauf von zwei Jahren automatisch entfallen lässt. Damit weist das Primärrecht das Risiko eines Scheiterns der Verhandlungen dem austretenden Mitgliedstaat zu. Hätte es dieser in der Hand, durch einen „Widerruf“ der Austrittserklärung bei einem aus seiner Sicht unbefriedigenden Verhandlungsverlauf den Austrittsprozess zu stoppen, könnte er das für die Verlängerung der Verhandlungsfrist vorgesehene Einstimmigkeitserfordernis leerlaufen lassen und im Nachhinein einen „neuen Anlauf“ nehmen.
281
Darüber hinaus sprechen auch die Wertungen des Völkerrechts gegen eine Widerrufbarkeit der Austrittserklärung. Ein einseitiges Rechtsgeschäft kann nach dem Völkergewohnheitsrecht dann zurückgenommen werden, wenn dies nicht mit dessen Inhalt unvereinbar ist oder dem die Grundsätze von Vertrauensschutz, acquiescence und estoppel entgegenstehen. Letzteres ist regelmäßig dann gegeben, wenn die beabsichtigten Rechtswirkungen nicht nur das handelnde Völkerrechtssubjekt betreffen. Dies ist auch bei der Erklärung des EU-Austritts der Fall. Erklären sich dagegen alle Mitglieder des Europäischen Rates (und damit alle Mitgliedstaaten) mit dem Widerruf der Austrittserklärung einverstanden, ist dieser wirksam, das Austrittsverfahren beendet und der vormals austrittswillige Mitgliedstaat verbleibt in seiner zuvor bestehenden Mitgliedschaftsposition (einschließlich etwaigen Sonderrechten). Art. 50 Abs. 5 EUV ist insoweit tatbestandlich nicht einschlägig.
A › Austritt (aus der EU) (Matthias Knauff) › IV. Konsequenzen
IV. Konsequenzen
282
Mit Wirksamwerden des Austritts endet die Mitgliedschaft des betreffenden Staates in der EU. Art. 50 Abs. 3 Hs. 1 EUV formuliert dies dahingehend, dass „[d]ie Verträge […] auf den betroffenen Staat […] keine Anwendung mehr [finden]“. Dies betrifft nicht nur das gesamte Primärrecht, sondern den gesamten acquis communautaire, sofern dessen Fortgeltung nicht innerstaatlich angeordnet ist. Hieraus können sich schwierige juristische und tatsächliche Übergangsprobleme ergeben. Mit dem Wirksamwerden des Austritts einher geht auch, dass der bisherige Mitgliedstaat seine Mitgliedschaftsrechte verliert, insbesondere Sitz und Stimme in den EU-Organen. Von seitens der EU mit Drittstaaten abgeschlossenen völkerrechtlichen (Handels-)Verträgen wird er infolgedessen ebenfalls nicht mehr erfasst.
283
Welche Rechtsstellung der ausgetretene Staat nachfolgend im Verhältnis zur EU hat, richtet sich grundsätzlich nach den Vereinbarungen des Austrittsabkommens. Tritt er zugleich in ein anderes Staatenbündnis ein, etwa den → Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder die → Europäische Freihandelszone (EFTA), wird er auch von den zwischen diesem und der EU geschlossenen Vereinbarungen erfasst. Im Falle des Fehlens eines Austrittsabkommens wird der ausgetretene Staat aus Sicht der EU zum Drittstaat. In diesem Falle richtet sich das Verhältnis ausschließlich nach dem allgemeinen Völkerrecht.
284
Will ein aus der EU ausgetretener Staat dieser erneut beitreten, steht es ihm frei, einen Beitrittsantrag zu stellen. Über diesen ist, wie Art. 50 Abs. 5 EUV klarstellt, im Beitrittsverfahren nach Art. 49 EUV zu entscheiden. Etwaige vormals bestehende Ausnahmen und Sonderrechte leben dabei nicht wieder auf, da es sich juristisch um eine gänzlich neue EU-Mitgliedschaft handelt, nicht um eine Fortführung der durch den Austritt endgültig beendeten.
A › Auswärtiges Handeln der Union (Charlotte Kreuter-Kirchhof)
Auswärtiges Handeln der Union (Charlotte Kreuter-Kirchhof)
I.Grundlagen285 – 287
II.Außenkompetenz der EU (Verbandskompetenz)288 – 294
1.Ausschließliche Zuständigkeiten der Union291, 292
2.Parallele Zuständigkeiten der Union und der Mitgliedstaaten293
3.Geteilte Zuständigkeiten der Union und der Mitgliedstaaten294
III.Gemischte Abkommen der EU und der Mitgliedstaaten295
IV.Organkompetenz in der EU296
V.Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der EU297 – 299
Lit.:
M. Bungenberg, Außenbeziehungen und Außenhandelspolitik, EuR 44 (2009, Beiheft 1), 195; U. Fastenrath, Auswärtige Gewalt im Europa der Achtundzwanzig. Zuständigkeiten – Ingerenzen – Bindungen, FS für C. Vedder, 2017, 267; C. Herrmann/T. Müller-Ibold, Die Entwicklung des europäischen Außenwirtschaftsrechts, EuZW 27 (2016), 646; M. Krajewski, Normative Grundlagen der EU-Außenwirtschaftsbeziehungen: Verbindlich, umsetzbar und angewandt?, EuR 51 (2016), 235; R. A. Lorz/V. Meurers, Außenkompetenzen der EU, in: A. v. Arnauld (Hrsg.), Europäische Außenbeziehungen, 2013, § 2; A. v. Arnauld (Hrsg.), Europäische Außenbeziehungen, 2013.
A › Auswärtiges Handeln der Union (Charlotte Kreuter-Kirchhof) › I. Grundlagen
I. Grundlagen
285
Die Europäische Union verfügt über auswärtige Hoheitsgewalt. Sie kann völkerrechtliche Verträge mit Drittstaaten oder Internationalen Organisationen abschließen, diesen beitreten und einseitig wirksam völkerrechtlich handeln. Eine wichtige Aufgabe der Europäischen Union liegt darin, die Interessen der Mitgliedstaaten und der Union auf internationaler Ebene zu vertreten und einen Beitrag zur Lösung internationaler Konflikte und Aufgaben zu leisten. Dabei umfasst das internationale Handeln der Union Wirtschafts- und Umweltschutzfragen sowie zunehmend auch die Zusammenarbeit im Bereich der internationalen Sicherheit und Verteidigung.
286
Die Europäische Union besitzt Völkerrechtssubjektivität (→ Europäische Union: Rechtspersönlichkeit). Art. 47 EUV bestätigt die Rechtsfähigkeit der Union, begründet aber keine eigenen Kompetenzen der Union zum auswärtigen Handeln (sog. → Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung; Erklärung Nr. 24 zum Vertrag von Lissabon). Die von den Mitgliedstaaten abgeleitete Völkerrechtssubjektivität der Union ist in der Völkerrechtspraxis heute universell anerkannt.
287
Die Völkerrechtssubjektivität der Union ist funktional begrenzt. Auch für das auswärtige Handeln der Union gilt der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 EUV). Im Laufe der Zeit wurden die auswärtigen Kompetenzen der EU wesentlich erweitert. Insbesondere im Bereich der → Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) behalten sich die Mitgliedstaaten aber nach wie vor wichtige Souveränitätsrechte vor.
A › Auswärtiges Handeln der Union (Charlotte Kreuter-Kirchhof) › II. Außenkompetenz der EU (Verbandskompetenz)