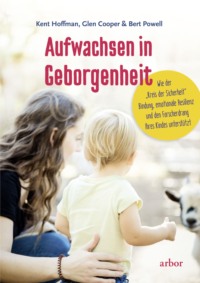Kitabı oku: «Aufwachsen in Geborgenheit», sayfa 5
…und weniger Ratschläge
Es ist nicht verwunderlich Wunde, dass wir glauben, wir müssten perfekte Eltern sein. Nur allzu oft fühlen wir uns allein auf weiter Flur. Darum sind wir natürlich versucht, nach Anleitungen, Regeln und Garantien zu suchen. Es gibt so vieles, was wir erledigen und erreichen müssen, dass wir manchmal versuchen, zeitraubende Problemlösungsprozesse zu überspringen und schnelle Antworten bei außenstehenden Experten zu suchen. Im November 2015 veröffentlichte die Washington Post einen Beitrag über die steigende Popularität von Psychotherapien mittels Apps und Webseiten, bei denen der Fokus darauf liegt, kurzfristige Lösungen für persönliche Probleme zu finden. Da die Millennials und die Generation X häufiger unter Ängsten und Depressionen leiden als die Generationen vor ihnen, ist es nicht überraschend, dass sie versuchen, eine Lösung zu finden, die weder langwieriger Reflexionen noch andauernden Kontakts bedarf. Aber unserer Erfahrung nach ist Psychotherapie genau wie Elternsein etwas, das auf dem Erleben von Verbundenheit beruht. Der Kurs Kreis des Sicherheit ist so entworfen worden, dass er Eltern das gibt, was Donald Winnicott eine „haltende Umgebung“ nannte – einen sicheren Raum, in dem sie sich verstanden und angenommen fühlen und sich der manchmal schwierigen Aufgabe widmen können, ihren Erziehungsstil eingehender zu erkunden, um herauszufinden, ob sie sich an der einen oder anderen Stelle anders entscheiden wollen.
Amerikaner erleben in den Jahren der Elternschaft großen Stress
Im Jahr 2013 berichtete die American Psychological Association, dass die sogenannten Millennials (heute im Alter zwischen 18 und 33 Jahren) und die Generation X (im Alter zwischen 34 und 47) ihr Stressempfinden auf einer Skala von 1–10 mit dem Wert 5,4 einstufte (wobei 1 für kein Stress und 10 für sehr viel Stress steht) – als ein gesundes Stressniveau allerdings gilt 3,8. Die Erwachsenen in diesen Altersgruppen bekundeten zwar die Absicht, ihren Stress zu verringern, berichteten aber auch, Probleme im Umgang mit Stress zu haben, oft wach zu liegen und sich Sorgen zu machen und regelmäßig gereizt und ärgerlich zu sein. Stress hat einen großen Einfluss auf die Stimmung, die sich natürlich auch auf die Pädagogik auswirkt.
Es gibt Tausende hilfreicher Erziehungsbücher sowie zahlreiche Kurse, in denen man sich über verschiedene Aspekte der Kindeserziehung informieren kann, und die nützliche Prinzipien und Philosophien als unterstützende Grundlage zur Verfügung stellen. Wenn Sie als Eltern Vertrauen in Ihre eigene Fähigkeit haben, so für Ihr heranwachsendes Kind zu sorgen, wie es für Sie und Ihre Familie stimmt, werden Sie von diesen Ressourcen sicherlich guten Gebrauch machen. Es geht uns nicht darum, Sie vor den Ratschlägen anderer zu warnen. Um davon profitieren zu können, brauchen Sie jedoch das Vertrauen, selbst zu entscheiden, welchem Rat Sie folgen und wie Sie ihn umsetzen. Falls Sie versuchen, eine perfekte Mutter oder ein perfekter Vater zu sein, klammern Sie sich vielleicht an den neuesten Erziehungstrend und befolgen dessen Grundsätze, als ob es ein lebensrettendes Rezept wäre. Aber was, wenn Sie „scheitern“? Oder wenn die Tipps und Techniken nicht halten, was sie versprechen? Oder jemand mit einem angeblich noch „besseren“ Konzept daherkommt? Wieder einmal werden Sie als ungenügend verurteilt – von sich selbst oder von jenem unsichtbaren Aufseher, der stets über Ihren Bemühungen schwebt. Möglicherweise ziehen Sie zum nächsten großen Erziehungstrend weiter und drehen eine weitere Runde. Die Überfülle an guten Ratschlägen bietet Ihnen unzählige Wege, die sie ausprobieren können – und allein ihre Anzahl vermittelt die implizite Botschaft, dass Sie perfekte Eltern sein könnten, wenn Sie sich nur besser informieren würden. Es ist nichts falsch daran, über viel Wissen und Können zu verfügen. Aber warum nicht damit anfangen, was Sie bereits wissen? Der Kreis der Sicherheit soll Sie darin unterstützen, mit der Ihnen innewohnenden Fähigkeit zu Weisheit und Liebe in Kontakt zu bleiben.
Übereltern. Überwachung. Überengagement.
Diese Dinge gibt es tatsächlich. Sie sind, zumindest teilweise, das Ergebnis von „Expertenratschlägen“, die die lange Liste dessen, was man tun und lassen soll, noch länger machen (und die unterschwellige Botschaft in sich tragen: „Mach es richtig, ansonsten…“).
Stress. Stress. Stress.
Vielleicht kennen Sie die Geschichte von dem Tausendfüßler, der nicht mehr laufen konnte, weil jemand ihm gesagt hatte, es sei ganz wichtig, dass er einen jeden seiner Schritte zählte. Ganz ähnlich verhält es sich mit vielen Dingen in der Erziehungskultur, einer Kultur, die für Eltern inzwischen fast erdrückend ist, weil die potenziellen Auswirkungen des „nächsten Schritts“ (der ja falsch oder gar verhängnisvoll für das Kind sein könnte) uns an Ort und Stelle erstarren lassen. „Wenn ich X tue, wird es ihm so und so ergehen, und wenn ich Y nicht tue, wird er so und so enden.“ Und so fühlen wir uns zwischen Überwältigung und Ratlosigkeit gefangen, ohne jeglichen Referenzpunkt, auf den wir vertrauen können.
Ein halbes Jahrhundert Entwicklungsforschung hat jedoch zum Glück eine Klarheit gebracht, die mit der Zeit zu immer mehr Eltern durchdringt. Sie sagt sehr wenig darüber, was man tun und lassen sollte; viel mehr bietet sie die Möglichkeit, verschiedene Empfehlungen zu verstehen und dann eigene Entscheidungen zu treffen. Die Bindungstheorie und ihre praktische Anwendung im Kreis der Sicherheit ermöglicht uns, diese Entscheidungen zu treffen, ohne dass wir dazu ein „Zehn-Schritte-Programm zur erfolgreichen Erziehung“ befolgen müssen.
Es mag nicht leicht sein, das zu hören, aber wenn wir unsere Kinder zu emotionaler Gesundheit anleiten wollen, dann erfordert das, dass wir gesunde Entscheidungen treffen. Wichtiger als eine bestimmte Entscheidung ist jedoch, wer wir sind und wie wir uns fühlen, wenn wir diese Entscheidung treffen. Wenn man einfach einer Formel oder einer Anleitung folgt, wie man zu einem zufriedenen Baby kommt, wird das Kind sich dressiert oder manipuliert vorkommen, selbst wenn die besten Absichten dahinterstehen.
Das Problem ist folgendes: Wie kann man wichtige Dinge über Kinderbetreuung lernen, die sich für das Kind tatsächlich positiv auswirken, ohne dabei den Ängsten zu erliegen, die durch einen pädagogischen Ansatz nach dem Motto „richtig versus falsch“ ausgelöst werden? Wenn Sie beim Lesen dieser Seiten nervös werden – oder noch nervöser, als Sie es bereits sind –, haben wir Ihnen keinen Dienst erwiesen. Doch wenn Sie die Bedeutung dessen erkennen, was Sie tun, und es Ihnen außerdem in zunehmendem Maße leichtfällt, Ihrem Kind das zu geben, was es braucht, dann haben wir genau das erreicht, was wir uns erhoffen.
Der Irrweg des Verhaltensmanagements
In Kapitel 1 haben wir erwähnt, dass im zwanzigsten Jahrhundert die Bedeutung von Bindung zugunsten des Behaviorismus heruntergespielt wurde. Das bedeutet nicht, dass Verhalten nicht wichtig ist. Es bedeutet, dass das Verhalten nicht das Problem ist – auch wenn es einem natürlich so vorkommt, wenn man gerade verzweifelt versucht, sein „unmögliches Kind“ dazu zu bewegen, ins Auto zu steigen, weil man mit ihm zum Einkaufen oder in den Kindergarten fahren will. Verhalten ist einfach eine Botschaft. Dennoch liegt in unserer Gesellschaft das Augenmerk oft noch immer auf dem Verhalten des Kindes. Zweifellos ist ein Verhalten, das dem Lernen zuträglich ist, wichtig, sobald das Kind zur Schule geht, und wir alle müssen uns so benehmen, dass wir uns durch die Welt bewegen können, ohne den anderen Menschen und ihren Absichten unnötig in die Quere zu kommen, während wir versuchen, unsere eigenen Ziele zu erreichen. Aber bei sehr kleinen Kindern sollte der Fokus der Fürsorge nicht auf dem Verhalten liegen.
Verhaltensansätze sind wunderbar, wenn sie funktionieren, oft aber ändern sie nur vorübergehend etwas an dem Verhalten, ohne die zugrunde liegenden Probleme zu adressieren, aus denen das Verhalten resultiert. Das liegt daran, dass sie im Wesentlichen ein weiterer Versuch einer schnellen oder oberflächlichen Lösung sind. Wenn wir das Verhalten unserer Kinder erfolgreich verändern, fühlen wir uns dadurch vielleicht gut, weil unsere braven Kinder der sichtbare Beweis unserer Fähigkeiten als Eltern zu sein scheinen – und dieses Gefühl brauchen wir natürlich, wenn wir immerzu nach Perfektion streben und dabei unweigerlich scheitern. Mehr zu der Vorstellung von perfekten Eltern und perfekten Kindern später. Für jetzt mag es genügen zu sagen, dass wir uns durch die Erfahrung emotionaler Verbundenheit, die aus der sicheren Bindung zu unserem Kind resultiert, wahrscheinlich weitaus besser fühlen, als wenn wir sein schlechtes Benehmen „managen“.
Wenn Sie verstehen wollen, wie man unserer Meinung nach Verhalten zutreffender betrachten kann, stellen Sie sich einen Eisberg vor. An der Oberfläche sehen Sie lediglich eine enorme Anhäufung von Eis. Was Sie nicht sehen, ist die Masse, die sich unter der Oberfläche befindet und die oft mehr als 80 % des eigentlichen Eisbergs ausmacht. Stellen Sie sich nun vor, dass das, was Sie an der Oberfläche sehen, die Verhaltensweisen des Kindes sind, und das, was Sie nicht sehen, seine legitimen Bedürfnisse nach Unterstützung und Regulation. Wir haben in vielen verschiedenen Settings (Schulen, Pflegeheimen, Familienberatungen) mit vielen gefährdeten Kindern gearbeitet, und wir haben dabei erlebt, wie wichtig es ist, dass die Bezugspersonen sich stets der legitimen Bedürfnisse bewusst sind, die oft unterhalb der Oberfläche eines bestimmten (negativen) Verhaltens liegen. Einer von uns Autoren erinnert sich, als junger Pflegevater Sternchenkarten, Auszeiten, logische Konsequenzen und weitere verschiedene Formen positiver und negativer Verstärkung mit wenig dauerhaftem Erfolg ausprobiert zu haben, bevor er schließlich dazu überging, sich mit dem Kind, das gerade ausflippte, hinzusetzen und zu sagen: „Wir bleiben jetzt dabei, bis wir auf der anderen Seite ankommen.“ Hatte sich erst einmal eine Beziehung entwickelt, in der das Teilen von Gefühlen entscheidend für die Lebenserfahrung der Kinder war, löste sich das problematische Verhalten auf. Wenn man nur auf das Verhalten reagiert und das Bedürfnis nicht beachtet (das vor den Augen aller verborgen liegt), so mag das unserer Erfahrung nach zwar in kurzfristiger Folgsamkeit resultieren, doch es ist eine verpasste Gelegenheit für eine langfristige Veränderung.
Wir sind der Ansicht, dass Gefühle, die nicht zur Haustür hereingelassen werden, sich in negatives Verhalten verwandeln, das schließlich gewaltsam durch die Hintertür hereinbricht.
Im Laufe der Jahre sind wir zu der Erkenntnis gelangt, dass alle Kinder unter der Oberfläche „weise und abwartend“ sind. Kinder verfügen über eine ihnen innewohnende Weisheit darüber, was sie am meisten brauchen, und häufig warten sie viele Jahre, bis sie schließlich jemanden finden, der ihr eigentliches Bedürfnis erkennt und darauf eingeht.
Eltern oder Freunde?
Nach einer schnellen Antwort suchen, die neuesten Anleitungen befolgen und das Symptom behandeln statt das zugrunde liegende Problem – all dies sind Resultate davon, dass Eltern sich allzu große Mühe geben. Verzweifelt nach einem Weg suchend, sind diese Versuche möglicherweise das Einzige, was einem noch bleibt, wenn es unmöglich ist, den eigenen Erwartungen gerecht zu werden. Wenn Sie glauben, dass die Messlatte himmelhoch ist und Sie sie um jeden Preis erreichen müssen, werden Sie natürlich nach allem greifen, was Ihnen eventuell helfen könnte.
Natürlich besteht Bindung in emotionaler Verbundenheit. Aber für Ihr Kind mit all seinen Bedürfnissen da zu sein ist weitaus mehr als das. Es beinhaltet, die Führung zu übernehmen, wann immer es notwendig ist, und im Eltern-Kind-Paar den Part des oder der Älteren und Weiseren einzunehmen. In den letzten Jahrzehnten gab es viele Diskussionen über neue Erziehungsstile von liberal bis autoritär, wobei die meisten Experten empfehlen, in Bezug auf Autorität die goldene Mitte anzustreben – das heißt, darauf zu vertrauen, dass wir wissen, was in einer gegebenen Situation für dieses bestimmte Kind richtig ist, und keine Angst zu haben, nach dieser Überzeugung zu handeln. Doch die Auflösung des „Generationskonflikts“, den die Babyboomer erlebt haben, mag dazu beigetragen haben, die Grenze zwischen der Rolle eines Elternteils und der eines Freundes zu verwischen, und die Millennials und die Generation X, die heutigen Eltern also, sind die Erben dieses (Miss-)Verständnisses.
Wenn man versucht, mehr Freund als Eltern zu sein, ist das unserer Erfahrung nach oft eine weitere Form von Perfektionismus, und zwar eine, die aufreibende Auseinandersetzungen und den unvermeidlichen Kummer des Kindes fürchtet. Selbstverständlich wünschen wir uns, dass unsere Kinder glücklich sind, und es ist wunderbar, wenn wir ein freundschaftliches Verhältnis zu ihnen haben, aber die Tatsache, dass wir die Älteren und Weiseren – auch „Eltern“ genannt – sind, muss den Rahmen für diese Beziehung bilden. Gesundes Begleiten von Kindern ist keine Demokratie. Um sich sicher und geborgen zu fühlen, müssen die Kinder erleben, dass sie jemandem so wichtig sind, dass er oder sie die Führung übernimmt, selbst dann, wenn das bedeutet, unpopuläre Entscheidungen zu treffen und Disharmonie aushalten zu müssen.
Die Bürde unseres unvollkommenen (chaotischen) Selbst
Der Druck, perfekt zu sein, kommt nicht nur aus der Außenwelt oder ist ein Resultat davon, wie wir die Botschaften der Gesellschaft interpretieren. Unsere Vorstellungen darüber, wie wir als perfekte Eltern für unsere Kinder zu sein haben, kommen auch von innen. Wir alle tragen Erinnerungen, explizite wie implizite, mit uns herum, und sie prägen all unsere Beziehungen. Beim Aufziehen von Kindern sind unserer Ansicht nach nicht Ihre Handlungen das Entscheidende, sondern die Perspektive, aus der Sie Ihre Handlungen betrachten. Wenn man zum Beispiel von Ihnen als Kind erwartet hat, „perfekt“ zu sein, dann übertragen Sie diese Erwartung höchstwahrscheinlich auch auf Ihre eigene Elternschaft. Der Wunsch, dass Ihre Kinder niemals den Schmerz fühlen müssen, den Sie selbst einst gefühlt haben, kann in ungesunder Art und Weise auf Ihnen lasten. Natürlich ist es in gewissem Maße wichtig, was Sie tun. Aber noch wichtiger ist, wer Sie sind, während Sie es tun.
Ihre innere Verfassung überträgt sich auf Ihr Kind genauso, wenn nicht sogar noch mehr als das, was Sie tatsächlich tun. In unseren Kursen weisen wir immer wieder darauf hin, dass Kinder zwischen den Zeilen lesen. Sie achten auf unsere Handlungen, doch noch mehr achten sie auf die innere Verfassung, die hinter unseren Handlungen steht. Wenn Sie zum Beispiel versuchen, Ihr Kind nach einem Sturz zu beruhigen und dabei genau die richtigen Worte finden („Oh je, mein Schatz, das fühlt sich bestimmt gerade ganz schlimm an“), aber insgeheim denken: „Ich bin keine gute Mutter. Ich hoffe, ich mache das richtig, aber ich glaube nicht“, wird sich Ihr Kind wahrscheinlich nicht so rasch beruhigen, wie es ihm ansonsten möglich wäre.
Uns ist bewusst, dass diese Information ziemlich fatalistisch wirken kann: „Wenn ich aus einer nicht gerade idealen Familie komme, wird mein Kind meine Unsicherheit spüren, ganz gleich, wie sehr ich mich auch bemühe.“ Glücklicherweise ist das aber nicht der Fall. Was unsere Kinder spüren, ist unsere tiefe Absicht, ihnen jene Sicherheit zu geben, die sie am meisten brauchen. Unsere positiven Absichten bilden die zwischen den Zeilen versteckte Botschaft, die für sie am wichtigsten ist: Wir beabsichtigen stets, ihnen das Gute zu geben, das sie brauchen, in einem Kontext, der niemals perfekt ist. Unsere Kinder brauchen keine Perfektion, sondern sie müssen darauf vertrauen können, dass wir ihre legitimen Bedürfnisse erfüllen wollen, und das schließt mit ein, nach einem klaren und stimmigen Weg zu suchen, diese Bedürfnisse zu verstehen.
Oft schränkt unsere Geschichte unseren Blick ein
Manchmal machen uns die Lektionen, die wir in unserer Kindheit gelernt haben, blind dafür, was unsere Kinder brauchen, und das selbst dann, wenn wir zur Orientierung eine Karte wie den Kreis der Sicherheit haben. Wenn wir in unserer eigenen Kindheit nicht das Glück einer sicheren Bindung hatten, kann es besonders wichtig, aber auch besonders schwierig sein, uns im Hinblick auf unser pädagogisches Verhalten zu öffnen. Haben Sie in der Intimität Erfüllung gesucht, aber nicht wirklich gefunden? Haben Sie das Gefühl, dass Sie immer irgendetwas davon abhält, die Art von Leben zu führen, die Sie sich erhofft haben? Natürlich wäre es eine grobe Verallgemeinerung, zu sagen, dass eine unsichere Bindung hinter allem steht, womit Sie unzufrieden sind, aber Bindung hat einen solch starken Effekt auf jeden Aspekt unseres Lebens, dass Unsicherheit in der frühen Kindheit bei den Enttäuschungen, die wir als Erwachsene erleben, durchaus eine Rolle spielen kann. Dieses Buch lädt Sie dazu ein, Ihren eigenen Bindungsstil und dessen Auswirkungen auf Ihr Leben zu erforschen.
Perfektes Kind → perfekte Eltern?
Eine häufige Nebenwirkung von perfektionistischer Erziehung ist der Wunsch nach dem perfekten Kind. Dieses Phänomen steht mit einem bestimmten Bindungsstil in Zusammenhang und wird durch implizite Erinnerungen an die Bindung an unsere Eltern angetrieben, die wir nun in unsere eigene Elternschaft hineintragen. Wie jene Erinnerungen zu unserem Vermächtnis werden, wenn wir uns nicht bewusst sind, wie sie im Hintergrund unserer Elternschaft die Fäden ziehen, werden wir in Kapitel 5 noch ausführlicher besprechen. Doch das Muster des perfekten Kindes sehen wir, wohin wir auch blicken. Wenn man die Reaktionen auf Amy Chuas Buch Battle Hymn of the Tiger Mother aus dem Jahr 2011 betrachtet, wird einem klar, mit welcher Ernsthaftigkeit viele Eltern in den Erfolgen ihres Kindes eine Reflexion davon sehen, wie gut sie ihre „Aufgabe“ als Eltern gemacht haben. Das Buch war ursprünglich als Kommentar zu unserer Kultur gedacht, wurde dann aber zum Gegenstand einer hitzigen Debatte darüber, ob es richtig ist, wenn wir als Eltern Perfektion von unseren Kindern verlangen. Die Vorstellung, dass ein erfolgreiches Kind mit erfolgreichen Eltern gleichbedeutend ist (egal, ob es um die Manieren des Kindes, seine sportlichen Leistungen, seine Intelligenz oder seine äußere Erscheinung geht), ist weitaus verbreiteter – und augenscheinlich überzeugender –, als wir es uns oft eingestehen wollen.
Dann gibt es da noch den Impuls, unsere Kinder als etwas „Besonderes“ zu betrachten. Auch er steht mit einem bestimmten Bindungsstil im Zusammenhang, der in Kapitel 5 erläutert wird. Er kann sich, wie in Kapitel 1 erwähnt, darin ausdrücken, dass wir jedem Gefühl des Kindes absoluten Vorrang einräumen, weil wir annehmen, unser Kind sei nicht imstande, Frustration oder Ärger auszuhalten. Wir werden noch ausführlicher darauf eingehen, wie unsere Versuche, unsere Kinder übermäßig zu beschützen und ihnen möglichst alle Schwierigkeiten und Probleme aus dem Weg zu räumen, sie der Fähigkeiten berauben, die sie brauchen, um Resilienz zu entwickeln. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Fähigkeiten, die nur im Kontext gemeinsamer Problemlösung und verständnisvoller Unterstützung und unter nicht idealen Umständen gelernt werden können. Dieser Impuls kann sich aber auch darin ausdrücken, dass wir das Kind überschätzen und glauben, es sei außergewöhnlich begabt und seinen Altersgenossen überlegen. Wie in Kapitel 1 erwähnt, stärkt es nicht das Selbstwertgefühl eines Kindes, wenn man ihm sagt, es sei besser als die anderen; stattdessen verstärkt es seine narzisstischen Tendenzen. Eine sichere Bindung, die auf dem Vertrauen des Kindes in die Liebe der Eltern beruht, stärkt sein Selbstwertgefühl.
Natürlich besteht eine der drängendsten Sorgen von Eltern darin, dass ihre Kinder „zurückbleiben“ könnten. Zwar wüssten viele von uns noch nicht einmal, wie sie die Frage „Hinter was zurückbleiben?“ beantworten sollten, doch hält uns die vage Vorstellung, ein wichtiges Ziel verfehlt zu haben, wenn wir unsere Kinder nicht antreiben, in dieser Sorge gefangen. Oft dreht sich diese Sorge um die kognitive Entwicklung. Werden unsere Kinder intelligent und gebildet genug sein und ausreichend gute Leistungen in der Schule erbringen, um später da anzugelangen, wo sie hinwollen (oder wo wir sie gerne sähen)? Die Debatte darüber, worauf in der Früherziehung besonders Wert gelegt werden sollte, tobt weiter: auf die soziale Entwicklung, die emotionale Intelligenz, die Fantasie und die Kreativität oder die intellektuellen Fähigkeiten? In den Vereinigten Staaten konzentrieren wir uns noch immer hauptsächlich auf Letzteres, und das, obwohl die Länder, die wir auf dem Marktplatz der Erwachsenen als unsere größten Konkurrenten ansehen, in den ersten Schuljahren eher das Spielen und die sozialen Interaktionen als wichtig erachten – und deren Kinder in den höheren Klassen bessere kognitive und sonstige Leistungen erbringen. In diesen Ländern wird die Bedeutung des Spiels für die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung von Kindern erkannt. Betrachten Sie die Beziehung zu Ihrem Kind als dessen ersten Spielplatz: ein Platz, an dem es die Welt erforschen kann, sicher und ohne jene Einschränkungen, die durch Angst oder das Ausklammern von bestimmten Gefühlen entstehen.
Die Sorge um die kognitiven Fähigkeiten unserer Kinder ist normal, aber sie ist auch symptomatisch dafür, dass man sich auf den Horizont in der Ferne konzentriert anstatt auf das, was jetzt und hier in diesem Augenblick passiert. Für ganz kleine Kinder ist das Hier und Jetzt das Einzige, was es gibt, und sind sie vollauf damit beschäftigt. Die in diesem Buch besprochenen Themen haben viel mit genau dieser Frage zu tun: Wie können Eltern der emotionalen Sicherheit Priorität einräumen und nach dem Spruch „Jetzt gut, immer gut“7 ihren Kindern das geben, was sie brauchen? Hier ist eine kurze Faustregel: Je mehr sich die Kinder in ihren primären Beziehungen zu Beginn ihres Lebens sicher und geborgen fühlen, desto entspannter und resilienter werden sie sein, wenn sie sich später im Leben verschiedenen Herausforderungen und Gelegenheiten gegenübersehen.
Wie ermöglichen wir unseren Kindern also eine sichere Bindung?
Die gute Nachricht für Eltern ist, dass Elternschaft nicht kompliziert sein muss. Wenn wir uns an unseren (bereits tief in uns angelegten) Fähigkeiten orientieren, können wir die sogenannte Aufgabe des Elternseins viel eher als das Geschenk beziehungsweise Privileg angehen, das es in Wirklichkeit ist. Und wenn wir dem authentischen Wunsch vertrauen, unseren Kindern das zu geben, was für sie am besten ist, sowie der enormen Fähigkeit der Kinder, genau das aus uns hervorzuholen, kann das Elternsein fast schon zum Kinderspiel werden.
Sie wissen vermutlich inzwischen, dass wir hier nicht von einer Art Einfachheit nach dem Motto „Schlafe aus, fühle dich nie überfordert, Elternsein ist so leicht wie eine Sommerbrise“ sprechen. Vielmehr wollen wir sagen, dass die „harte Arbeit“ des Elternseins zu etwas viel Angenehmerem wird, wenn wir als Eltern erst einmal unseren positiven Absichten vertrauen und über ein einfaches visuelles Bild verfügen, das uns ermöglicht, die Bedürfnisse unseres Kindes in eine klare und verständliche Landkarte zu übersetzen.
Erinnern Sie sich an Lei und ihren Vater aus Kapitel 1. Denken Sie an Baby Sophie und seine Mutter. In jenen einfachen, natürlichen Interaktionen können Sie den ursprünglichen Instinkt des Kindes erkennen, nach Fürsorge zu suchen, und den in ähnlicher Art und Weise angeborenen Instinkt der Eltern, Fürsorge zu geben. Obgleich es in den ersten Tagen und Wochen eines Babys nicht so offensichtlich ist, kann man bereits kurze Zeit nach der Geburt sehen, wie das Kind anfängt, die Welt zu erkunden. Oder gehen Sie auf einen beliebigen Spielplatz, und Sie werden dort den gleichen Austausch beobachten können, der zwischen Lei und ihrem Vater stattfand: Lei möchte loslaufen, um ihre Welt und ihre Fähigkeit, mit ihr zu interagieren, zu erkunden; ihr Vater ist da, um ihr das zu ermöglichen. Und das ist Sophie fünf Monate später:
Hannah arbeitet am Esszimmertisch an ihrem Computer, während Sophie sich in ihrem Laufgestell im Raum herumschiebt. Wenn sie gurrt und plappert, schaut Hannah auf und sie lächeln einander an. Dann klingelt das Telefon. Es ist Hannahs wichtigster Kunde, der wissen möchte, wie das Projekt läuft. Während Hannah den Fortschritt in allen Details schildert, wird Sophies Stimme höher; schließlich steigert sich das Plappern zu einem schrillen Kreischen. Das kleine Mädchen weint nicht und ist auch nicht wütend, aber ihre Stimme ist so fordernd, dass Hannah sofort hinüberschaut und ein Lachen unterdrücken muss, als ihr Kunde verwundert fragt: „Was ist das denn, etwa Ihr Hund?“
In diesem zarten Alter ist Sophie bereits sicher genug gebunden, um zu wissen, dass sie sich darauf verlassen kann, dass Hannah da ist, während sie auf eigene Faust den Raum unsicher macht. Diese Unterstützung bei ihren Erkundungen ist so wichtig, dass sie ihr „Sirenenlied“ anstimmt, um die Mutter zurückzurufen, wenn sie bemerkt, dass die Aufmerksamkeit der Mutter sich von ihr abgewendet hat. Wenn die Mutter sich nicht wieder und wieder als zuverlässig herausgestellt hätte, hätte Sophie es möglicherweise gar nicht erst versucht. (Ein Jahr später löst Sophie einen Autoalarm aus, als sie von ihrem Buggy aus ihr Sirenenlied ausprobiert. Hannah glaubt, dass Sophie herausfinden wollte, ob fremde Passanten darauf auch so reagieren wie ihre Eltern. Und natürlich tun sie das.)
Sophie konnte ihre Mutter erkennen, lange bevor sie ihren eigenen Namen kannte oder auch nur irgendetwas von den Worten verstand, mit denen die aufmerksame Familie versuchte, sie zu beruhigen. Möglicherweise hat sie die Bedeutung der Bindung zwischen ihnen begriffen, bevor ihre Mutter dies tat. So sieht eine aufkeimende sichere Bindung aus. Es ist zwar nicht immer nur angenehm (bleiben Sie dran, wenn Sie wissen wollen, wie es mit Sophie weiterging), und doch ist die tiefe Schönheit dieser Bindung in der ganzen Menschheitsgeschichte in Poesie und Kunst zum Ausdruck gebracht worden.
Die gute Nachricht für uns alle ist, dass Bindung einfach geschieht. Die Frage ist nicht, ob ein Kind eine Bindung entwickelt, sondern von welcher Qualität diese Bindung ist. Die Frage ist nicht, ob die Mutter oder der Vater die Bedürfnisse des Kindes erfüllen und sein Unbehagen lindern wollen, sondern ob sie wissen, wie sie das tun können (oder ob sie die Bedürfnisse aus Gründen, die wir später besprechen, nicht sehen können). Wir haben festgestellt, dass, selbst wenn der Bindungsinstinkt der Bezugsperson gestört ist, der des Kindes stark bleiben kann.
Es ist manchmal kaum zu glauben, aber schon mit geringer Hilfe schaffen es viele Eltern, den widrigsten Umständen zu trotzen. Die meisten Eltern in unseren ersten Gruppen zum Kreis der Sicherheit hatten mit einer Vielzahl von aktuellen und vergangenen Problemen zu kämpfen, die Palette reichte von Armut über mangelnde Bildung bis hin zu früheren Missbrauchserlebnissen und erst kürzlich zurückliegender Drogensucht. Daraus ergeben sich sehr schwierige Rahmenbedingungen, die laut Alan Sroufe einen starken Effekt ausüben: „Die Entwicklung des Kindes ist untrennbar mit der Fürsorge verbunden, die es umgibt. Ebenso ist die Fürsorge, die die Bezugspersonen geben können, von der Art des Stresses und der zur Verfügung stehenden Unterstützung im Umfeld abhängig.“ Wenn dieser Stress sehr groß ist, wie zum Beispiel für alleinerziehende jugendliche Mütter und andere Menschen, die sich die größte Mühe geben müssen, um es durch den Tag zu schaffen – und auch für viele „normale“ Eltern heutzutage –, ist es schwer, die Bedürfnisse eines Kindes feinfühlig zu erfüllen oder mit der Kohärenz und dem Verständnis zu reagieren, die notwendig sind.
Über zwanzig Jahre lang haben wir mit ehemalig obdachlosen jugendlichen Eltern gearbeitet, die kaum in der Lage zu sein schienen, die Herausforderungen der Elternschaft zu bewältigen. Viele kamen unter Tränen in unseren Kurs – voller Angst, dass sie den Kreislauf aus Missbrauch und Vernachlässigung fortsetzen würden, den sie selbst als Kinder erlebt hatten. Mithilfe eines elternfreundlichen Ansatzes, der die Entwicklung einer gesunden Bindung anregt, sind viele dieser Teenager sehr erfolgreiche Eltern geworden, die absolut fähig sind, sich selbst und ihre Kinder auf dem Weg dahin zu unterstützen, was Bindungsforscher „erarbeitete Sicherheit“ nennen. Wir haben immer wieder erlebt, wie Eltern sich trotz ausgesprochen schlechter Voraussetzungen mit den liebevollen und fürsorglichen Instinkten verbinden, mit denen sie auf die Welt kamen, und ihren Kindern authentische und beständige Sicherheit geben.
Was ist mit denjenigen unter uns, die es nicht mit Herausforderungen dieses Ausmaßes zu tun haben? Würde Lei ein langes, gesundes und glückliches Leben führen, wenn ihr Vater die Zeit, die er seiner Tochter widmet, darin investieren würde, sie mit der bestmöglichen Bildung, einem behaglichen Zuhause und den nahrhaftesten Lebensmittel zu versorgen, den direkten Kontakt mit ihr aber einem Kindermädchen und anderen Erwachsene überließe? Das ist durchaus möglich. Auf die Entwicklung eines Kindes haben viele verschiedene Variablen Einfluss. Wenn Lei von frühester Kindheit an ein Kindermädchen, ein Großelternteil oder jemand anderen aus der Familie gehabt hätte, der sich auf eine Art und Weise um sie gekümmert hätte, wie wir es in der Spielplatzszene gesehen haben, hätte sie trotzdem eine sichere Bindung zu einer primären Bezugsperson, die die Grundlage für eine gesunde Entwicklung bildet. Und, wie bereits gesagt, sie hätte noch immer eine Bindung an ihre Eltern, aber wahrscheinlich eine weniger sichere als die an den Menschen, der ihre Betreuung hauptsächlich übernimmt. Die Bedeutung einer innigen und beständigen Verbindung zu einem anderen Menschen ist nicht zu unterschätzen.