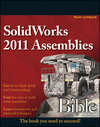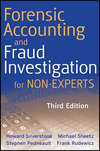Kitabı oku: «Dracula», sayfa 7
Wie klar der Mann denkt; Irre können das immer innerhalb ihrer eigenen Welt. Mich würde interessieren, wie viele Leben ihm ein Mensch wert ist. Er hat seine Berechnungen ganz gewissenhaft abgeschlossen, und heute begann er von neuem. Wie viele von uns legen sich Rechenschaft von jedem Tag ihres Lebens ab?
Mir kommt vor, dass mein bisheriges Leben aufgrund dieser neuen Hoffnung geendet hat, und ich nun gewissenhaft mit einem neuen beginnen müsse. Es wird doch so bleiben, bis der Große Buchhalter mit mir abrechnet und meine Bilanz abschließt, die mir dann einen positiven oder negativen Saldo ausweisen wird. Oh, Lucy, Lucy, ich kann dir nicht böse sein, und auch nicht meinem Freund, dessen Glück auch deines ist; ich kann nur abwarten in Hoffnungslosigkeit und Arbeit. Arbeit! Arbeit!
Wenn ich nur wenigstens wie mein armer, verrückter Schützling, einen so starken, aber guten und selbstlosen Motor zur Arbeit hätte, das wäre mir wahrlich eine Freude.
TAGEBUCH VON MINA MURRAY
26. Juli – Ich bin besorgt, aber es hilft mir, dass ich hier ein wenig Dampf ablassen kann; es ist, als ob ich mir selbst zu gleicher Zeit zuflüstern und zuhören würde. Und es liegt etwas in den stenographischen Zeichen, die sich so sehr von der normalen Schrift unterscheiden. Ich bin unglücklich wegen Lucy und wegen Jonathan. Ich hatte schon so lange nichts mehr von Jonathan gehört, und war sehr beunruhigt. Gestern schickte mir der immer so nette Herr Hawkins einen Brief von ihm. Ich hatte ihm geschrieben und ihn gebeten, mir mitzuteilen, ob er denn etwas von Jonathan gehört habe, und er schrieb zurück, dass die mir mit diesem Schreiben zugesandte Beilage ihn gerade erreicht hatte. Es stand nur eine Zeile, datiert vom Schloss Dracula, mit dem Inhalt, dass er gerade abreisen wolle. Das sieht Jonathan gar nicht ähnlich; ich verstehe es nicht, und es beunruhigt mich. Noch dazu hat Lucy, die sonst wohlauf ist, wieder ihre alte Gewohnheit – das Nachtwandeln – aufgenommen. Ihre Mutter sprach darüber mit mir, und wir haben ausgemacht, dass ich jede Nacht die Tür zu unserem Zimmer verschließen werde. Frau Westenraa glaubt, dass Nachtwandler gewöhnlich auf Hausdächern und an Klippenrändern spazieren gehen, dann plötzlich aufwachen und mit einem durchdringenden Schrei, der überall widerhallt, hinabstürzen. Die arme Frau hat natürlich Angst um Lucy, und sie erzählte mir, dass ihr Mann, Lucys Vater, die gleiche Gewohnheit hatte; er stand oft in der Nacht auf, zog sich an und wäre fort gegangen, wenn man ihn nicht aufgehalten hätte. Lucy will im Herbst heiraten und macht bereits jetzt Pläne über ihre Kleidung und die Einrichtung ihres Hauses. Dafür habe ich volles Verständnis, denn ich habe ja Gleiches vor, nur dass Jonathan und ich beabsichtigen, unser Leben ganz einfach einzurichten, da wir mit wenig auskommen müssen. Herr Holmwood – es ist der ehrenwerte Arthur Holmwood, einziger Sohn von Lord Godalming – wird in Kürze hier sein, sobald er die Stadt verlassen kann, denn seinem Vater geht es nicht sehr gut; ich glaube, Lucy zählt die Minuten, bis er ankommt. Sie möchte ihn gerne hier zu unserer Bank heraufführen und ihm die Schönheiten von Whitby zeigen. Ich nehme an, dass es das Warten ist, das sie so nervös macht; es wird ihr besser gehen, wenn er dann da ist.
27. Juli – Keine Neuigkeiten von Jonathan. Ich beginne, mich um ihn zu sorgen, obwohl ich nicht weiß warum; aber wünsche mir so sehr, dass er mir schreibt, und wäre es lediglich eine Zeile. Lucy wandelt in den Nächten mehr herum als je, und dabei weckt mich jedes Mal ihr Herumgehen im Zimmer. Glücklicherweise haben wir so warmes Wetter, dass sie sich dabei nicht erkälten kann; doch die Sorge um sie und das ständige Aufgewecktwerden machen sich bereits bei mir bemerkbar, denn ich werde nervös und schlaflos. Gott sei Dank bleibt Lucy bei Gesundheit. Herr Holmwood ist plötzlich nach Ring berufen worden, um nach seinem Vater zu sehen, der ernsthaft krank geworden ist. Lucy ist traurig, weil sich das Wiedersehen mit ihm nun wieder verzögert, aber rein äußerlich merkt man ihr nichts an. Sie ist etwas kräftiger geworden und ihre Wangen haben einen lieblichen rosigen Schimmer. Sie hat das anämische (blutarme) Aussehen vollkommen verloren. Ich bete darum, dass es so bleiben wird.
3. August – Wieder eine Woche vorbei und noch nichts Neues von Jonathan. Nicht einmal Herr Hawkins erhielt etwas, wie ich von ihm hörte. Oh, wie ich hoffe, dass er nicht krank ist. Aber dennoch würde er geschrieben haben. Ich lese immer wieder seinen letzten Brief, aber es beruhigt mich nicht. Es ist die nicht die Art, wie er sonst schreibt, aber es ist in jedem Fall seine Handschrift, darüber gibt es gar keinen Zweifel. Lucy war in der vergangenen Woche weniger schlafwandeln, aber sie ist seltsam aufmerksam, was ich mir aber nicht erklären kann. Selbst im Schlaf scheint sie, mich zu beobachten. Sie versucht, die Tür zu öffnen, findet die Tür verschlossen vor und geht durchs Zimmer, um nach dem Schlüssel zu suchen.
6. August – Wieder drei Tage und keine Nachricht. Die Anspannung ist schrecklich. Wenn ich nur wüsste, wohin ich schreiben soll oder wohin ich gehen soll, um ihn zu finden, dann würde ich mich besser fühlen; aber niemand hat seit seinem letzten Brief ein Wort von ihm gehört. Es bleibt mir nur, Gott um Geduld zu bitten. Lucy ist erregter als sie es jemals war – ist aber auf der anderen Seite wohlauf. In der letzten Nacht sah es sehr bedrohlich aus, und die Fischer sagten Sturm voraus. Ich werde Beobachtungen anstellen und versuchen, die Zeichen des Wetters richtig deuten zu lernen. Heute ist ein grauer Tag, und die Sonne – während ich dies schreibe – steht, in dicke Wolken gehüllt, hoch über Kettleness. Alles ist grau – außer dem grünen Gras, das smaragdfarben leuchtet; graue robuste Felsen; graue Wolken, deren äußere Ränder von der Sonne durchleuchtet werden, hängen über der grauen See, in die sich die Sandbänke wie braune Finger ausstrecken. Das Meer stürzt über die Untiefen und Sandbänke mit einem Gebrüll hinweg, das aber vom landeinwärts ziehenden Nebel gedämpft wird. Der Horizont verliert sich im grauen Dunst. Alles ist so überaus gewaltig; die Wolken türmen sich wie gigantische Felsen, und über der See liegt ein tief murrender Klang, als hätte sie ein Verhängnis vorauszusagen. Dunkle Gestalten tauchen da und dort am Strand auf, und sehen im Nebelschleier aus wie wandelnde Bäume. Die Fischerboote beeilen sich heimwärts und heben und senken sich in der Brandung, wenn sie in den Hafen einlaufen. Da kommt der alte Herr Swales. Er geht direkt auf mich zu, und an der Art, wie er den Hut abnimmt, erkenne ich, dass er mit mir sprechen will.
Ich bin tief ergriffen von der Veränderung, die in dem armen, alten Mann vorgegangen ist. Nachdem er sich neben mich gesetzt hatte, begann er sanft:
„Ich habe Ihnen etwas zu sagen, Fräulein.“ Ich sah, dass es ihm nicht leicht wurde. So nahm ich seine alte, faltenreiche Hand und bat ihn, frei heraus zu sprechen; dann sagte er, während er seine Hand in der meinen ließ:
„Ich fürchte, meine Liebe, ich hab’ Sie mit all den hässlichen Dingen gekränkt, die ich die letzte Woche über die Toten sprach; ich hab’ es nicht so gemeint und bitte Sie, daran zu denken, wenn ich einmal nicht mehr bin. Wir Alten, schon gebrechlich und mit einem Fuß im Grab, lieben es nicht, daran zu denken, und wir fühlen uns auch nicht wohl in der Nähe des Todes; deshalb hab’ ich mein eig’nes Herz etwas aufheitern und mich etwas erleichtern wollen. Aber Gott segne Sie, Fräulein, ich fürcht’ den Tod nicht, nicht ein bisschen; aber sterben möcht’ ich doch nicht gern, solang’ es noch anders geht. Doch meine Zeit rückt immer näher, denn ich bin alt, und hundert Jahre sind mehr als ein Mensch erwarten kann; ich bin wohl dem Ende meines Lebens sehr nahe gekommen, dass wohl der Sensenmann schon seine Klinge geschliffen hat. Sie sehen, ich kann nicht von der Gewohnheit lassen, darüber zu witzeln. Bald wird der Todesengel für mich seine Instrumente ertönen lassen. Aber trauern Sie nicht zu sehr, mein Liebling“, er sah, dass ich weinte, „wenn er heut’ Nacht noch riefe, würd’ ich mich nicht sträuben, seinem Ruf zu folgen. Denn das Leben ist doch nichts als ein Warten auf etwas and’res, und nur der Tod ist was, worauf wir uns letztlich verlassen können. Aber ich bin zufrieden, wenn er zu mir kommt, und er kommt bald. Er kann schon unterwegs sein, während wir da hinausschauen und nachdenken. Vielleicht kommt er mit dem Wind, weit draußen über der See, der Untergang, Schiffbruch, düstere Verzweiflung und traurige Herzen bringt. Schauen Sie! Schauen Sie!“, rief er plötzlich, „es ist etwas in diesem Wind und in der Luft, das klingt, das aussieht, das schmeckt und riecht wie der Tod. Es liegt in der Luft. Ich fühl’ es kommen. Oh Herr, lass’ mich freudig antworten, wenn mich mein Ruf ereilt.“ Er streckte seine Arme demutsvoll aus und nahm seinen Hut ab. Seine Lippen bewegten sich, als würde er gerade beten. Nach einem Augenblick der Stille erhob er sich, schüttelte mir die Hand, segnete mich, sagte mir auf Wiedersehen und humpelte davon. All das rührte mich tief und brachte mich durcheinander.
Ich war froh, dass der Küstenwart herankam mit seinem Fernroh unter dem Arm. Er blieb stehen, um mit mir zu sprechen, wie er es immer tat; aber er sah dabei immer hinaus auf ein fremdes Schiff.
„Ich kann es nicht herausfinden“, sagte er, „dem Aussehen nach ist es ein russisches Schiff; aber es kreuzt auf sonderbarste Weise herum. Es scheint den Sturm kommen zu sehen und kann sich nicht entschließen, entweder nordwärts in See zu stechen oder den Hafen anzulaufen. Sehen Sie nur wieder! Es wird eigenartig gesteuert; so, als ob keine Hand das Steuer führte; mit jedem Windstoß ändert es die Richtung. Ich glaube, wir hören noch mehr davon, ehe der morgige Tag anbricht.“
SIEBENTES KAPITEL
ZEITUNGSAUSSCHNITT AUS DEM „DAILYGRAPH“ VOM 8. AUGUST
(In das Tagebuch von Mina Murray eingeklebt)
Von einem Korrespondenten
Whitby
Schwere Stürme fielen über Whitby her. Die Begleitumstände dazu waren seltsam und einzigartig zugleich. Es war schwül, aber das Wetter war nicht anders, als es sonst im August üblich ist. Samstagabend war es schöner denn je, und der größte Teil der Urlauber besuchte gestern die Mulgrave Woods, Robin Hood’s Bay, Rig Mill, Runswick, Saithes und die anderen zahlreichen Ausflugsziele rund um Whitby. Die Dampfschiffe Emma und Scarborough machten der Küste entlang ihre Routen; und es waren besonders viele auf Ausflügen unterwegs – von und nach Whitby. Der Tag war ungewöhnlich schön, bis nachmittags einige der plaudernden Spaziergänger, die in dem Friedhof auf der Ostklippe spazierten und den sich weit ausdehnenden Rundblick über das Meer genossen, plötzlich auf eine hoch am nordwestlichen Himmel herankommende Sturmwolke aufmerksam wurden. Der Wind blies aus Südwest in moderatem Tempo, und Meteorologen würden ihn als „Nummer 2: leichte Brise“ deklarieren. Der Dienst habende Küstenwart machte sofort Meldung, und ein alter Fischer, der seit mehr als einem halben Jahrhundert auf die Wetterzeichen achtet, die von der Ostklippe kommen, prophezeite höchst erregt einen schweren Sturm. Der Sonnenuntergang war so prächtig, so grandios in seiner Fülle an herrlich gefärbten Wolken, dass sich eine große Menschenmenge in dem alten Friedhof an der Klippe versammelte, um den prachtvollen Ausblick zu bewundern. Ehe die Sonne hinter der schwarzen Masse des Vorgebirges von Kettleness verschwand, säumten unzähligen Wolken ihren Weg. Sie trugen alle Farben eines Sonnenunterganges in sich – Feuerrot, Purpur, Rosa, Grün, Violett und alle Schattierungen von Gold; dazwischen lagen schmale Streifen in absoluter Schwärze. Dieses seltene Wetterspiel ist auch an den Malern nicht spurlos vorbeigegangen, und es werden nächstes Jahr im Mai mehrere Skizzen mit dem Titel „Vorspiel vor dem großen Sturm“ die Wände der R.A. (Royal Academy of Arts) und der R.I. (Royal Institution) schmücken. Mehr als nur ein Kapitän wird sich wohl dafür entschieden haben, mit seinem cobble oder mule – wie man dort die unterschiedlichen Boote bezeichnet – im Hafen auf das Ende des Sturmes zu warten. Der Wind schwächte gegen Abend immer mehr ab, und um Mitternacht war es totenstill. Es lag eine drückende Schwüle und jene vorausahnende Spannung in der Luft, die Menschen, die von feinfühliger Natur sind, beim Herannahen eines Gewitters spüren. Nur wenige Lichter funkelten am Meer; sogar die Küstendampfer, die sich für gewöhnlich dicht am Ufer entlang „schmiegen“, hielten sich seewärts, und nur einzelne Fischerboote waren zu sehen. Das einzig Bemerkenswerte auf See war ein fremdes, zweimastiges Segelschiff, das alle Segel gesetzt hatte und augenscheinlich westwärts wollte. Das Draufgängertum oder die Unwissenheit der Offiziere lieferte reichlichen Gesprächsstoff für die Zuschauer, solange das Schiff in Sichtweite war; dem Schoner wurde sogar signalisiert, dass er angesichts der drohenden Gefahr weniger Segel setzen solle. Ehe die Nacht noch völlig hereingebrochen war, sah man das Schiff mit trägen Segeln draußen sanft im wogenden Rhythmus der Wellen schaukeln.
Kurz vor 10 Uhr wurde die Stille beängstigend, und das Schweigen so einschneidend, dass man von landeinwärts das Blöken eines Schafes oder das Bellen eines Hundes aus der Stadt deutlich hören konnte; und die Kapelle auf dem Pier mit ihren lebhaften, französischen Tönen wirkte disharmonisch gegenüber dem großen Wohlklang der schweigenden Natur. Kurz nach Mitternacht jagte ein seltsamer Laut über das Meer, und hoch in der Luft begann ein eigenartiges, schwaches und hohles Brausen.
Dann brach der Sturm ohne besondere Vorwarnung aus. Mit unglaublicher Geschwindigkeit, die jetzt noch schwer zu begreifen ist, hatte sich das Aussehen der Natur spontan geändert. Die Wellen wuchsen in schwellender Wut; jede neue Flutwelle übertraf die andere, sodass in wenigen Minuten aus dem bisher aalglatten Meer ein dröhnendes und verschlingendes Ungeheuer geformt wurde. Wellen mit weißer Krone schlugen wie verrückt über die flachen Sandbänke und hetzten die steilen Klippen hinauf; andere brachen über den Damm, und ihre Gischt fegte über die Laternen der Leuchttürme, die an den Enden der Piers im Hafen von Whitby hoch in den Himmel ragen. Der Wind lärmte wie Donner und blies mit einer Gewalt, dass es sogar für starke Männer schwierig war, sich auf den Füßen zu halten, und es wurde notwendig, sich mit erbitterter Umklammerung an den eisernen Geländern festzuhalten. Es schien geboten, den gesamten Hafen samt Strand und Piers von den Massen der Zuschauer zu räumen, da sich sonst mancherlei Unfälle in dieser Nacht ereignet hätten. Zu den gegenwärtigen Schwierigkeiten und Gefahren kam noch hinzu, dass riesige Nebelwände vom Meer zum Land hin drängten – weiße, feuchte Wolken, die in Gespensterkleidern vorbeihuschten, so dunstig und kalt, dass man der Einbildung erliegen konnte, dass die Geister, die auf hoher See ihr Grab gefunden hatten, nach ihren lebenden Brüder mit ihren nasskalten Händen zu greifen versuchten; und mehrere schauderten, als die weißen Nebelgebilde an ihnen vorbei strichen. Manchmal lösten sich die Nebel auf, und das Meer wurde durch den Schein der grellen Blitze sichtbar. Die Speere des Zeus fuhren pausenlos herab und wurden von schrecklichen Donnerschlägen begleitet, wodurch der komplette Himmel durch die Wut und Wucht des Sturmes zu erzittern schien. Die Szenen waren von unermesslicher Schönheit und magischem Interesse – die See, so hoch heran rollend wie ein Gebirge, warf mit jeder Woge Massen weißen Schaums in den Himmel, und der Sturm griff danach und trug sie in die Lüfte davon; hie und da war ein Fischerboot mit Segeln, die eher Stofffetzen glichen, und sie schossen dahin mit dem Wind, um sich vor dem Unwetter in Sicherheit zu bringen; immer wieder die weißen Flügel der Seevögel, die im Sturm umher geschleudert wurden. Am Gipfel der Ostklippe stand der neue, noch unverwendete Suchscheinwerfer einsatzbereit. Der Befehls habende Offizier setzte den Scheinwerfer in Betrieb, um das Meer auf Schiffbrüchige und Notfälle abzusuchen. Ein paar Mal leistete das Licht gute Dienste. So etwa, als ein Fischerboot, über dessen Bordwände die Wellen peitschten, in den Hafen eilte und aufgrund des helfenden Lichts das Zerschellen an den Piers vermeiden konnte. Als alle Boote den sicheren Hafen erreicht hatten, klang ein Freudenschrei durch die Menge am Ufer, ein Schrei, der für einen Augenblick dem Sturm Einhalt gebot und sich dann in seinem Brausen auflöste. Kurz danach erfasste der Scheinwerfer in einiger Entfernung einen Schoner mit vollen Segeln, offenbar dasselbe Schiff, das schon am Abend zuvor gesichtet worden war. Der Wind hatte sich nun nach Osten gedreht, und ein Schaudern ging durch die Zuseher, als sie erkannten, in welcher Gefahr das Schiff sich nun befand. Zwischen ihm und dem Hafen lag nun das flache und lange Riff, auf dem schon oft so manches gute Schiff sein Ende fand. Bei der gegenwärtigen Windrichtung schien es undenkbar, dass der Zweimaster den Hafen erreichen könnte. Es war nun die Stunde der höchsten Flut, aber die Wogen hatten eine solche Größe und Gewalt, dass in den Wellentälern der Sand des Ufers sichtbar wurde; der Schoner mit allen Segeln hatte so viel Fahrt vor dem Wind, dass er nach den Worten eines alten Seemannes „irgendwohin laufen musste, und sei es nur in die Hölle“. Dann kam wieder neuer Nebel vom Meer, dichter als zuvor – dumpfe Schwaden, die sich wie ein graues Leichentuch über alles legten und die Menschen am Ufer nur mehr hören ließen, denn das Brüllen des Sturmes, der Krach des Donners und das Heulen der mächtigen Wellen klang durch die Finsternis lauter als je zuvor. Der Suchscheinwerfer blieb über den Ostpier hinweg auf die Hafenmündung gerichtet, wo man das Auflaufen des Schiffes erwartete, und alles starrte atemlos hinaus. Plötzlich drehte der Wind nach Nordost und die Nebelfetzen verflüchtigten sich im Sturm; und dann, mirabile dictu (wunderbar zu berichten), schoss zwischen den Piers, rasend von Welle zu Welle, der fremde Schoner mit vollen Segeln im Wind in den sicheren Hafen. Der Scheinwerfer folgte dem Schiff, und ein Schauer packte alle, die das sahen; denn ans Steuer des Schoners war ein Toter angebunden, der, mit gesenktem Kopf, bei jeder Bewegung des Schiffes hin und her gerissen wurde. An Deck war sonst keine andere Gestalt sichtbar. Ein großes Entsetzen überkam alle, als sich herausstellte, dass das Schiff, wie durch ein Wunder, gesteuert von der Hand eines Toten, den Hafen erreicht hatte. Aber all das geschah viel schneller, als es sich erzählen lässt. Der Schoner hielt nicht an, sondern flog quer durch den Hafen und fuhr auf einen Haufen Sand und Kies, der als „Tate Hill Pier“ bekannt ist, und den die Gezeiten und manche Stürme in der Südwestecke des Hafens angespült hatten.
Es war natürlich eine beträchtliche Erschütterung, als das Schiff auf der Sandbank auflief. Jede Spiere (Segelstange), jeder Strick und jedes Stag war gespannt und ein paar von den unteren Masten krachten herunter. Am seltsamsten war, dass im Augenblick der Landung ein großer Hund, wie durch den Stoß erschrocken, auf Deck kam und vorwärts laufend vom Bug auf das Ufer sprang. Er lief direkt auf die steilen Klippen zu, wo der Kirchhof über dem Fußweg zum Pier so steil abfällt, dass einige der Grabsteine – die Mundart nennt sie dort thruff-steans oder through-stones – über den abgestürzten Klippenrand vorragen, und verschwand im Dunkel, das noch schwärzer erschien, da die Augen durch das grelle Licht des Scheinwerfers geblendet waren.
Es befand sich im Augenblick niemand auf dem Tate Hill Pier, da sich alle in der Nähe Wohnenden entweder schon zur Ruhe begeben hatten oder als Zuschauer draußen oberhalb des Hafen in geschützten Höhen waren. So war der auf der Ostseite des Hafens Dienst habende Küstenwart, der plötzlich zum kleinen Pier lief, der Erste, der an Bord kletterte. Die Leute am Scheinwerfer schwenkten über die Hafenmündung, ohne etwas zu entdecken und fixierten dann den Scheinwerfer auf das Wrack. Der Küstenwart rannte achtern aus (Seemannssprache für: nach hinten), und als er das Steuerrad erreichte, beugte er sich vor, um es genau zu untersuchen – da warf es ihn vor Schreck zurück. Dies erregte das allgemeine Interesse, und viele der Leute strömten herbei.
Es war kein Wunder, dass der Küstenwart entsetzt war, denn nicht oft wird man so etwas zu Gesicht bekommen. Der Mann war mit den Händen – übereinander gelegt – an einer Speiche des Steuers festgebunden. Zwischen den Handflächen und dem Holz klemmte ein Kruzifix, dessen Kette um die Knöchel und die Radspeiche verlief; und alles wurde fest gehalten durch einen strammen Strick. Das arme Opfer mochte vielleicht ursprünglich gesessen haben, aber das Schlagen und Flattern der Segel hatte das Steuerrad so hin und her geworfen und ihn dabei mitgezogen, dass die Schnüre, mit denen er gefesselt war, das Fleisch bis auf die Knochen aufgeschnitten hatten. Ein zufällig anwesender Arzt stellte den Sachverhalt fest – der Chirurg J. M. Caffyn, East Elliot Place 33 – und gab an, dass der Mann schon mindestens zwei Tage tot sein musste. In seiner Tasche befand sich eine Flasche, die sorgfältig verkorkt, aber leer war bis auf eine kleine Papierrolle; wie sich dann herausstellte, war es eine Ergänzung zum Logbuch. Der Küstenwart erklärte, der Mann müsse seine Hände selbst fest gebunden und dann mit den Zähnen die Schnüre angezogen haben. Die Tatsache, dass ein Küstenwart der erste an Bord war, wird später die Verhandlung vor dem Seegericht vereinfachen; ein Küstenwart kann kein Bergegeld beanspruchen zum Unterschied von einem Privatmann, der als Erster ein Wrack betritt. Trotzdem rührten sich schon die juristischen Mäuler, und ein junger Rechtsstudent beteuerte, dass die Rechte des Schiffseigners gänzlich erloschen seien, da in diesem Fall das Gesetz über die tote Hand in Kraft trete; denn ohne Zweifel sei das Steuerrad, als ein Symbol der Herrschaft über das Schiff, von der Hand eines toten Mannes geführt worden. Es ist wohl nicht notwendig, besonders zu betonen, dass der tote Steuermann mit aller Rücksicht von seinen Fesseln gelöst wurde. Er hat seine Wacht in Ehren bis in den Tod gehalten – eine Zuverlässigkeit, so edel wie der junge Casabianca – und er wurde in der Leichenhalle bis zur gerichtlichen Untersuchung aufgebahrt.
Schon legte sich der Sturm, und seine furchtbare Kraft schwindet; die Menge zerstreute sich, die Menschen gingen heimwärts, und der Himmel rötet sich über den Wäldern von Yorkshire. Ich werde rechtzeitig für die nächste Ausgabe weitere Details über das Wrack sammeln, das im Sturm auf so wunderbare Weise den Weg in den Hafen fand.
Whitby
9. August – Die Begleitumstände beim Einlaufen des Wracks im Sturm der letzten Nacht sind fast noch merkwürdiger als die Sache selbst. Es stellt sich heraus, dass der Schoner aus Varna, Russland, kommt und Demeter genannt wird. Das Schiff transportierte fast ausschließlich Silbersand. Ein geringer Teil der Ladung bestand in einer Anzahl großer Kisten mit Erde. Die Ladung ist adressiert an einen Rechtsanwalt in Whitby, Herrn S. F. Billington, The Crescent 7, der heute Morgen an Bord ging und formell von den Gütern Besitz nahm, die an ihn adressiert waren. Der russische Konsul nahm stellvertretend für die Chartergesellschaft formell Besitz vom Schiff und bezahlte alle Hafengebühren et cetera. Das und nichts anderes ist das einzige Gesprächsthema. Das Handelsministerium beobachtet mit aller Strenge, dass sämtliche Geschäfte in Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften abgewickelt werden. Nachdem die Angelegenheit ein Fall mit Seltenheitswert ist, sind die Beamten bemüht, alles so zu handhaben, dass später keine Gründe zur Reklamation möglich sind. Ein großer Teil des allgemeinen Interesses war auch auf den Hund gerichtet, der an das Land gesprungen war, als das Schiff am Strand auffuhr. Nicht wenige der Mitglieder des in Whitby sehr mächtigen Tierschutzvereins SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals = Gesellschaft zur Vorbeugung von Gewalt an Tieren) hatten versucht, das Tier einzufangen. Die Enttäuschung war groß, als alle Versuche fehlschlugen; der Hund scheint überhaupt aus der Stadt verschwunden zu sein. Es ist möglich, dass das Tier in seinem Schrecken ins Moor lief, wo es sich vielleicht heute noch angsterfüllt versteckt. Einige sehen eine Gefahr für sich selbst; denn zweifellos ist es ein wildes Vieh. Heute in aller Früh wurde ein großer Hund tot auf der Straße liegend aufgefunden. Es war ein Bulldoggen-Mischling, der einem Kohlehändler in der Nähe des Tate Hill Pier gehörte. Der Hund lag gegenüber dem Haus seines Herrn. Er hatte gekämpft, und offensichtlich hatte er einen sehr bösartiges Gegner, denn seine Kehle war zerfetzt und sein Bauch aufgeschlitzt, wie von messerscharfen Krallen.
Später. – Der Freundlichkeit des Ministerialinspektors verdanke ich es, dass mir erlaubt wurde, das Logbuch der Demeter einzusehen. Es war, bis auf die letzten drei Tage, in Ordnung, wartete aber nicht mit besonders Interessantem auf, außer dem Bericht über die in Verlust geratene Mannschaft. Von weitaus größerem Interesse ist das in der Flasche gefundene Papier, das heute beim Prozess behandelt wurde; noch nie zuvor durfte ich einen seltsameren Bericht hören. Da es kein Motiv gibt, die Sache zu verheimlichen, wurde mir gestattet, einen Auszug zu machen. Ich sende Ihnen meine Abschrift, welche alles enthält – außer einigen technischen Details über Navigation und Ladung. Es scheint fast, als sei der Kapitän, ehe er ins blaue Meer stach, von einer Art Manie befallen worden, die dann während der Fahrt hartnäckig weiterwuchs. Jedenfalls bitte ich meinen Bericht cum grano (mit einiger Vorsicht) zu genießen, da ich diesen nach dem Diktat eines Sekretärs des russischen Konsuls schreibe, der die Güte hatte, mir das Schriftstück, trotz der nur gering zur Verfügung stehenden Zeit, zu übersetzen.
LOGBUCH DER DEMETER
Von Varna nach Whitby
Geschrieben am 18. Juli, seltsame Dinge ereigneten sich, sodass ich von nun an bis zur Landung exakte Aufzeichnungen vornehme.
Am 6. Juli waren wir mit den Ladungsarbeiten fertig, Silbersand und Kisten mit Erde. Mittags Segel gesetzt. Ostwind, frisch. Besatzung: fünf Mann, zwei Unteroffiziere, Koch und ich (Kapitän).
Am 11. Juli fuhren wir bei Morgendämmerung in den Bosporus ein. Türkische Zollbeamte kamen an Bord. Schmiergeld. Alles korrekt. Weiterfahrt nachmittags um 4 Uhr.
12. Juli. Durch die Dardanellen. Weitere Zollbeamte und das Flagschiff der Bewachungsflotte. Wieder Schmiergeld. Schiffskontrolle von oben bis unten, aber rasch. Wollen uns bald los sein. Bei Dunkelheit in den Archipel eingelaufen.
Am 13. Juli passierten wir Kap Matapan (jetzt Kap Tainaron; Griechenland). Mannschaft über irgendetwas unzufrieden. Scheinen ängstlich, wollen aber nicht sprechen.
Am 14. Juli ist die Mannschaft irgendwie besorgt. Die Männer, alles kräftige Jungs, waren schon früher mit mir gesegelt. Der Maat (= Schiffsmann; Unteroffizier) konnte nicht herausfinden, was falsch lief; sie sagten ihm lediglich, dass da etwas sei und bekreuzigten sich daraufhin. Der Maat verlor an diesem Tag seine Beherrschung und schlug einen. Erwartete heftigen Tumult, aber es blieb ruhig.
Am 16. Juli in der Früh meldete der Steuermann, dass einer der Crew, namens Petrofsky, fehle. Konnte es mir nicht erklären. Übernahm Backbordwache für acht Gläser (alte Zeitrechnung auf See mittels Sanduhr: acht Gläser entsprechen dabei vier Stunden) letzte Nacht; wurde durch Abramoff abgelöst, ging aber nicht in die Koje. Mannschaft noch niedergeschlagener – mehr denn je. Alle sagten, dass sie etwas Besonderes erwarteten, wollten aber nicht mehr sagen, als dass etwas an Bord sei. Der Maat wurde sehr ungeduldig mit ihnen; ich fürchtete Schwierigkeiten.
17. Juli, gestern: Einer der Leute, Olgaren, kam zu mir in die Kajüte und vertraute mir völlig verstört an, dass er meine, es befinde sich ein fremder Mann an Bord. Er erzählte mir, dass er sich in seiner Wache hinter dem Deckhaus, vor einer Regenböe geschützt, aufgestellt und einen großen schlanken Mann gesehen habe, der nicht wie einer von der Besatzung aussah. Er kam die Mannschaftsstiege herauf, ging an Deck dem Bug zu und verschwand. Er folgte ihm vorsichtig, doch als er zum Bug kam, fand er niemanden, und alle Luken waren geschlossen. Er war vor abergläubischer Furcht fast wahnsinnig; ich bin in Sorge, es könnte eine Panik entstehen. Um dies zu verhindern, werde ich heute das ganze Schiff sorgfältig durchsuchen lassen und zwar von vorn bis hinten.
Später am Tage holte ich mir sämtliche Leute zusammen und sagte ihnen, dass ich, weil sie glaubten, es sei etwas Fremdes an Bord, das ganze Schiff vom Bug bis zum Heck durchsuchen lassen wolle. Erster Maat war ärgerlich; er sagte, das wäre Unsinn und solchen Torheiten nachzugehen, heiße die Mannschaft demoralisieren; er meinte, er wolle sich verpflichten, sie mit einer Brechstange vor einem Unglück zu bewahren. Ich beauftragte ihn mit der Führung des Ruders, während die Übrigen Seite an Seite, mit Lampen zu suchen begannen. Kein Winkel blieb unerforscht. Da waren nur die großen Holzkisten, nirgends aber ein versteckter Winkel, wo sich ein Mensch hätte verborgen halten können. Die Männer waren erleichtert, als die Suche vorüber war, und nahmen mit neuem Mut ihre Arbeit auf. Der erste Steuermann machte ein böses Gesicht, sagte aber nichts.
22. Juli – Schlechtes Wetter die letzten drei Tage, und alle waren beschäftigt mit den Segeln – keine Zeit, sich zu ängstigen. Die Leute scheinen ihre Furcht vergessen zu haben. Der Steuermann ist wieder vergnügt, und alles ist in guter Stimmung. Ich lobte die Mannschaft für ihre Arbeit bei dem schlechten Wetter. Passierten Gibraltar und fuhren durch die Meerenge. Alles in Ordnung.
24. Juli – Es scheint ein Fluch auf dem Schiff zu liegen. Schon ein Mann weniger, nun Einfahrt in den Golf von Biscaya bei starkem Unwetter und heute Nacht wieder ein Mann verloren – verschwunden. Wie der erste; er kam von der Wache ab und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Mannschaft in Panik; verfasste eine Petition, zu zweit die Wachen beziehen zu dürfen, da sie sich vor den Wachen fürchten. Der Steuermann wütend. Angst vor irgendeinem Aufstand, denn entweder er oder die Mannschaft verüben eine Gewalttat.